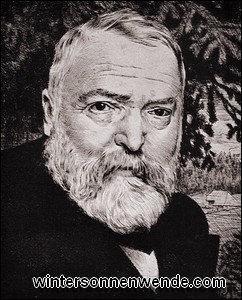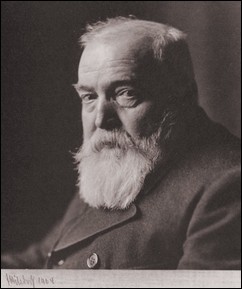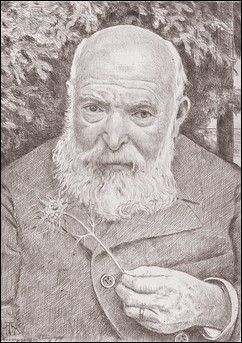|
[Bd. 4 S. 355]

Als Hans Thoma am 2. Oktober 1839 in Bernau zur Welt kam, hatte er schon einen Bruder namens Hilarius. Die Eltern betrieben ein Bauernlädchen mit Spezereiwaren, Brot und Mehl; eigentlich war der Vater Müller, jedoch ging er gleich vielen Bernauer Männern lieber mit Holz um, er wurde Schindelmacher und Holzschnefler. Viel zu verdienen gab es nicht. Das Bauernwesen lag allen im Blut, doch gibt es auf dem hohen Schwarzwald für Kleinbauern nicht viel Vorteile; zu einem Hof ist ausgedehntes Land nötig, denn es ist nicht sehr ertragreich, die Viehhaltung und der Waldbesitz sind am wichtigsten. Bernau ist eines der schönsten Hochtäler des südlichen Schwarzwaldes. Die Gemeinde liegt langgegliedert, in Mulden gebettet; im Talgrund, am geschützten Hang ruhen die Häuser verstreut im Sonnenglast wie große, geduckte silberne Tiere. Im Winter sieht man sie fast nicht im Gelände, wenn der Schnee dick auf den Walmdächern liegt und die herabgezogenen Dachhauben mit dem Boden vereint, so daß oft Gebilde entstehen wie Hünengräber. Das Bernauer Bauernhaus ist ein Teil der Landschaft, ein Lebewesen, das hier eingeboren wurde mit dem Instinkt, der die Tiere in ihrer Natur leben läßt. Heide und Weide, Matte und Wald, viele flinke Gewässer, weite Rundblicke von den freien Höhen, Nähe der Schweizer Alpen in der Klarheit des Föhns, Viehherden – das sind die Eigenheiten der Heimatlandschaft Hans Thomas. Das erstaunliche Ereignis, daß aus einer stillen Dorfgemeinde und aus dem Schoß einer im kleinen Werktag sich [356] mühenden bäuerlichen Familie ein so großer Sproß wuchs, ist gerade bei Thoma aus gewissen Erbanlagen zu erklären. Wir sind ja heute in besonderem Maße geneigt, auf unsere Vorfahren der ganzen Sippe zu sehen, um uns selber als Gestalt zu erfassen. Dies hat eine wichtige erzieherische Seite: Man kann sein eigenes Ich nur noch als Glied einer Kette fühlen, das ein Nichts ist ohne die Gemeinschaft. Ahnenkunde ist eigentliche Volkskunde. Der alemannische Mensch am Oberrhein ist schon längst erkannt worden als ein erzieherisches Talent, zum mindesten als ein lehr- und lernfreudiger Geist. Und so kommt es auch, daß mancher große Pädagoge aus unserem Volksteil erwuchs; es gehören unsere Künstler allemal dazu, auch Hans Thoma. Jeremias Gotthelf und Gottfried Keller, Pestalozzi, Jakob Burckhardt, Zwingli in der Schweiz, bei uns im Rheinwinkel dann J. P. Hebel und für das Elsaß in jüngstvergangener Zeit Friedrich Lienhard. Diese wahllos herausgegriffenen Beispiele aus den Kreisen der Künstler und der Gelehrten zeigen deutlich die geistige Grundhaltung des stammhaften Erbgutes. Hans Thomas Sippe, wie er sie schildert, der ein sehr sippenfreudiger Mensch war, nie ganz dem warmen Gehege des heimatlichen Kreises entglitten, sie weist deutliche Züge des lebhaft Besinnlichen, der Erhobenheit über den Alltag, des Absonderlichen sogar, auf. Wie Hans Thoma glaubt, ist seine Vatersippe ursprünglich aus Tirol zugewandert. Als Holzhauer kamen die Männer auf den Wald, als Hirtenbuben die Knaben. Mancher blieb seßhaft. Ein tüchtiger Volksschlag vermischte sein verwandtes Blut und seine sprichwörtlich stolze Seele mit dem kraftvoll ansässigen Volke. Die Thoma-Familie hatte es zum Wohlstand gebracht, im Verein mit einem großzügigen Wesen und einem Schuß Selbstherrlichkeit zeigte sich jedoch der Wohlstand nicht sehr haltbar. Vom Großvater Hans Thomas erzählt man sich, er habe, es dem Fürstabt von St. Blasien gleichzutun, an einer Kirchweih vom Wagen herab Geld unter die Leute geworfen. Diese und ähnliche Großmannstaten einer übermütigen Seele hält ein Bauerngeldbeutel freilich nicht lange aus. Und so wurde der Vater Hans Thomas wohl Müller, aber eine Mühle konnte er nicht besitzen. Hans Thoma hat ihn als einen ernsten, stillen Mann in Erinnerung. Er ging heim, als Hans fünfzehn Jahre alt war, wahrscheinlich aufgerieben vom harten Lebenskampf. Einige Zeit vor ihm starb der Sohn Hilarius, am Tage als man ihn zum Hauptlehrer in einer Dorfgemeinde ernannt hatte. Hilarius war der Stolz der Familie gewesen; er dichtete und besaß auch Zeichentalent. Da er viel älter war als sein Bruder Johannes, unterwies er ihn früh. Sein Tod nach langem Siechtum brachte die Familie in große Trauer und fast ins Elend. Neigung zu geistbeseeltem Tun und Sinnen hatten ganz besonders die vielen Geschwister der Mutter. Die Brüder vorab, diese merkwürdigen Männer, die würdig wären, in einer Geistesgeschichte des bäuerlichen Volkes verewigt zu werden. Diese Oheime hat Hans Thoma in ihrer Eigenart in seinem Erinnerungsbuch vortrefflich geschildert, besonders ihre religiösen Auseinandersetzungen. Die [357] Sippe der Mutter war stark musikalisch begabt, sie stellte die gute Dorfmusik bei den Festen, selbst die Schwestern mußten mitmachen, als der Vater noch lebte. Die Brüder erwarben als Uhrenmacher und Orgelbauer, als Uhrenschildmaler und Truhenmaler, als Hinterglasmaler und Verfertiger gemalter Wallfahrtsandenken ihr Brot, ja einer brachte sogar eine kleine Laienspielgruppe zusammen, weil er auf das Theaterspielen ganz närrisch war. Es war der Bruder Ludwig, der auch nach echter Schwarzwälder Art an Erfindungen bastelte, ein Weltsystem verfertigte, das mit allerlei Spitzfindigkeiten den Lauf der Gestirne, Sonnen- und Mondfinsternisse darstellen konnte. Da Hans Thoma als Kind viel bei den Oheimen saß, fiel manches Erlebnis in seine Seele, das als Bereitschaft zu fruchtbaren Handlungen und Gedanken des gereiften Künstlers sich aufbewahrte. Im ganzen verliefen Kindheit und Jugendzeit Hans Thomas in reicher Fülle, obschon er eigentlich armer Leute Kind war. Für diesen glücklichen Kinderhimmel ist zum größten Teil der Mutter zu danken, dieser in Schlichtheit gekleideten, wahrhaft großen Frau. Man rühmt die Mutter Goethes, die Frau Rat. Die Mutter Hans Thomas verdiente es in gleicher Weise, über das Grab hinaus geehrt zu werden. Sie hat dafür, daß sie nie den Glauben an des Sohnes Kunst verlor und harte Opfer brachte, um ihm den Weg zur künstlerischen Ausbildung zu ermöglichen, bei ihm bleiben dürfen, bis er selbst schon graue Haare hatte und sein sechzigstes Jahr überschritt. Bernau, die Heimat, hat sie um seinetwillen verlassen und ist nach Frankfurt gezogen in die Stadt mit der Tochter Agathe. Zwei bäuerliche Frauen blieben sie, nicht von plumper, linkischer Art etwa, ihr Gesicht und ihre Würde heischte selbst im vornehmen Gesellschaftskreise, der sich, als Hans Thoma berühmt zu werden begann, um ihn scharte, Erstaunen und Hochachtung. Die beiden Frauen gaben sich natürlich wie in ihrer Waldheimat, mit der Zurückhaltung, die den Schwarzwälder Bauern adelt, und der Selbstbewußtheit, die ihn sich einordnen läßt, ohne unsicher zu werden, in jedem Kreise, wo er achtbare Menschen spürt. Die natürliche Bildung des Geistes und des Herzens blieb diesen treuen Frauen – die Mutter legte auch die Bernauer Tracht nicht ab – bewahrt. Obschon sie davon nicht sprachen, wie der Wald, die freie Luft der Heimat ihnen fehlte, hatten sie das Wesen dieser Heimat in sich, es verlor sich nicht. Es blieb auch um Hans Thoma als die unverletzliche Hülle seiner Seele, jener dem Kosmischen wie dem Mythischen eingeborenen Seele, die aus seinen Bildern spricht. Es sind eigene Bilder, mit keines Anderen Kunstwerk zu verwechseln. Weltanschauung deutschen Ingefühls und Weltsinn von schöpferischer Weite, der alle Dinge als Gottes Vielfalt begriff, lenkten seine Kunst. Wie ist nun all das Große und Zeitlose in das Gefäß des kleinen Bauernbuben hineingekommen?
So alt war nun Hans Thoma noch nicht, als er gebückt über dem Arbeitstisch hockte, um Schriften zu zeichnen, daß er diesen Zauber und diese Macht der Stadt voll begriffen hätte. Er fühlte sich krank, Heimweh nach Bernau und allgemeine körperliche Zartheit machten ihn müde. Trotzdem besuchte er die reiche Gemäldegalerie der Stadt und stand vor den Werken deutscher Meister, bewunderte Holbein und Dürer, die oberrheinischen Künstler wie die Niederländer und ließ in seinem aufgehenden Herzen den Wunsch erblühen, auch einmal ein Künstler zu werden wie diese; aber sonst war er verloren in der Fremde. Seinem großäugigen Blick begegneten keine Freundesaugen. Er war ein gläubiges Bauernkind, das sich unter den gewitzten Stadtlehrlingen nicht wohl fühlte. Als er einmal so still dahinging, traf ihn eine Tante, die fand, daß er krank sei. Sie erzählte den Bernauer Eltern, der Johannes habe bereits einen ganz jenseitigen Blick. Inzwischen war der Hans schon seinem Lehrmeister aus der Obhut entwichen, da er an Schmerzen auf der Brust litt. Er erholte sich wieder in der Heimat, mußte tüchtig arbeiten auf dem Acker und im Wald. Er ging vor allem mit dem Vater ins [359] Holz. Vogelbeerbaum und Ahorn boten Hölzer, die der Oheim Ludwig, der Bastler, zum Spulendrehen brauchte. Viele Bernauer leben von der Holzschneflerei. Sie besitzen, wie alle Schwarzwälder, große Handfertigkeit in der Schnitzerei. Das Holz wächst ihnen ja zu, die Winter sind lang, die Abende still und einsam in den zerstreuten Gehöften und Gütlein, und so kamen früher die Burschen und Männer zusammen in einer großen Stube, schnefelten und schnitzten allerlei kleinen Hausrat; mitunter wuchs auch einem eine Heiligenfigur, eine Uhrenfigur aus der Hand. Ein einfacher, schöpferischer Sinn ist diesen Schwarzwäldern eigen, dem die schönsten Dinge entwuchsen, die wir dem Bereiche der Volkskunst zuzählen. Bei den Mannen in der Stube saßen die "Wiibervölker", die Frauen und Mädchen. Sie spannen Hanf oder Schafwolle oder strickten. Dabei wurden die überlieferten Lieder gesungen, auch dazu gespielt; denn die Schwarzwälder sind ein musikfreudiges Volk, sie haben die Spieluhren erfunden, sogar der Geigenbau wurde ausgeübt. Alte Mären und Sagen, scherzhafte Geschichten von lustigen Trunkenbolden und Sonderlingen gingen von Mund zu Mund. Wo die Leute in solchen Gemeinschaften beisammensitzen, bleibt auch das Brauchtum wach. All diese tiefen Züge reiner Volksbildung, aus Blut und Boden natürlich gewachsen, prägten sich in die empfindliche Kinderseele Hans Thomas besonders ein. Sein aufgeweckter Geist und seine rege Vorstellungskraft wurden mit unvergänglichem Wissen genährt. Vor allem steckte die Mutter voller Erzählungen und Vorstellungen. Fromm und klug trug sie, was sie wußte und in ihrem mit Sorgen gesegneten Leben erfuhr, in die Seelen ihrer Kinder Hans und Agathe ein, mit heißer Inbrunst besonders dann, als der Vater sie für immer mit den Unmündigen allein lassen mußte. Es war ja für die Eltern eine große Enttäuschung gewesen, als ihr hoffnungsvoller Hans die Lehre bei dem guten Lithographenmeister verlassen mußte. Der Bub war ein wenig verzärtelt. Er hatte wohl wie andere Dorfkinder auch Schulstreiche und Balgereien, übermütige Taten verübt, aber er gab nie ernstlich Anlaß zu Strafe und Vermahnung, eher zu Lob und Verwunderung. Da hat ihn das Auge der Liebe wärmer umhüllt, als dies gemeiniglich in den auf rauhen Ton gestimmten Bauernfamilien üblich ist. Das Leben in der Fremde hat dann nicht einmal rauhe Herzlichkeit mehr, es ist scharfäugig und kühl. Und da hat ein Bub mit klarer Menschen-, Wald- und Tierliebe in den Augen es schwer. Die Eltern gaben jedoch nicht klein bei. Der Johannes sollte etwas werden, der Hilarius hatte auch hinaus in die Fremde gehen und das Heimweh überwinden müssen. So nahm ihn die energische Mutter abermals an der Hand und führte ihn nach Basel in eine neue Lehre, zu einem Malermeister. Obschon der Abschied schwer war, blieben Hans Thoma doch bis ins hohe Alter die Bilder bewahrt, die er unterwegs gesehen. Sie mußten durch manches Bachtal und durch manche Ortschaft wandern, [360] bis sie Basel erreichten. Das von Hebel unsterblich besungene Tal der Wiese gewann Thoma besonders lieb. Die Landschaft sah er eigentlich schon in zarter Jugend als Bild vor sich, immer mit einem Zucken in den Händen und einem Wunsch im Herzen, dies malen zu dürfen. Die ernsten Erlebnisse in der Familie durch den Tod des Bruders und die Armut hatten ihn früh reif gemacht, obschon sein Wesen kindlich gläubig blieb. Als er in die Flegeljahre kam, mußte er seine Füße unter fremde Tische strecken; das Heimweh und die Wunschkraft, Künstler zu werden, haben ihm nicht Raum gelassen, seine Seele von allerlei wirren Einflüssen wilder Kameraden, die nicht Fisch noch Fleisch waren, nicht Knabe mehr noch Mann, aufregen zu lassen. Er war für die Lehrlinge, mit denen er in Basel zusammentraf, ein Sonderling; sie hänselten ihn und ließen ihn seine Wege gehen. Die Herrlichkeit bei dem neuen Lehrherrn dauerte wieder nicht lange. Thoma hatte den Vater verloren, das ging ihm nahe. Dazu tobte in Basel die böse Cholera und raffte viele Leute aus dem Leben. Auch konnte Thoma sich mit dem Handwerk nicht befreunden. Er brachte jede Freizeit in den Gemäldesälen zu und sehnte sich hemmungslos nach "seinem" Berufe. Er wurde, da er keinen Weg sah, sich auszubilden, ganz schwermütig, er bekam Todesgedanken; aber seine reine Lebenskraft regte sich zu rechter Zeit. Er sagte dem Meister offen, wonach er Verlangen trage, was er eigentlich werden wolle. Der ließ ihn lächelnd gehen, dieser Lehrling hatte ohnedies zu feine Hände für das Anstreichergeschäft. Hans Thoma wanderte auf dem gleichen Weg nach Hause, den Johann Peter Hebel als Vierzehnjähriger mit seiner sterbenden Mutter auf einem ratternden Bauernwagen von Basel nach Hausen im Wiesental gefahren war. Nicht weit von Lörrach, zu Füßen des Rötteler Schlosses, des alten Sitzes der badischen Markgrafen, an dem die sinnenden Augen des Knaben hingen, starb dem Hanspeter Hebel die Mutter weg. Er war nun Waisenkind. Hans Thoma erging es nicht so schmerzlich auf seinem eigenwilligen Weg in die Heimat; er sah auf einmal, wie im Traum, als er in die Nähe Lörrachs kam und wohl auch mit träumendem Auge die Ruinen der starken Burg umschweift hatte, von Haagen her eine Bauersfrau rasch daher wusseln, und siehe: es war die Mutter, quicklebendig, froh, den Sohn gesund zu sehen. Das Bangen um ihn wegen der Cholera hatte sie auf den weiten Weg getrieben. Zwölf Stunden mußte man damals hinter sich bringen von Bernau bis Basel. Es blieb nahezu symbolisch für alle entscheidenden Stunden im Leben Hans Thomas: die Mutter kam ihm auf dem Weg entgegen, von liebender Ahnung getrieben. Wieder in Bernau, von manchen Nachbarn und Verwandten schief angesehen, weil aus dem Hans "scheint's" nichts werden wollte, machte er sich nützlich, wo er konnte. Er hätte sich in den "Erdsgrundsbode" hineingeschämt, wenn ihn jemand Tagdieb oder Faulenzer gescholten hätte. Es war ihm keine Taglöhnerei zu viel, nur ein wenig freie Zeit zum Malen wollte er haben. Er kaufte sich in Freiburg [361] Farben und Malzeug, er zeichnete und malte mit heißem Bemühen und erstaunlichem Gelingen kleine Landschaftsausschnitte, Blumen, Hühner und Katzen, Bildnisse von Base und Vetter, Bauerngärten und Familien vor dem Hause und Ansichten von St. Blasien. In St. Blasien, das damals schon Kurort war, konnte er glückhaft einige Bildchen absetzen. Sein Mut wuchs, seine Hoffnung wurde stark. Er ging auch eine Zeitlang in die alte Glasfabrik Äule und bemalte Bauerngläser und Schnapsgütterle mit Blumen und Sprüchen. Ein paar kurze Unterbrechungen erfuhr das zufriedene Wachstum in Bernau trotzdem. Er versuchte eine dritte Lehre bei dem auf dem ganzen Wald berühmten Uhrenschildmaler Laule in der Uhrenstadt Furtwangen. Es gefiel ihm dort gut. Er hätte vielleicht durchgehalten, denn Laule besaß ein richtiges Maleratelier und war ein Künstler in seinem Fach. Dort lernte Thoma vor allem die Grundlagen der Ölmalerei; aber nun fehlte es am Lehrgeld. Die Mutter brachte es nicht auf. Hans kehrte nach Bernau zurück. Sie machten auch den Versuch, ihn in Freiburg im Konvikt unterzubringen, wo er katholischer Pfarrer hätte werden können. Hans Thoma hat sich manchmal später in besinnlichen Gesprächen mit Freunden darüber geäußert, wie doch ums Haar er womöglich Pfarrherr in Bernau geworden wäre. Er glaubte nicht, daß er in diesem hohen Berufe unglücklich geworden wäre. Man kann das nicht wissen, jedenfalls hat eine tiefe Religiosität alle Thomas beherrscht, sie waren sogar zu theologischer Leidenschaft fähig. Ihr Gottsuchertum hat viele Glieder der Familie vom katholischen Bekenntnis zum protestantischen hinübergezogen. Die Mutter und Hans Thoma selbst gehörten dazu. Was für tiefe innere Gründe sie, die unbedingt Getreuen, zu diesem Wechsel der religiösen Anschauung trieb, soll hier nicht angerührt werden. Es war weder sektenhafte Abtrünnigkeit noch irgendeine menschliche Enttäuschung dabei im Spiele. Hans Thoma selber ist weltanschaulich später noch weiter gegangen, er ist deutschgläubig geworden, wir würden heute sagen, ein deutscher Christ, obschon dies nicht ganz klar ihn deutet. Seine Weltanschauung spricht ihre reinste Sprache in seiner Kunst, in seinem Malwerk. Die Jahre gingen hin. In Bernaudorf hatte der Lehrer Ruska eine Zeichenschule für begabte Bernauer errichtet, und Hans Thoma besuchte sie. Es zeigte sich auch die Aussicht, daß er Ratschreiber hätte werden können. Um alles in der Welt wollte ihn die Mutter versorgt sehen, denn es sah doch wirklich so aus, als gäbe es keinen Weg für den eigenwilligen und dabei doch so willigen Johannes, um ein richtiger Malkünstler zu werden. Insgeheim suchten sie freilich beide nach einem verborgenen Weg, der sich wie ein Wunder ihrer großen Gläubigkeit auftun mußte. Das Wunder geschah dann auch. Schon längst war einigen St.-Blasier Herren der begabte Bernauer aufgefallen. Die Mutter, die fleißig auf Verdienst aus war, Botengänge machte und Marktgänge, kam mit vielen Leuten in Berührung. Sie war eine Frau, die man trotz ihrer bescheidenen Gestalt nicht übersah. Aus ihren [362] Augen leuchtete eine bannende Tiefe, alle Kameraden Hans Thomas, die die Mutter kennenlernten, sprachen darüber. Noch im hohen Alter trübte sich ihr Blick nicht. Diese Mutter schwieg sich nicht aus über des Sohnes Können und Wollen. Mit großer Würde und Eindringlichkeit machte sie sich zur Sachwalterin ihres Sohnes. Er litt im stillen, ohne ein Wort darüber zu verlieren, daß man von ihm denken könne, er verlasse sich auf die Mutter, die sich für ihn abplage. Er ging heimlich an seine Malplätze, zeichnete fleißig Bäume ab und Blumen, Steine im Bach, Quellwasser und Findlinge, alte Mühlen. Die Mutter zeigte die Blätter herum. Der Apotheker und der Oberamtmann von St. Blasien beschlossen schließlich, vollkommen überzeugt von dem Talent, sich mit Proben der Zeichen- und Malkunst Hans Thomas an den Großherzog zu wenden, um eine Freistelle in Karlsruhe an der Akademie zu erwirken. Die Tat war von Erfolg gekrönt. Der damalige Galeriedirektor Schirmer erkannte, daß hier nicht nur hohe Begabung, sondern ein bereits zur Reife strebendes Können vorlag. Am 29. September 1859, abends um sechs Uhr, betrat der Schwarzwälder mit seiner Habe und seinem tüchtigen Bündel Zeichnungen und Malstücken zum erstenmal die Haupt- und Residenzstadt Badens, diese junge, erst 1715 durch den Markgrafen Karl Wilhelm gegründete Stadt. Bisher hatten alle jungen Talente im badischen Lande die Kunstschulen in Düsseldorf oder in München besuchen müssen oder gar die in Paris. Die Düsseldorfer Schule war besonders von Malern besucht, während man in München eher die zeichnerische Überlieferung hochhielt. An der Karlsruher Schule sollte sich Eigenart mit Vielseitigkeit vereinigen. Als sie der Großherzog Friedrich I. im Jahre 1854 eröffnete, freilich noch in unzulänglichen Räumen und mit wenig Lehrmitteln, war er sich sofort klar darüber, daß nur erste Lehrkräfte in Frage kämen. Er wollte keine Winkelakademie ihr Dasein fristen sehen. So berief er den damals schon hoch angesehenen Landschaftsmaler Schirmer, einen Düsseldorfer Meister, als Leiter der Schule nach Karlsruhe und überließ es ihm, andere Lehrkräfte zu ernennen. Schirmer berief Des Coudres für die Malklasse und den Historienmaler und Landschafter Lessing, später kam dann noch Adolf Schroedter, ein großer Zeichenkünstler, dazu. Dieses Viergestirn bedeutender Künstler mit hoher Eigenart und deutscher Prägung gab sofort der Neugründung einen leuchtenden Rahmen. Johann Wilhelm Schirmer (1807–1863) war zu seiner Zeit der bedeutendste Landschaftsmaler, dazu eine kraftvolle Persönlichkeit. Er gilt als der Begründer der deutschen Landschaftsmalerei. Dies zu betonen ist nötig, weil er einen neuen Geist in das ausgefahrene Geleise der Malerei in klassischem Stil und mit klassischen Motiven brachte. Er wurde in Karlsruhe gleich mit einer hochbegabten Schülergefolgschaft beglückt: Hans Thoma, Emil Lugo, Eugen Bracht, Arnold Böcklin gehören dazu. Der Geschichtsschreiber der badischen Malerei, J. A. Beringer, meint, es habe in der Karlsruher Schule ein protestantischer Geist geherrscht, ein [363] kämpferischer Geist, den vor allem Karl Friedrich Lessing, der gewandte Künstler, Denker und Kritiker, noch verstärkte. Kraftvolle, der verwischenden und übertriebenen Romantik entgegenstrebende Art war all diesen durch Schirmer berufenen Lehrern eigen; sie lehnten den Idealismus keineswegs ab, jedoch mußte er die Grundlage der Wahrheit haben. Jegliche weichliche und kleinliche Haltung war verpönt. Unter dieser ins Große und Ganze zielenden, schöpferischen Führerschaft gewann die junge Akademie rasch ihr eigenes Gesicht, sie blieb eine hohe Schule der eigengeprägten deutschen Landschaftsmalerei bis heute.
Thoma ist in den Studienjahren stets im Sommer daheim gewesen, im Winter in Karlsruhe. Lugo und Bracht zogen manchmal mit ihm in die unberührte Naturlandschaft Bernaus. Hans Thoma kehrte jedesmal mit prall gefüllten Zeichenmappen und vielen Ölstudien nach Karlsruhe zurück und erntete das Lob seiner Lehrer. Es gab freilich auch schon Stimmen gegen ihn. Er war für jene Zeit befremdlich naturverbunden in seiner Malerei wie in seiner Stoffwahl. Er hatte keine bunten Farben, die sind dem Schwarzwald fremd, er sah Verhaltenheit des Brauns und Grüns und das himmlische Blau mit viel Zurückhaltung gebunden. Dafür schmähte man ihn später sehr. Wegen seines Grüns spottete man und nannte einen bestimmten Salat Thoma-Salat. Der Kampf gegen ihn begann früh. [364] Er ist heute noch nicht verstummt. Kampf stählt. Thoma kämpfte nicht mit theoretischer Redseligkeit, er kämpfte mit der blanken Waffe seines Könnens, unentwegt, unbeirrt, fleißig und hochgemut. Arnold Böcklin hat später in München mit ihm viele Spaziergänge gemacht; die beiden Alemannen verstanden sich gut, und der leidenschaftliche Farbenfreund Böcklin hat Thoma viel farbige Erkenntnisse vermittelt. Thoma war bei allen Gesprächen über Kunst mehr mit Besinnlichkeit und Bereitschaft zu lernen, beteiligt als mit draufgängerischem Besserwissen. Er wußte, was er wollte, dem hemmte kein Zaudern, kein Zweifel den Weg. Seine Richtung war klar von Anfang an; er war kein Schauspieler, kein geistreiches Genie, kein weitläufig in allen Sätteln geübter Kunstkenner. Dieses Wissen kam im Lauf der Jahre schier von selber an ihn heran. Er nahm auf, was ihm wert schien zu wissen; er war ein selbstsicherer Mensch und hatte keine große Achtung vor sogenannten Malerfürsten und Dichterfürsten. Sein Urteil war unbestechlich, aber er nützte seine Erkenntnisse nie zu böser Nachrede aus. Wer Hans Thoma ganz deutlich kennenlernen will, muß seine Briefe lesen. Er war ein lebhafter und eifriger Briefschreiber. Wie viele Briefe gingen doch nach Bernau zu Mutter und Schwester, und wie ein Dokument gelebten Lebens von reiner, unverlogener Menschlichkeit muten die drei Jahrzehnte umfassenden Briefe an Henry Thode an, den Schwiegersohn der großen Frau von Bayreuth, Cosima Wagner, mit der ihn das freundschaftlich-vertraute Du verband. Heim schrieb er stets Botschaft und Bericht voll Zuversicht und Hoffnung und in jenem heiteren Ausdruck, der in sich gefestigten Menschen eigen ist. Hans Thoma war gut geartet, ein Schuß leichten Sinnes fehlte ihm nicht, er übte Selbstzucht ohne Verbissenheit und Aufwand. "Das mueß sii" (das muß sein), sagte er sich heimlich und zwang, was gegen ihn war, mit geradezu bäuerlicher Unbekümmertheit. Er hatte auch Glück. Die Karlsruher Zeit (1859–1867) verflog, er hatte getreulich die lange Lehrzeit hinter sich gebracht. Er sah ein, daß jetzt die Zeit der Wanderschaft für ihn beginnen müsse. Jeder rechte Meister muß auf der Walz gewesen sein. Die Verhältnisse waren ohnedies für ihn reif geworden zum Scheiden. Sein großer Lehrer Schirmer war plötzlich gestorben, im Jahre 1863. Hans Thoma fühlte sich seither verwaist. Ein Wiener Maler, der sich Hans Canon nannte, war wie ein Komet in Karlsruhe aufgetaucht, ein unruhiger Feuerkopf, der vor allem junge Menschen in seinen Bann zog, weil er ein Erfinder in handwerklichen Mitteln der Malerei war. Von ihm lernte Hans Thoma die Lasurtechnik. Canon hatte besonders an Thoma den Narren gefressen, doch warnte man den Vertrauensseligen vor dem heißblütigen, abenteuerlichen Genie. Thoma wäre jedoch gerne in dessen Schule gegangen, er gehörte ja nicht zu den Leuten, die sich verführen lassen, aber auf das Lernen war er allezeit versessen. Er hat es später sogar bereut, sich nicht stärker an Canon angeschlossen zu haben. [365] Er kam indessen in den Jahren 1863 und 1864 doch in eine Sturm- und Drang-Zeit; er erzählte selber, daß er in einem Zustand "von Verwilderung und Sentimentalität" die letzte Karlsruher Studienzeit zubrachte. Er hörte ein von dem damals noch heiß bekämpften Richard Wagner selbst geführtes Konzert und war begeistert von der Musik und ihrem Schöpfer. Das war die erste Begegnung mit Wagner, mit dessen Familie Hans Thoma später die wärmste Freundschaft verband. Zu Musik und Dichtung zog es den unverbrauchten Bernauer zeitlebens hin. Er las die deutschen Dichtungen alle, er hatte stets ein gutes Buch bei sich. Mit jungen Musikern verband ihn frohe Kameradschaft, die nicht selten in tollen Schlendrian ausartete. Hans Thoma war zu gesund, zu lebfrisch, um ein Mucker zu sein.
Obschon der junge Künstler dann und wann ein Bild verkaufen konnte, verdiente er doch knapp das Salz an der Suppe. Er gab Zeichenstunden und hoffte eine Zeitlang, Zeichenlehrer in Basel werden zu können. Das zerschlug sich wieder. Er lebte eine Weile in Basel, wurde ruhelos und auch ein wenig ratlos und reiste eines Tages nach Düsseldorf (1867 bis 1868) mit Empfehlungen der Karlsruher Lehrer und kleiner Geldhilfe von seinem treuen Lebensfreund Schumm in Basel. Die Düsseldorfer Malerei jedoch enttäuschte ihn, er machte daraus kein Hehl. Obschon er im "Malkasten", der Vereinigung der Düsseldorfer Künstler, übermütige Stunden verlebte und der Jugendlust keinen Zwang antat, wurde er nicht warm. Auch kam die Armut hart über ihn, er ging mit zerrissenen Schuhen einher und später, noch in seiner wohlständigen Zeit, träumte es ihm oft von den zerrissen Stiefeln, auf denen alle ehrenwerten Düsseldorfer Spaziergänger ihre Augen mißbilligend ruhen ließen. Die Schatten der Not machten ihn auch seelisch mürb; dazu wußte er, wie ärmlich sich Mutter und Schwester durchschlugen, und es schien ihm auch, als wende sich das Glück von ihm ab. Die Stimmen gegen seine Malweise mehrten sich, teilweise wurden sie auffallend böse. Er war in jener Zeit viel empfindlicher gegen Kränkungen, als er je gewesen. Da riß ihn ein neugewonnener Freund aus der Ratlosigkeit des Alltags. Der Maler Otto Scholderer nahm ihn mit nach Paris. Er führte Thoma in das Atelier des ebenso berühmten wie bekämpften Malers Courbet, und hier fand Thoma sich selber wieder. Es bestand eine fühlbare Verwandtschaft zwischen Courbets künstlerischer Haltung und der Hans Thomas. Er schreibt über seinen Eindruck von Courbets Bildern: "Das war etwas Ganzes, war für mich die Malerei. Die Sachen wurden mir so klar, als ob sie meine eigenen Sachen wären. Nun glaubte ich, meine Bilder malen zu können."
Ein Glück, daß er doch immer wieder ein Bild verkaufen konnte und sich so über Wasser zu halten vermochte. Es sind damals tatsächlich einige der besten Bilder Thomas überhaupt entstanden. Er konnte, gottlob, das Bild der Schwester Agathe mit Nähkorb und Blumenstrauß später wiederzurückkaufen und es der Thoma-Galerie in Karlsruhe erhalten. Immer wieder ging die Reise zwischen Säckingen, Bernau und Karlsruhe hin und her. Aufträge gab es, aber davon leben ließ sich nicht. Der Siebziger Krieg brach aus, während er in Säckingen weilte, wo die Seinen jetzt wohnten. Er wurde nicht eingezogen. Im November 1870 reiste er nach München, traf dort den Schweizer und Freund Stäbli und Arnold Böcklin an und war gespannt, wie es ihm ergehen würde. Sein erster Weg war in die Pinakothek zu den Werken der Altdeutschen. Man riet ihm, sich der Pilotyschule anzuschließen, aber die Bilder des Schlachtenmalers machten ihm keinen Eindruck. Er geriet in den geistbeseelten Kreis um den Maler Viktor Müller, den Schwager Otto Scholderers. 1871 verlebte Thoma den Sommer wieder in Bernau, malte unter anderem eine "Große Landschaft mit Ziegenherde", die heute in der Nationalgalerie in Berlin hängt. Er ist bereits ein Meister geworden. Er ist ja jetzt auch zweiunddreißig Jahre alt, immer noch für die Mutter, die er immer und immer wieder malt, der "Bub". In München gehörte er zu dem Kreis der eigenwilligen Maler, die nach dem Ausspruch ihres Gönners, des Konservators der Alten Pinakothek Dr. Bayers- [367] dorfer, "unverkäufliche Bilder" malten. Zu ihnen zählten auch Wilhelm Leibl und Karl Haider. Thomas Tee, der Engländer, kaufte unentwegt Thoma-Bilder, obschon es hieß: "Maler Klecks hat wieder ausgestellt", oder: "Streich Kästen an und Schrein, doch das Malen, das laß sein". Wenn Thoma zwei, drei gute Freunde um sich hatte, konnte die Welt aus den Fugen gehen, er blieb an Leib und Seele heil, er ließ das Malen nicht sein. Da war Viktor Müller, die geistige Führernatur, da war Sattler, der Hans Thoma einmal eine Nacht lang in ungeheizter Bude mit Schopenhauer bekannt machte, worauf Thoma, von Frost geschüttelt, ein paar Tage bettlägerig wurde. Als er danach matt sich auf den Weg zu Müller machte, rüstete der sich unerwartet zum Sterben. Das schlug ihn so hart wie der Tod Schirmers. Trotz aller Anfeindung mehrte sich der Freundeskreis um Thoma; er kam freundschaftlich mit Martin Greif, dem Dichter, mit den Malern Trübner, Steinhausen und Arnold Böcklin zusammen. Im Jahre 1872 malte er den berühmten "Kinderreigen".
Es tritt wiederum ein Mann in sein Leben, der seinen äußeren Weg entscheidend beeinflußt. Dr. Otto Eifer aus Frankfurt besuchte ihn in München, von Frau Viktor Müller geschickt. Es entwickelte sich eine Freundschaft zwischen den Männern, und Hans Thoma machte einen Versuch mit Frankfurt. Frankfurt sollte für ihn die Stätte seiner reichsten Schaffenszeit und seines schönsten menschlichen Glückes werden. Zunächst machte er mit dem bekannten Maler Albert Lang die erste seiner Italienfahrten (1874). Emil Lugo, mit dem er sich getroffen hatte, konnte ihm auch nicht eindringlich genug zur Fahrt ins Gelobte Land der Künstler raten. Er brach die Zelte in München ab, ließ seine Sachen nach Säckingen schicken und hatte eigentlich vor, mit den Seinen sich fest in Frankfurt, nach dem Rate Eifers, niederzulassen. Zwar hatte er ziemlich gut einige Bilder verkauft; sein Vermögen betrug [368] tausend Gulden, aber Zukunftssorgen bannte das nicht. Die hat sich Hans Thoma immer gemacht, selbst dann, als es gar nicht mehr nötig war; das Sorgen war ihm in Fleisch und Blut übergegangen.
Italien ergriff ihn mächtig, er war ja so hungrig nach Erlebnissen und so unverdorben im Genießen. Hans Thoma ist wohl ein halbes dutzendmal in Italien gewesen. Stets hat ihn Jahre hindurch im Frühling die Sehnsucht nach dem reichen Süden ergriffen. Ein paarmal nahm er Cella mit, seine leidenschaftlich geliebte Frau. Er hatte Cella als Siebzehnjährige in München kennengelernt. Sie wurde seine Malschülerin, deren großes Talent wie eine wunderbare Blüte sich durch die Liebe voll erschloß. Sie stammte aus Landshut in Bayern aus bäuerlicher Familie. Eine überaus glückliche, fünfundzwanzig Jahre währende Ehe vereinigte das Künstlerpaar gerade in der stillsten, wertvollsten Schaffenszeit Hans Thomas, die er in Frankfurt verlebte. Er entschloß sich im Frühjahr 1877 zur Heirat und zu einem festen Wohnsitz in Frankfurt. Seiner unruhigen Wanderjahre schien es ihm nun genug.
In Säckingen ließ er sich mit Cella Berteneder trauen, dann vereinigte sich die Familie mit der Mutter und der Schwester Agathe in seinem schönen Frankfurter Heim am Hochhausenpark. Sie blieben beisammen, bis der Tod sie trennte. Erst nahm er die Mutter weg, die im Alter von vierundneunzig Jahren starb, dann 1901 rasch und mitten im Lebenssommer, dreiundvierzigjährig, die heitere, schöne Frau Cella, zwei Jahrzehnte später erst, am 7. November 1924 den Meister selber und wenige Jährchen danach die hochbetagte treue Schwester Agathe. In die Frankfurter Zeit fällt Hans Thomas Begegnung mit Henry Thode, der damals Direktor des Staedelschen Instituts war. Dr. Henry Thode war mit Daniela von Bülow verheiratet, der Tochter Cosima Wagners. Es ist auch Thodes starkem, fast schwärmerischem Einsatz für Hans Thomas Kunst zuzuschreiben, daß man nicht zu spät zur Erkenntnis kam, was für ein großer deutscher Maler in aller Stille und mit ungebrochener Kraft Bild um Bild schuf. Thode, bei seinem ersten Atelierbesuch überwältigt von dem Reichtum und der künstlerischen Vielfalt des Malers, dem er zunächst mit Mißtrauen begegnet war, weil er zu viel Abschätziges über seine Kunst gehört hatte, kämpfte mit leidenschaftlicher Beredsamkeit für Thomas volle künstlerische Anerkennung. In Frankfurt hatte sich ein Kreis unbestechlicher Thoma-Freunde gebildet, die auch durch Bildkäufe ihm das Leben zu erleichtern suchten; denn die Familie war groß, eine Pflegetochter kam noch hinzu. Trotzdem traten Sorge und Not immer wieder auf die Schwelle des Künstlerheimes. Zwei Engländer, Minoprio und von Sobbe, kauften Bilder und führten sie nach England aus. Hans Thoma ist 1879 ihrer Einladung nach England gefolgt. Er reist überhaupt nicht viel weniger als in den Wanderjahren; er wird immer wieder durch Freunde aus seiner Verborgenheit gezogen und so doch einer wach- [369] senden Trauer entrissen, die ihn befallen mußte nach soviel Zurücksetzung und Ungerechtigkeit, die er von seiten voreingenommener "Fachleute" erfuhr. Emil Lugo, Eugen Bracht, Otto Scholderer blieb er fürs Leben verbunden. Gerade die Frankfurter Zeit hat mit ihrer Schaffensstille und Besinnung auf sich selber und der Erkenntnis der ewigen, der kosmischen Dinge ihm viele Freunde zugeführt. Einer sagte es dem andern, daß da in der Wolfgangstraße, wohin er später zog, ein starker Genius hause, ein merkwürdiger, klarer Mensch. So wurde Thoma mit Langbehn befreundet, dem Rembrandtdeutschen. Ein reger Briefwechsel ist uns erhalten geblieben, der zeigt, wie tief der Maler auch zu denken verstand, das heißt wie tief er mit den großen, auffallend schönen Augen nach innen zu schauen verstand. Er hat seine natürliche Geistesbildung durch Lesen philosophischer und kunstwissenschaftlicher Bücher bereichert, aber nur das aufgenommen, was er voll begreifen und erlebnishaft besitzen konnte. Wissen ging bei ihm ins Lebendige ein. Er war kühn im Urteil und besaß eine erfrischende Ausdrucksgewalt in seiner unbekümmerten Sprache. Er blieb ein fleißiger Briefschreiber. Nirgends kommt seine Lauterkeit und seine männlich kluge Haltung reiner zum Vorschein als in dieser Fülle von Briefen an Frauen, an Gelehrte, an Künstler aller Art. Allein der Briefwechsel mit Henry Thode umschließt lückenlos dreißig Jahre. Das Leben Hans Thomas ist eigentlich klar und einfach verlaufen, es hat keine Geheimnisse für Krämer, es war nie eng. In einem englebigen Haus hätten sich ganz gewiß so großzügige Geister wie Thode und Cosima Wagner, Chamberlain, Langbehn, Liliencron, große Schauspieler und Sänger, Gelehrte und Fürsten in Freundschaften, die meist ein Lebensalter dauerten, nicht so wohlfühlen können.
Er schreibt an die Freunde über seine Art, zu malen; es kann ihm jeder in die Werkstatt gucken. Es verbirgt sich dort keine Hexerei, und nichts wird ihm vorgemacht, er sieht dort nur heißes Bemühen, frohes Gelingen, mutiges Versuchen und starkes Schöpfen.
Im Juli 1888 schreibt er an Langbehn: "Meine Malerei ist für mich Raum und Gegenwart. – Die Bilder werden weiter aufgeschichtet. Es ist doch auch ein schönes Gefühl, für niemand zu malen." An Emil Lugo: "...War ich doch der ersten einer, der vor fünfzehn Jahren schon Landschaften gemalt hat, die sich wirklich im Freien befunden haben."
Aber dann erhält Dr. Eifer am 22. Mai 1890 einen jubelnden Brief, der Bann ist gebrochen: "Meine Ausstellung in München ist ein vollständiger Sieg! Acht Bilder sind bis heute verkauft." Es war höchste Zeit, das Leben wollte tagtäglich mit leiblicher Nahrung erhalten sein, der Meister war auf klingenden Lohn für sein Werk angewiesen. Vom Bildaufschichten wird das Brot nicht gebacken. Alle atmen auf. Die Familie ist heiter und zuversichtlich. Sie reisen ein wenig. Auch nach Bernau, wohin sie Sophie Küchler, die Tochter aus dem Freundeshause, begleitet. Von Kind aus hat sie sich im Thoma-Hause daheim gefühlt. Heute ist Frau Bergman-Küchler die uneigennützige Gründerin und Betreuerin des wertvollen Hans-Thoma-Archivs in Frankfurt. Die Heimat hat Hans Thoma immer gerührt und mit dem Glück des Heimwehs zeitlebens erfüllt. Als der Meister schon die Schwelle des Herbstes überschritt, grau färbte sich sein reiches Haar, rief ihn die Heimat an hohe Stelle. Hätte es der ungewandte Bauernbub aus Bernau ahnen können, als er ehrfürchtig mit vor Aufregung enger Kehle die Treppe zu Galeriedirektor Schirmers Wohnung erstieg, daß er selber einmal an dessen Stelle ein Menschenalter später ebenso bange Schüler empfangen würde? Die Frankfurter Zeit dauerte zweiundzwanzig Jahre. Thoma war sechzig Jahre alt, als ihn Großherzog Friedrich I. als Kunstschulprofessor und Galeriedirektor nach Karlsruhe berief. Thoma hatte gar nicht mehr an einen Wechsel des Wohnsitzes gedacht. Es hatte ihn sogar zuweilen leise, leise entsagende Müdigkeit befallen, weil er glaubte, das Alter niste sich bereits im Körper ein, obgleich sein Wesen noch frisch und jung war und die Schaffenslust eher noch wuchs, besonders nach den Erfolgen der letzten Jahre. Dem Ruf des Landesherrn, der ihm trotz allem wohltat, durfte er kein Nein entgegensetzen. So siedelte er mit seiner Familie, die Mutter konnte nicht mehr die große Anerkennung ihres Sohnes miterleben, nach Karlsruhe über.
Die warme Freundschaft des Großherzogs bot ihm in allem, was die Ausgestaltung der Akademie, die Verwaltung der reichhaltigen Gemäldegalerie anbetraf, Unterstützung. Das Regentenpaar betreute ihn ganz besonders herzlich nach dem Tode Cellas, es nahm ihn mit
In Karlsruhe schart sich ein Kreis von Schülern um ihn, er ist ihnen gut wie ein Vater. In seinem gastlichen Haus oder in seinem Werkraum kommt er ihnen menschlich nahe; er mahnt und rät mit großer Milde, die aber nie etwas von Schwäche hat; denn nachgiebig ist er nie, wo er Unrecht wähnt oder Falschheit oder Untreue. Er liebt den Frieden im Hause, es hat nie Streit gegeben in seinem Heim. Immer noch ist Agathe, die treue, um ihn, die er als blühendes, kindliches Mädle so oft gemalt hat. Sie hat immer gedient, ihr ganzes Leben lang, sie ist im Dienen groß, klug und adelig geworden und hat über ein tiefes Leid ihrer Mädchenjahre nie ein schmerzliches Wort verloren. Hans Thoma hat wie die meisten Maler vom Oberrhein auch das Wort zu gestalten gewußt im Gedicht und im Bericht. Seine Bücher sind allesamt Bekenntnisbücher eines lauteren, besinnlichen, nach Klarheit suchenden Wesens, weder weichlich noch im einfältigen Sinne gemütvoll. Der Schwarzwälder zeichnet sich aus durch scharfen Verstand, er versteht zu rechnen, er weiß, was er will. Er urteilt zuweilen unerwartet stolz. Es darf ihm niemand boshaft an den Wagen fahren. Es ist eine gute Malergeneration durch Thomas Meisterwerkstatt gegangen, fast alle Schüler haben ihren Namen bekanntgemacht. Die Schule der badischen Landschaftsmalerei in Karlsruhe behielt ihr eigenes Gesicht, solange Thoma die Augen offen hatte. Er hat vorab in seiner Karlsruher Amtszeit vielen begabten Künstlern geholfen, er kannte keinen Neid. Er lehnte es aber ab, Halbkünstler und weichliche Genies, die nicht einer Alltagsnot sich entgegenstellen wollten, zu stützen und aufzupäppeln. Hier empfand er zu bäuerlich, zu gesund. Er selber hat sich auch nie auf andere verlassen; er maß am eigenen Stolz den Stolz der anderen. Wer ohne Notwendigkeit und ohne eigene Kraft sich vor ihm hilflos zeigte, durfte auf seine Hilfe nicht rechnen. Wo echte Not war, gab er aus seinem Eigentum und in großem Zuge.
 |