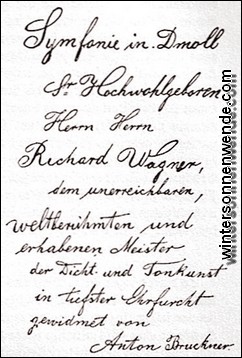|
[Bd. 4 S. 128]
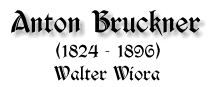
Wie ist dieser Gegensatz geschichtlich zu verstehen? In einem Geschichtsbild von der Art Nietzsches müßte Bruckner als ein Spätling des Christentums erscheinen, als der Hinterweltler aus Ansfelden, der im Tedeum noch des christlichen Gottes Ewigkeit pries, als Nietzsche dieses Gottes Tod verkündete. Einen nachgeborenen Gotiker, dessen Schaffen in mittelalterlichem Seelentum wurzele, nennen ihn Bewunderer, die anders werten, aber ähnlich zuordnen. Nur die Technik und Orchestersprache übernehme er aus dem Jahrhundert, in das er hineingeboren wurde, in der Tiefe aber sei er den Musikern und Mystikern der alten [129] Zeit näher verwandt als jedem neueren Meister. Der ehemalige Organist und Dorfschullehrer halte auch in seinen Symphonien an der alten Gedankenwelt fest. Aber das ist nur eine Teilwahrheit. Es spiegelt nur eine Schicht seines vielschichtigen Wesens. In der Polyphonie seiner Wesenszüge erklingen zwar viele Stimmen aus alter Zeit; aber stärker noch tönen überzeitliche Urformen und die Fülle des Neuartigen. So innig er mit der Vergangenheit verwachsen ist, so ist doch größer noch sein Anteil an der zeitlichen und überzeitlichen Gegenwart, und erst alle drei Bindungen zusammen ergeben seine geschichtliche Stellung: er wurzelt traditionsstark in seiner Heimat und der alten Zeit; er schöpft urständig aus den Quellen überzeitlicher Seelenkräfte und Wesenheiten; und er schreitet gegenwartskräftig in der vordersten Front der musikalischen Entwicklung. Zunächst allerdings, in den ersten vier Jahrzehnten seines Lebens, stand Bruckner gänzlich im Bann der Tradition. Mehr als jeder andere Meister war er in einem Gehäuse alter Musik- und Lebensformen eingeschlossen, welche die weiterfließenden Ströme des geschichtlichen Lebens längst zurückgelassen hatten. Seine Jugend fällt in das Zeitalter der Restauration; er wurde am 4. September 1824 geboren. Und seine Heimat ist das vormärzliche Oberösterreich. Hier hat er bis zu seiner Übersiedlung nach Wien (1868) geweilt, in kleinen Dörfchen, einem Stift, der Hauptstadt Linz, an Stätten also, die an sich schon etwas abgelegen waren und damals erst recht gegen das Einfließen neuer Strömungen ängstlich abgesperrt wurden. So blieb er von allen aufklärerischen Wellen nahezu unberührt. So blieb ihm zeitlebens fremd, was "freien Geistern" selbstverständlich war: an kirchlichen Glaubenssätzen und gesellschaftlichen Einrichtungen Kritik zu üben. Und so hat er zunächst nicht einmal von der fortschrittlichen Musik der Zeit etwas Wesentliches in sich aufgenommen. Er wuchs in beharrenden Lebensformen auf: der katholischen Kirche, der konservativen Staats- und Gesellschaftsordnung, dem vormärzlichen Landvolk. Er übernahm die Formen kirchlicher Frömmigkeit in Dorf, Kloster und Dom. Er übernahm die Weltanschauung, die einem Dorflehrer von den Mächten der Restauration anerzogen wurde, und bewahrte zeitlebens ehrerbietige Hochachtung vor ihnen. Und er hatte, wohl als letzter unter den Meistern, das Glück, noch inmitten des alten Landvolkes aufzuwachsen, bevor es sich durch die Einflüsse der Zivilisation wandelte, und gerade in diesem Land, wo es sich sonst ungewöhnlich rein erhielt. Die Schranken dieser Umwelt hat Bruckner in seinem Schaffen erst überschritten, als er sich in der großen Wende seines Daseins der lebendigsten Gegenwart anschloß. Aber auch in seinen reifen Werken wahrt er den Zusammenhang mit Stilen nah- und fernvergangener Zeit. Er folgt ehrfürchtig Meistern der kirchlichen Polyphonie, wie Palestrina und Lotti, und den Klassikern österreichischer Musik von Jakob Gallus bis Schubert und bewahrt eine Fülle von Wendungen auch aus der Kirchen- und Dorfmusik der engeren Heimat. Doch er ist frei von den Schwächen eines Spätgeborenen. Er erarbeitet sich von den Formen der [130] Vergangenheit nicht gar viel, dies aber so gründlich, daß er es meistert. Seine Fugen und reinen Chorsätze erfüllen lebendig ihr inneres Gesetz. Er hat sie sich "zu eigen gemacht" – doch er geht nicht in ihnen auf. Er wurzelt in der Vergangenheit, aber er verweilt nicht bei ihr, weder als "Hüter der Tradition", noch als Reformer, noch in romantischer Sehnsucht und Beschaulichkeit, und stößt dadurch gerade unter seinen vergangenheitshörigen Zeitgenossen auf Gegner. Er ist traditionsstärker als sie, aber zugleich ganz unhistorisch. Fast immer ist das Altertümliche in seinen Meisterwerken mit gegenwartskräftigen Zügen durchwachsen: die kirchentonartlichen Wendungen verbinden sich einträchtig mit romantischer Harmonik; die einstimmigen Linien, die den Tonfall altkirchlicher Psalmodie wahren, sind in ihren sprechenden Ausdrucksformen und Spannungsbögen und weitgereckten Intervallen neuartigste Melodik; in den Formanlagen, in denen er sich an das klassische Sonatengerüst hält, führt er fruchtbare Ansätze Beethovens folgerichtig weiter und setzt sein neues dynamisches Formprinzip durch; und die Ländler in den Scherzos der Symphonien übernimmt er so wenig wie die choralartigen Gebilde dem Schatz vorhandener Melodien, sondern sie sind originale Schöpfungen, Ausdruck seiner unmittelbaren Volksgebundenheit. Bruckner ist der gesteigerte Mann aus dem Volk, der von innen heraus Melodien in der Art des vormärzlichen Landvolkes schafft. Die alten Lebensformen sind in ihm noch schöpferisch. Sie sind ihm nicht anziehend-fremde Überlebsel aus alter Zeit, die man in Programmstücken abschildert oder als romantische Farben nutzt, sondern ein Teil seines Wesens; er spricht mit ihren Formeln aus eigener Seele, in eigener Sprache. Durch diese Traditionsstärke und ihre Verbindung mit Gegenwartskraft unterscheidet er sich von der bunten Menge der eigentlichen Spätlinge, die damals und gar heut auch unter Komponisten beängstigend anwächst. Er gehört so wenig zu den Wiederholern alter Stile, daß er uns vielmehr ein Maßstab sein kann, um diese zu beurteilen. Ein naives Fortschrittsgefühl trennt ihn von den Geschichtsbildern romantischer Reformer (in seiner Antrittsrede an der Wiener Universität rühmt er "unser so weit vorgeschrittenes geistiges Leben" und die "kolossalen Fortschritte" der Musik). Und die ungewohnte Vereinigung von echter Christlichkeit und echter Gegenwärtigkeit erhebt ihn über beide Verfallsformen der Kirchenmusik, ihr tragisches Entweder-Oder von Verweltlichung und Altertümeln, dem sie verfiel, als sie die Kraft zu eigenwüchsiger Entwicklung verlor, über ihre triebhaften, opernhaften und gemütlichen Abformen, das "Unreine, Üppige und Gemeinbehagliche", das einst Thibaut brandmarkte, und andererseits über die Reformer, die in eiferndem Widerspruch gegen solche Verweltlichung die Reinheit kirchlicher Tonkunst wiederherzustellen suchen, indem sie sich gegen die vordere Front der geschichtlichen Entwicklung abriegeln und in liturgisch "einwandfreiem" Stil Besonderheiten ihrer stärkeren Ahnen wiederholen; so jene Cäcilianer, die den größten christlichen Meister des Jahrhunderts, Anton Bruckner – ablehnten. [131] Daß Bruckners Messen und Gotteshymnen neben wenigen anderen wie einsame Lichtpunkte aus dieser Dämmerung hervorleuchten, beruht vor allem auf ihrer religiösen Ursprünglichkeit. Mehr noch als von den Mächten des vergehenden Zeitalters sind sie von überzeitlichen Seelenkräften bestimmt: von der Innerlichkeit, die zu den bleibenden Möglichkeiten deutschen Wesens gehört; von der produktiven Lebendigkeit im christlichen Sein; und darüber hinaus von allgemein religiösen Erscheinungen und ihren rein menschlichen Grundlagen. Bruckner erfühlt in den christlichen Glaubenssätzen und Gestalten das Überzeitlich-Heilige. Er schöpft aus eigenem Urerleben, nicht wie die Spätlinge aus dem Abglanz von Urerlebnissen, die einst andere hatten. Was in seinen Werken an mittelalterliche Mystik und Gotik gemahnt, beruht mehr auf Verwandtschaft als auf Abhängigkeit: er wurzelt nicht in ihrer Seelenlage, sondern in einer Gefühlswelt, an der auch jene teilhatte. Und gar die mehrstimmige Musik des eigentlichen Mittelalters hat unmittelbar überhaupt nicht auf ihn gewirkt. Bruckner ist nicht rückständig, sondern urständig, und darauf vor allem beruht seine Abseitigkeit. Seine Urständigkeit ist der Grundstein seines Wesens. Sie umschließt, was seine Bewunderer am meisten rühmen: die "Ewigkeitstiefe", das "Überweltliche" dieser Musik. Das aber rührt an das Geheimnis nicht nur Bruckners, sondern der Musik und der Welt überhaupt. Darum ist es so schwer, es sachlich aufzuhellen; und darum läßt es sich so schwer vermeiden, gerade das Ursprünglichste in Bruckners Wesen mit abgegriffenen Worten zu kennzeichnen und gerade das Urständige mit rückständiger Metaphysik und Theosophie zu umschwärmen. Bruckners Symphonien sind gewiß nicht bloß "tönende Formen"; so gewichtig zum Beispiel sein kunstvoller Kontrapunkt ist, so hat er es sich doch ausdrücklich verbeten, ihn als Selbstzweck aufzufassen; er sei "kein Orgelpunkt-Puffer und gebe gar nichts drum. Kontrapunkt ist nicht Genialität, sondern nur Mittel zum Zweck". Aber sie sind ebensowenig "Tondichtungen". Sie malen nicht vollwirkliche Gestalten, sie schildern nicht konkrete Vorgänge, sie predigen nicht über Weltanschauungsfragen. Sondern sie sind "absolute Musik" im Sinne des deutschen Idealismus. Ihr eigentlicher Inhalt sind nicht volle Bilder und Begriffe, sondern vom Konkreten abgelöste Erscheinungen, Gestimmtheiten und Strebungen. Es sind nicht "göttliche Personen" – wohl aber das Numinose (im Sinne Rudolf Ottos); nicht: "eine Waldszene mit Elfen und Kobolden", wie sie poetische Tondichter darzustellen suchen – wohl aber etwas Lichtes, Hauchdünnes, Huschendes und ähnliche Vorstellungen, welche die mythologische Phantasie zu Naturgeistern "verdichtet" hat. Oft allerdings gemahnen die Klänge an tatsächliche Wesen oder bringen konkrete Bilder mit sich: eine Ländlermelodie die Vorstellung des Dorftanzes, ein "Choral" die christliche Glaubensstärke. Aber dergleichen wird nicht dargestellt und abgebildet wie der Gegenstand eines Gemäldes, sondern klingt nur wie im Hintergrund mit an. [132] Was so als eigentlicher Inhalt sich darbietet und was dahinter sich andeutet, könnte an sich verschiedenen Sphären des Seins entnommen sein; die "absoluten" und zugleich inhaltsschweren Werke der deutschen Musik aber zeichnet vor anderen die Würde des Allgemeinen aus. Der Kern ihres Inhaltes sind überzeitliche (das heißt "ewige" oder durch Weltalter bleibende) Wesenheiten und Urvorstellungen der großen Gruppen. Wenn Nietzsche andeutet, das Wesentliche in der Musik sei ein Nachklang von Stimmungen, deren begrifflicher Ausdruck Mystik war, so gilt dies zwar nicht für jede Musik, doch wahrlich für "den tiefen träumerischen Ernst deutscher Mystiker und Musiker". Nicht aus besonderen Programmen schöpfen diese Meister, sondern unmittelbar aus Gefühlsgründen, aus denen auch mystische und metaphysische Ideen, mythologische und religiöse Gestalten sich "bildeten", aus den Grundlagen abendländischer und christlicher Seelenwelt, aus der Eigenart deutscher Liebe und Trauer, deutschen Lebens- und Weltgefühls, aus den Gefühlskreisen zum Beispiel der Seligkeit und des heldischen Wesens, der Weihnacht und Mariengestalt, des Benedictus und Crucifixus, aus den volkhaften, höfischen und romantischen Traumländern, aus den Weisen und geprägten Haltungen des Sichgebens und ‑bewegens. Insofern steht Bruckner durchaus nicht "abseits" in der neueren deutschen Musikgeschichte, sondern brüderlich in der Gemeinschaft ihrer großen Meister. Was aber seine Werke von anderen unterscheidet, ist vor allem das Relief ihrer Inhaltskreise. Mehr als andere scheinen sie auf über-menschliches Sein zu deuten. Sie gemahnen an die christliche Glaubenswelt und das Unendlichsein und auf die Lebenskräfte, die in Natur und Volkstum wirken. Und in der Schicht des eigentlichen Inhaltes künden sie mehr als andere vom Heiligen und seinem Umkreis an Erscheinungen und Akten. Die Werte der Musik sind in ihnen bis zu ihren Grenzen geschärft, um dem Höchsten und "Tiefsten" Ausdruck zu geben, was der Mensch erlebt und ersinnt. Es sind Klänge der Macht und Erhabenheit, die an die Superlativbegriffe des "All-" und "Über-" gemahnen: gewaltige Kraftanspannungen, majestätisch-düstere Klangmassen und strahlende Lichtfluten; monumentale, blanke Klanggestalten, die den christlichen Helden der Stauferzeit verwandt sind; Schälle, die wirbeln und brausen, anwachsen und sich entladen wie Naturgewalten. Die gesteigerte Lautstärke des vollen Orchesters und Chors, die gedrungene Wucht des Unisono, Akzente Ton für Ton und die Ballung gewaltiger Oktavenschwünge (so in der Neunten Symphonie und dem "Alles, alles" des Psalms) rühmen das Ideal der höchsten Kraft und Herrlichkeit. Sie sind vergleichbar den "gewaltig dahinrollenden Sätzen" klassischer Propheten und den "ungeheuer lauten Tönen und grellen Lichtern" in ihren Visionen (und vielleicht auch ihrer Gestaltungsweise; als sprunghaft, absetzend, Stein auf Stein gewaltsam häufend und doch zu einem kunstvollen Gesamtbild fügend, kennzeichnet Gunkel die prophetische Darstellung). [133] Es sind sodann Klänge der Verklärung und Beglückung: ein heiliges Schwelgen und Prangen, ein seliges Jauchzen wie in entzückter Betrachtung des höchsten Gutes, eine gottestrunkene Verzückung und dann wieder warme, stille Beseligung und mildes, gütiges Singen in den Gefühlskreisen um Gnade und Segen. Die festlichste Harmonien- und Farbenpracht kündet von dieser Herrlichkeit, die innige Glut langgeschwungener Melodien von dieser durchschauerten Seligkeit, und verklärend erstrahlen flimmernde Triller und umrankende, wie gewichtslos schwebende Geigenfiguren. Solche Klänge entsprechen dem Gottesbild der gesteigerten Wertfülle. Zwischen ihnen aber ertönen Geheimnisklänge aus den entgegengesetzten Erlebnisbereichen. Sie künden von mystischer Ruhe und Leere. Alles Laute, Helle und Farbige ist hier bis zu seinen Grenzen gemindert, zu einem fast lautlosen Dunkel. Alle Glut ist erloschen. Die Zeit steht still. Und aus beklemmendem Schweigen tönt ein einsames Instrument, ein leiser, dumpfer Paukenwirbel – oder alles verstummt in das sinnerfüllte "Nichts" einer gespannten Pause. Ein mystisches Erschauern (wie im Sanctus des Tedeum), das ehrfurchtsvoll flüsternde Aussprechen der göttlichen Namen und dunkle, bebende Akkorde, bei denen die Seele ganz in sich verstummt und tiefenwärts lauscht, rühren an die Grenzen des Menschen zur verborgenen Gottheit. Und leere Quinten, der weite Klangraum zwischen zwei einsamen Linien, das stufenweise Hinabsinken eines Motivs über einem ausgehaltenen Baßton gemahnen an die heilige "Weite und Leere" und das Unendlichsein in Raum und Zeit. Mit dem Über-Menschlichen erscheint in solchen Klängen oft zugleich die Hinwendung des Menschen zu ihm, oder Erscheinung und Stimmung verschwimmen in eins. An vielen Stellen aber ist das seelische Verhalten selbst der Kern des Inhaltes. Bruckners Werke sind reich an Gebeten. Er gibt den Abstufungen und Steigerungen des gedrückten und drängenden Flehens aus der Wahrhaftigkeit seines persönlichen Betens so inbrünstigen Ausdruck wie niemand neben ihm. Er gestaltet wieder und wieder das Gegeneinander von Sehnen, Zweifeln und Glauben, so am Beschluß des Tedeum, der von gotteskindlicher Zuversicht und banger Verwunderung zu herzzuschnürender Beklemmung und schließlich zu der jauchzenden Gewißheit führt: Ich werde niemals, in Ewigkeit nicht untergehen. Und er kündet in seinen letzten Werken, besonders der Neunten Symphonie, von heiliger Trauer und Schwermut, von abgründiger Resignation und ewigkeitsstiller Verklärung, in der die Bitternis seines Lebens aufgehoben ist. Neben diesen Kerninhalten stehen in Bruckners Partituren zwar noch viele Stellen schlichter Anmut und Herzlichkeit, urwüchsige Tanzrhythmen und köstliche symphonische Klangspiele. Aber die bunte Fülle innermenschlichen Lebens und Charakters tritt im ganzen zurück, und die Inhaltskreise des weltmännisch-urbanen Gesellschaftstons, des Fremdvolklich-Rassigen, des Bacchantischen und Höllischen und andere, die in der Musik der Zeit überreichlich erscheinen, [134] fehlen bei Bruckner fast gänzlich. Insofern ist er weniger universal als andere Meister – doch darum nicht weniger groß. Die Beschränkung auf jene Inhaltskreise und wenige Gattungen gehört zu der gotteskindlichen Unschuld, der christlichen Sittlichkeit und dem künstlerischen Ethos seines Wesens. Als dem fast Siebzigjährigen ein Operntext zur Komposition angeboten wird, wünscht er es in der Art des "Lohengrin, romantisch religiös-mysteriös und besonders frei von allem Unreinen" – und deutet damit selbst auf diese Wesensart seiner Musik, die frei ist von schwüler Brunst, der Hauptgefahr des Zeitstils, wie von den Mißformen religiöser Erotik, der Hauptgefahr für ihn selbst, den wieder und wieder liebenden, niemals erhörten, ehelosen Schöpfer "religiös-mysteriöser" Werke. So bewahrt er von Anbeginn die "Reinheit der Tonkunst". Doch er verblaßt nicht zu nazarenisch-karger Unsinnlichkeit, sondern getreu einem Wesenszug des katholischen Südens erfüllt er auch seine Religion mit natürlicher Leidenschaft und Sinnenfreude – indem er diese vergeistigt und heiligt. Und auch die andere "Einseitigkeit" Bruckners, die Beschränkung seiner Lebenskreise, ist nicht Mangel, sondern Reinheit und die notwendige Kehrseite seiner Geschlossenheit. Sein geistiges Leben während der Meisterjahre ist Schaffen, Musizieren und Lehren, er sucht das Reich Gottes und besorgt sich mit existenzieller Leidenschaft um seine ewige Seligkeit. Alle übrigen geistigen Lebenskreise schiebt er weit zurück in die Außenbezirke seines Daseins oder hält sich ganz von ihnen fern. Zwar hat er in seiner Schulmeisterlaufbahn und nachher autodidaktisch ein nicht geringes Wissen und einen hohen Respekt vor dem Wissen erworben. Doch im übrigen ist er den allseitig Bildungsbeflissenen unter seinen Zeitgenossen und universalen Geistern wie Wagner geradeswegs entgegengesetzt. Ihm fehlen die Antriebe und Voraussetzungen, es ihnen gleichzutun, seine Seele ist von Grund aus anders gefügt. Der Genius in ihm hütet instinktsicher seine Schöpferkraft vor störender Bewußtheit. Der Spätreife weiß angesichts des vorgeschrittenen Alters und der immer wieder drohenden Krankheit, daß er mit Zeit und Kraft haushalten muß, um seinen geschichtlichen Auftrag erfüllen zu können. Der Mystiker bewahrt sich vor Zerstreuung in die Vielheit der vergänglichen Dinge und blendet die bunte Menschenwelt ab, damit ihm das Licht des Seelengrundes um so heller leuchte. Und den unerschüttert gläubigen Katholiken drängt es nicht zu Weltanschauungsproblemen; dieser Schöpfer "metaphysischer" Musik ist ein "unphilosophischer Mensch". Dementsprechend liest Bruckner wenig. Gar eine Zeitung zu halten, lehnt er heftig ab, und schon aus Linz schreibt er an R. Weinwurm: "...daraus kannst Du sehen, wie wenig ich Zeitung lese und weiß, was in der Welt vorgeht." Auch in den Briefen ist fast niemals von Problemen und Ereignissen der Zeit oder grundsätzlichen Dingen die Rede; und frühere Schüler berichten über die Enge seines Gesprächsstoffes bei der allabendlichen Geselligkeit im einfachen Wirtshaus. So ist Bruckner in der Tat "einseitig". Aber diese Einseitigkeit ist fruchtbar und [135] notwendig für ihn. Seine Abgeschlossenheit ist zugleich: Geschlossenheit, seine Beschränkung: Konzentration. In seinen Grenzen steht er um so sicherer, gedrungener, fester gegründet da, ein starker Gegensatz gegen alle Abformen häufender Bildung und romantischer Unbegrenztheit. Der positive Grund dieses stämmigen Stehens, die Grundsteine seiner Urständigkeit sind sein Volkstum, seine Musiktheorie und seine christliche Frömmigkeit. Bruckner übernimmt nicht nur zeitgebundene, sondern erst recht überzeitliche Eigenschaften des oberösterreichischen Landvolkes. Seine Vorfahren lebten mindestens seit dem sechzehnten Jahrhundert in diesem Teil des Voralpenbeckens, einem "der verstecktesten Winkel Österreichs, wo sich die kerndeutsche Bevölkerung von jedem blutfremden Einschlag frei erhielt". Sie waren in älterer Zeit zumeist Bauern, später Gewerbetreibende und Dorfschullehrer, aber auch diese nächsten Ahnen und Eltern beharrten im landvolkhaften Seelentum. Bruckner selbst hat nur in wenigen kurzen Reisen Österreich verlassen und fast zwei Drittel seines Lebens in der engeren Heimat geweilt. Und da überdies unter den neueren Meistern fast ausschließlich Deutsche auf ihn gewirkt haben, ist seine Musik von fremdvolklichen Bestandteilen so rein wie kaum eine andere. Sie ist deutsch in ihrer ganzen Wesensart; und sie ist Ausdruck seines Stammes in ihren Ländlern und heimatlichen Lieblingswendungen, der breiten Schwere und Gemächlichkeit, der herben Geradheit bei allem sinnenfroh klangseligen Prunk, der "seel'n-guat'n" Traulichkeit und herzigen Kindesseligkeit. Solche volkhaften Züge sind absichtsloser Ausdruck seiner eigenen Volkhaftigkeit. Doch manchmal scheinen sie auch von Bruckners Heimweh zu sprechen. Er hängt an seiner Heimat. Er kehrt aus der ihm so fremden Großstadt immer wieder zu ihr zurück, jedes Jahr, um auszuruhen, und endlich zur letzten Ruhe; seinem Willen gemäß liegt nun sein Körper in heimatlichem Boden, unter der Orgel des Stiftes St. Florian. Wie es überhaupt das Bedeutsamste an Bruckner ist, daß er zwar aus der Enge seiner heimatlichen Umwelt hinauswächst, aber ihre Stärke bewahrt, so verliert er in der Großstadt auch nichts von seiner volkhaften Urwüchsigkeit. Auch als Lektor und Professor bleibt er ein echter Dörfler aus Oberösterreich, in seinem ganzen Gehaben, seinem Dialekt, teilweise auch seiner Kleidung. Ein köstliches Bild davon gibt eine Szene, die sein Schüler Fr. Klose erzählt: Bruckner, der "ums Leben gern 'Wagerl' fuhr", begleitet einige Schüler und junge Freunde im Wagen bis zum Vergnügungsetablissement, in dem diese tanzen wollen, und fährt dann allein nach Haus; "und nun ertönten, was mir zeitlebens unvergeßlich sein wird, aus der davonrollenden fürnehmen Equipage laute, nach und nach in der Ferne verhallende, echt oberösterreichische Juchzer". Aber so tief Bruckner im Landvolk wurzelt, so hoch wächst er aus ihm hinaus. Er löst jene Grundfrage besonders des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts: Hochkunst und volkhafte Vitalität, indem er beide krampflos verbindet. Er vereint Blut und Geist, Volkstum und Meistertum. Er fügt volkhafte Melodien [136] und Inhalte in die höchstorganisierten Gefüge der Musikgeschichte und beweist, daß der Schaffende nicht kunstlos bleiben muß, um das Naturhafte zu wahren, sondern daß Urtümlichkeit auch auf der Stufe höchster Geistigkeit möglich ist. Das ländliche Volkstum ist ihm die selbstverständliche Grundlage. Er sucht und umschwärmt es nicht, und gar gemachte Triebhaftigkeit ist ihm geradeswegs entgegengesetzt. Er steht in der Erde, aber blickt aufwärts. Er ist natürlich, doch zugleich vergeistigt. Die bäuerliche Gesundheit und Derbheit seines Wesens hat ihr Gegengewicht in einer unendlich feinen, durch Nervenleiden noch erhöhten Erregbarkeit, Zartheit und Schwermut. Den gedrungenen Klangmassen seiner Partituren stehen leichteste, zarteste Klanggewebe gegenüber. Und im Gegensatz zu naiv oder absichtlich primitiven Musikarten (und der "genialen Kunstlosigkeit" etwa Mussorgskijs) ist sein Schaffen höchstbewußtes Bauen kunstvoller Gebilde auf dem Grunde einer umfassenden musiktheoretischen Gelehrsamkeit. Bruckner hat so gründlich wie kaum ein anderer der großen Musiker die Theorie der Musik studiert und gelehrt. Und wenn auch die Lehre Sechters, an die er sich hauptsächlich hielt, rückständig ist, so faßt er doch in ihr und durch sie hindurch das Überzeitliche. Die Periodenzahlen und Notizen über das Fortschreiten der Stimmen in seinen Skizzen bekunden, wie er fast pedantisch mit theoretischer Besinnung schafft. Seine Formanlagen zeigen, wie er sich die Gesetzlichkeit der Musik so zu eigen gemacht hat, daß sich der Wille des Meisters mit dem "Willen der Töne" deckt. Und die für ihn so kennzeichnenden Stellen, in denen gleichsam die Pfeiler des Tongebäudes bloßgelegt sind, in denen Grenzwerte des Klanges oder die nackte Substanz der Quinten und Oktaven auftönt, sind Ausdruck seines urständigen Tonerlebens. Musiktheorie ist ihm Betrachtung des Grundrisses der Tonwelt und tonalen Mehrstimmigkeit. Er durchdenkt das System möglicher Tonverbindungen nach jeder Richtung, er bringt es sich auf der Orgel improvisierend zum Klingen und bemüht sich, in jedem Winkel dieses Reiches heimisch zu werden. Er sinnt mit endlos geduldiger, bohrender Sachlichkeit den Urformen und Grundlagen nach und hört sich starr beharrlich in sie hinein. Ein eindruckskräftiges Bild davon steht ebenfalls in den Erinnerungen Kloses: Bei einem gemeinsamen Ausflug ist Bruckner "von einer Stelle mit besonders merkwürdigem Echo nicht mehr wegzubringen". Er lauscht und lauscht und kann sich nicht losreißen – auch als seine Jünger nicht mehr bei ihm ausharren und die Nacht hereinbricht. Noch lange habe man "in der Tiefe den Säumigen Intervalle singen hören, die im Zusammenklang Nebenseptimenakkorde oder deren Umkehrungen ergaben". So grübelte er sich in den Wesenheiten der Tonwelt und des Gottesreiches fest. Wie er überhaupt die Eigenschaften eines Genies mit seltener Reinheit verkörpert, so besitzt er auch dessen eigentümliche Kraft der Kontemplation, und durch die Eigenart seines Nervenleidens verstärken sich noch diese Zustände weltvergessener Versenkung. Der rätselhafte Blick besonders auf den späten Bildnissen und viele Berichte künden von ihnen. Es sind Zustände lauschender Betrachtung und [137] begnadeten Schaffens, betender Andacht und mystischer Verzückung. Bruckner hat viel und inbrünstig gebetet. Man berichtet, wie er betend von Tränen bedeckt ist und während der Wandlung mit verzücktem Antlitz meditiert. Nach einer strengen Ordnung verrichtet er täglich bestimmte Gebete, darunter den "Rosenkranz", und legt sich in einer gewissen Buchführung Rechenschaft darüber ab. Die christliche Religion gibt ihm durch die Fülle ihrer gefühlsträchtigen Vorstellungen den Anschauungsstoff zu seiner Andacht. Sie gibt ihm den Glauben, der seine Seele wie ein Grundstein trägt; er fühlt sich in Gottes Hand und deutet Schicksale als Wirken Gottes ("Ich nehme dies als Buße an... Wahrscheinlich um mich zu prüfen... Gott sei Dank! daß er mich unter den Stürmen des Lebens so treu bewahrt hat"). Und sie gibt ihm Triebfedern, die sein Leben im Rahmen des tragenden und begrenzenden Gerüstes um so leidenschaftlicher machen: das stete Gedenken an den Tod, das Streben nach ewiger Beseligung, die Pflicht, mit dem Talent zu wuchern. In seiner Gottverbundenheit vereinigen sich demnach geborgene Ruhe und leidenschaftliche Unruhe. Er steht fest im Glauben, und seine Grundfrage lautet nicht "ob ein Gott ist?", sondern "Non confundar?" Er ist ein gotteskindlicher Mensch; "kindli is er g'wen", wird aus seiner Dorflehrerzeit berichtet. Und er ist Mystiker, Christ aus Substanz, Sohn eines rein katholischen Stammes und darum nicht Gottesstreiter, Reformer oder Kampfchrist; seine Frömmigkeit bleibt in Werk und Leben unpolemisch. "Keine seiner Äußerungen verriet je den Versuch, in Fragen des Bekenntnisses andere beeinflussen zu wollen", berichtet Klose. Doch andererseits ist er aus Religion tief erregt. Er spürt wie wenige das Unheimliche, er lebt in Grenzlagen und hart an Abgründen. Zu seinem Gottesbild gehören nicht weniger als väterliche Güte und Huld auch verdammende Übermacht und Geheimnisferne; Göllerich erzählt, daß er von Gott nur im Ton ehrfürchtig-scheuen Flüsterns sprach. Er lebt in den Spannungen des christlichen Lebens mit einem peinigend ängstlichen Gewissen. Und so wenig er zu den absichtsvollen Reformern gehört, so spürt er doch die Sendung und Verpflichtung seines Schaffens. Er spricht es aus, daß sein Tedeum ihn einst vor Gottes Thron rechtfertigen werde, und bis an sein Lebensende bewahrt er einen kleinen Lorbeerkranz, der ihm bei der Aufführung seines ersten Meisterwerkes, der Messe in d, überreicht wurde, mit der Inschrift: "Von der Gottheit einstens ausgegangen, muß die Kunst zur Gottheit wieder führen." [138] In vielen solcher Wesenszüge ist Bruckner seiner Zeit recht fremd. Aber die Tiefe seines Inneren wäre auch zu jeder früheren einsam gewesen, so "zeitfremd" wie Bach und wie die Spätstile einiger großer Meister; Musik der gottnahen Stille kann nicht "zeitnah" sein. Doch andererseits: so weit Bruckner von der "Zeit" (gleich dem Getriebe der Öffentlichkeit) entfernt ist, so zeitverbunden ist er doch in anderer Hinsicht. Er steht fern dem lauten, doch nah dem schöpferischen Leben. Er steht abseits von den Kunstparteien, auch derjenigen Wagners, aber er gehört zu der Gruppe der Musiker, die die Entwicklung vorwärtstreiben. Zwar warf man ihm vor, sein Stilprinzip sei "die Übertragung von Wagners Nibelungen-Stil auf die Symphonie"; in Linz heißt es schon über die erste Messe: "Wir haben Bruckner in diesem Werk als einen Anhänger der sogenannten Wagnerschen Richtung kennengelernt"; und er selbst ist dem Meister, seinen Jüngern und besonders dem Wiener Wagner-Verein persönlich verbunden; er rühmt ihn in Briefen
Die Geschichte der abendländischen Komposition erscheint uns (in einem vergröbernden Gesamtbild) als fortschreitende Ausschöpfung unserer Klangwelt, als allmähliche Einbeziehung möglicher Lautheitsgrade, Lichtverteilungen und so fort in den ständigen Stil. Der letzte Gipfel dieser Entwicklung, die fünfte Stunde der deutschen Musik überragt zwar nicht etwa an Wertgehalt die früheren Gipfel um Senfl, Schütz, Bach und die Wiener Klassiker. Aber in Wagner, Bruckner und anderen Meistern der Zeit scheint die Entwicklung zu einem gewissen Abschluß zu gelangen und mancher Kreis der sachgegebenen Möglichkeiten so entfaltet zu sein, daß eine wesensneue Grundform etwa der Dynamik über sie hinaus nicht mehr möglich ist. Bruckner erfüllt in eigener Weise, was in dieser Entwicklungslage "fällig" wird. Er bezieht Grenzbezirke in den ständigen Klangschatz seines Stiles ein, so die größten und kleinsten Lautstärken und die größten melodischen Schwünge, von der Sext bis zur Dezime. Er entfaltet den gewonnenen Reichtum zu bunter Farbenpracht und schnellem Wechsel der Akkorde und Tonarten (die Kritik rügte "die Hetzjagd abenteuerlicher Modulationen"). Er durchmischt in vielfältigster Weise Licht und Dunkel, Dur und Moll. Seine Musik ist überaus reich an neuen Arten der Steigerung, des Verklingens, des zitternden, wogenden Klanggrundes, des Werdens der Themengestalt aus Klangnebel und Teilansätzen. Und sie ist [139] überaus reich an Kontrasten, und im Gegensatz zum Neuen gewinnt dann auch das Alte ein neues Gesicht, und inmitten von Stellen des Schwankens und Zwielichtes klingen seine krönenden Dreiklänge um so leuchtender. Darin aber liegt nun seine einzigartige Bedeutung, daß er in dieser voll entfalteten Klangsprache Urformen des religiösen Seelentums ausdrückt. Unter allen großen Meistern auf dieser Entwicklungsstufe ist er der einzige von Grund aus religiöse Genius. Und unter allen großen Meistern religiöser Musik spricht er als einziger in dieser Klangsprache. Er allein schafft zugleich aus abgründiger Gottverbundenheit mit den höchst-differenzierten Ausdrucksmitteln. Darum finden manche Seiten des religiösen Erlebens in keiner anderen Musik so reichen und eindringlichen Ausdruck, vor allem das Übermächtige und geheimnisvoll Andere im Wesen des Heiligen und das Ineins einer Fülle vielfarbiger Erscheinungen (im Gegensatz zu jenen Teilen altkirchlicher Musik, wo "das Feierliche jede Verschiedenheit in seinen weiten Mantel verbarg"), das Ineinander von beklemmender Düsternis und berückendem Glanz, von Schauer und Seligkeit und die "himmelsstürmenden Steigerungen" bis zu verzückter Schau als ihrem Ziel.
[140] Dies aber unterscheidet Bruckner von anderen Meistern der "kultischen" Hochkunst, daß er ein absoluter Musiker ist und in unverblaßtem Sinn ein religiöser Mensch. In diesem Sinne verwandelt er, was er von Wagner und anderen übernimmt. Er hebt Tonsymbole, die in der romantischen und realistischen Orchestersprache für dramatische Vorgänge geprägt wurden, in die Sphäre des Heiligen empor und reinigt sie von ihren literarischen Begleitvorstellungen. Und er wandelt den dramatischen Ausdruck in den geraden, selbsteigentlichen Ausdruck seines Betens. Er entgeht der Gefahr, im dramatischen (oder gar "theatralischen") Als-Ob haftenzubleiben; er stellt nicht das Beten als einen bühnenartigen Vorgang dar, wie es die Zeit in den Gebetsarien der Tenöre und dem Religioso der Klavierstücke liebte; sondern der religiöse Mensch selbst in der wirklichsten Wirklichkeit seiner Person und mit der Intensität der vollen Wahrhaftigkeit betet in seinen Werken. Darin liegt ein betont christlicher Zug seiner Musik. Bruckner ist niemals unpersönlich objektiv, und so stark sich an vielen Stellen das Überpersönliche ausprägt, so stark behauptet sich an anderen der bittende, zagende, hoffende Einzelmensch. Damit ist freilich ein Grundproblem der Aufführung Brucknerscher Werke gegeben: wie sollen Musiker, sofern sie nicht eigentlich religiöse Menschen sind, im Gesellschaftsrahmen des Konzerts sein Gebet wahrhaftig nachvollziehen? Es gehört zu den vielen Schwierigkeiten, die der außerkirchlich-kultischen Hochkunst im Wege stehen.
 So durchdringen sich in Bruckners reifen Werken Traditionsstärke, Urständigkeit und Gegenwartsnähe. Die Kräfte der Tradition und des Urerlebens formen ihn von früher Jugend an; zu der neuen Klangsprache und eigenständig religiösen Hochkunst aber stößt er erst in seiner Lebenswende vor. Demgemäß gliedert sich sein Lebensgang in diese drei Abschnitte: die vier Jahrzehnte der Vorbereitung, die Zeit der Lebenswende und die Wiener Meisterjahre. Bruckners Lehrjahre sind ein langer, mühsamer Anstieg. Seine frühe Kindheit verbringt er ausschließlich in dem Dörfchen Ansfelden. Weil er Lust und Gabe zur Musik bekundet ("Alleweil hat er d'Musi in Schädl g'habt"), kommt er vorübergehend nach Hörsching, zu seinem Vetter Weiß, einem jungen, begabten Kirchenmusiker. Und als er mit dreizehn Jahren seinen Vater verliert, nimmt ihn das Augustinerstift St. Florian als Sängerknaben auf. Im Stift und an der Präparandie zu Linz bereitet er sich auf die Laufbahn eines Dorfschullehrers vor. Er wird Unterlehrer in Windhag und nachher in Kronstorf, zwei Weltwinkeln von zweihundert und einhundert Einwohnern, und schließlich 1845 in St. Florian selbst. Hier waltet er zunächst weiterhin als Schullehrer, wird dann aber 1851 außerdem Stiftsorganist. An dem herrlichen Orgelwerk von Krismann entwickelt er sich zum bedeutenden Orgelimprovisator, und allmählich setzt sich das Ziel seines Berufes durch: er will die Schulmeisterlaufbahn verlassen und Musiker werden. [141] Diese Sehnsucht erfüllt sich, als er 1856 die Stelle des Domorganisten zu Linz erhält. Wie er das ganze dritte Jahrzehnt im Stift verbrachte, so nun das vierte in der Mittelstadt. In Linz kommt es dann zu der schöpferischen Krise. Die Eigenart dieser Lehrjahre war für Bruckners geschichtliche Sendung in vieler Hinsicht günstig. Er konnte in der abgelegenen Stille ungestört reifen und die Tradition in ihrer Kraft und Reinheit aufnehmen. Er mußte sich schon früh in öffentlichen Lebensformen bewähren: als Sänger- und Mesnerknabe, bereits mit elf Jahren auch an der Orgel und sogar, in Vertretung seines Vaters, beim Schulhalten; und als er selbst Dorfschullehrer wurde, übernahm er zugleich die anderen Obliegenheiten dieses vielseitigen Amtes; er war Organist, Chorleiter, Mesner und noch dazu Geiger beim bäuerlichen Tanz. Vor allem aber erlebte er mit kindlicher und genialer Empfänglichkeit die urwüchsig natürliche Gefühlswelt des vormärzlichen Dorfes. Er ließ seine Seele durch die alten Formen seelischer Erziehung bilden, durch Gebet, Gottesdienst und Sakrament. Als Mesnerknabe mußte er bei den Versehgängen zu Sterbenden mitgehen, und was ihn hier angesichts des Todeskampfes und der kirchlichen Weihe wieder und wieder ergriff, hätte keine Lehranstalt ihm geben können; als der dreizehnjährige Mesnerknabe am Sterbebett des eigenen Vaters stand, sank er ohnmächtig in sich zusammen. In St. Florian sodann, dem reichen, prachtvollen Stift, erlebte er den schloßartigen Prunk dieses Hauses, er nahm an dem berauschenden Glanz der Festmessen teil und an dem ewigkeitsstillen, streng gestalteten Gang klösterlichen Lebens. Und an der gewaltigen, wundersamen Orgel, unter der sich jetzt sein Grab befindet, drang er in die Geheimnisse der Tonwelt ein und in die Farbenvielfalt und Phantastik, Erhabenheit und Gesetzesstrenge dieses Instruments. Auf solchen Urerlebnissen, die sich durch die Macht der Wiederholung immer tiefer seiner Seele eindrückten, beruht zum wesentlichen Teil die Eigenart seines späteren Schaffens.
Doch andererseits war diese Umwelt vom Strom des geschichtlichen Lebens so abgelegen, daß es eines ungeheuren Aufwärtsdranges und Lerneifers bedurfte, um sich aus ihr zu seiner späteren Größe durchzukämpfen. Sein Weg war weiter und schwerer als der Weg der übrigen großen Meister. Denn zwar kamen auch andere aus abgelegenen Dörfern, aber sie gelangten bald an Stätten neuer musikalischer Hochkultur. Bruckner dagegen (darin der genaue Gegensatz etwa zu Mozart) blieb bis in das vierte Jahrzehnt seines Lebens ohne wesentliche Berührung mit fortschrittlicher Musik, ohne ständigen Konzert- und Theaterbesuch, ohne eigentlichen Unterricht in neuer Komposition und künstlerischer Ausübung. Die Musik in seiner Heimat war beschränkt auf gregorianischen Gesang, Gemeindelieder, einige Chor- und Orgelmusik von Palestrina bis Schubert und dazu neuere Messen und Motetten zweitrangiger, meist einheimischer Tonsetzer, die sich mit kunstlosem Chorsatz begnügten oder im österreichischen Kirchenstil um Haydn und Mozart verweilten, und außerhalb der Kirche auf Dorfmusik, Männerchöre und Hausmusik im Geschmack des Biedermeiers und einen begrenzten Schatz klassischer [142] Kunstwerke. Zudem hielt ihn sein Lehrerberuf davon ab, sich der Musik mit ganzer Kraft zu widmen. In Windhag beschwerte sich der Pfarrer über ihn, daß er zu viel komponiere; und als er sich einst weigerte, eine niedrige Knechtsarbeit zu leisten, wurde er strafversetzt. Dazu kam noch, daß seine Umgebung, weit entfernt, etwas von dem Genie zu ahnen, das in ihm schlummerte, dem wunderlichen Schulgehilfen wenig Achtung entgegenbrachte. Den Bauern erschien er ob seines absonderlichen Streifens in den Feldern und der Zustande seltsamer Versunkenheit als der "halbv'ruckte G'hülf"; in St. Florian sah er sich wie "ein reiner Diener g'halten". "Unser Stift behandelt Musik und folglich auch Musiker ganz gleichgültig... Ich darf von Plänen nichts ahnen lassen", schreibt er "arm und verlassen, ganz melancholisch" 1852. Und erst recht fühlt er sich nachher in Linz verkannt und verbittert. So kommt es zu einem dramatischen Widerstreit der Motive: Er spürt, daß er zum schaffenden Musiker berufen ist, er hält es für eine religiöse Pflicht, diese Begabung zu entfalten, und der Genius in ihm drängt. Es wurmen ihn die Verkennungen, es lockt das Musikleben der Welt da draußen, es locken Ehrungen und Titel (er ist aus demütigem Respekt vor ihnen – ehrgeizig; bis ins Greisenalter hat er sich um akademische Grade bemüht). Aber dagegen erhebt sich die Schar der Bedenken: Er ist in der alten ständischen Gesellschaftsordnung aufgewachsen; sozialer Aufstieg ist ihm und den Seinen nicht etwas Selbstverständliches. Der Vater war Dorfschulmeister – soll er etwas anderes werden? Als ihn einst der Prälat fragte, was er werden wolle, Geistlicher oder Schulmeister, hatte er sogleich geantwortet: "Wia der Vater!" Zudem macht er sich von einer Künstlerlaufbahn nur sehr unbestimmte Vorstellungen, er hat keine unmittelbaren Vorbilder. Und immer wieder kommen die Zweifel, ob er diesem Ziel gewachsen sei. Er hat zwar einige Gönner und Freunde; sein Firmpate Seiler beabsichtigt sogar, ihn "ins Wiener Konservatorium zu geben". Doch er stirbt 1848 (unter dem Eindruck seines Todes schafft Bruckner das Requiem, sein bedeutendstes Jugendwerk). Und andere, besonders seine Mutter, reden dem Zagenden heftig und entschieden von seinem "hochfahrenden Plane" ab. Solchen Bedenken gegenüber sucht er sich und seiner Umgebung durch möglichst viele Zeugnisse seine Begabung zu beweisen. Um nur von St. Florian wegzukommen, bewirbt er sich um verschiedene Stellen und richtet sogar, neunundzwanzig Jahre alt, ein seltsames Gesuch an die "Hohe k. k. Organisierungs-Commission", sie "wolle... ihm eine Kanzellistenstelle in hoher Gnade zu verleihen geruhen... in gnädigster Berücksichtigung, daß der gehorsamste Bittsteller auf alle ihm mögliche Weise mit allem Fleiß und Hingebung bemüht war, sich für das Kanzleifach auszubilden, welchen Beruf er schon so lange in sich fühlt". Vor allem aber verstärkt er, soweit es überhaupt noch möglich war, seinen Lerneifer. Bruckner hat unheimlich viel gelernt. In St. Florian soll er täglich zehn Stunden Klavier und drei Stunden Orgel geübt haben. Und als ihn 1855 Simon [143] Sechter, der berühmte Wiener Theoretiker, als Schüler in Harmonielehre und Kontra annimmt, fährt er von Linz aus jährlich einige Wochen nach Wien und arbeitet in der Zwischenzeit mit unsäglicher Gründlichkeit neben der Last seines Amtes als Domorganist, vieler Privatstunden und seiner Chortätigkeit noch "tägli siab'n Stunden für eam", so eifrig, daß Sechter ihn 1860 ersucht, "sich mehr zu schonen... Ich fühle mich gedrungen, Ihnen zu sagen, daß ich noch gar keinen fleißigeren Schüler hatte als Sie". Nachdem er sich die alte Theorie bis in die letzten ausgetiftelten Möglichkeiten zu eigen gemacht hat, legt er 1861 die berühmte Prüfung ab, bei der einer der Prüfenden, Herbeck, es aussprach: "Er hätte uns prüfen sollen!" Und schließlich begibt er sich mit siebenunddreißig Jahren noch einmal in eine Lehre, zu dem zehn Jahre jüngeren Theaterkapellmeister Otto Kitzler in Linz. Dieser führt ihn in die neuere Kompositionslehre und das fortschrittliche Schaffen ein, vor allem in den "Tannhäuser" – und gibt damit den wesentlichsten Anstoß zu dem endlichen Aufbruch genialer Schaffenskraft und damit zu der großen Lebenswende. Diese Wende ist "die seltsamste in der Geschichte der schaffenden Künstler". Ein fast vierzigjähriger Musiker wird durch das Erleben einiger neuer Werke so bis an den Grund seines Wesens erschüttert, daß plötzlich geniale Schaffenskraft in ihm aufbricht und nach wenigen Ansätzen Schöpfungen hervorbringt, in denen sich die Höhe und Eigenart seines späteren Stiles bereits voll ausprägt. Es sind die drei Messen in d, e und f und die Erste Symphonie in c. Denn zwar hat Bruckner auch vorher komponiert. Eine nicht geringe Anzahl kirchlicher und weltlicher Werke sind uns erhalten. Aber sie erheben sich an Bedeutung und Eigenart kaum über den Durchschnitt landkirchlicher und Biedermeiermusik. Es sind mit wenigen Ausnahmen kleinere Stücke, zumeist wenig inspirierte Gebrauchsmusiken; und keineswegs schreitet sein Schaffen vom frühesten Jugendwerk zum ersten Meisterwerk in einem stetigen Aufstieg hinan, sondern die Kurve schnellt plötzlich empor. Der Organist, der noch vor wenigen Jahren Dorfschullehrer gewesen war, wird einer der größten deutschen Meister. Er erhebt sich auf den Gipfel deutscher Musik und dringt aus der Rückständigkeit seines heimatlichen Musiklebens zur lebendigsten Gegenwart vor. Und erst jetzt, mit diesem Aufstieg zum Gipfel und dieser Befreiung zur Gegenwart werden auch die urständigen Gefühlsgründe seines Wesens schaffenskräftig, die bisher stumm waren. Den Anstoß gab das Werk Wagners. Aber die Größe der Wirkung wurde nur dadurch möglich, daß Bruckner durch seine Musiktheorie, sein Improvisieren, sein inneres Erleben ihr entgegengereift war und durch ungeheure Arbeit sich zu ihr hin gesteigert hatte. Dennoch mußte das Geschehen wie eine Katastrophe über ihn hereinbrechen, zumal sich im selben Zeitpunkt auch in anderen Lebenskreisen die Spannungen bis zur Krise verschärften. Bruckner dringt in eine Welt von Werken ein, die ihm bisher verschlossen war, in Werke von Berlioz, die Faustsymphonie Liszts, die Neunte Beethovens; und er, der einsame Hinterwäldler, lernt seinen nun vergötterten Meister und viele seiner [144] Freunde persönlich kennen und spürt an dem Gegensatz deutlicher als je zuvor die Enge seiner bisherigen Umwelt. Es drängt ihn hinaus, irgendwohin, wo er seine Schöpferkraft frei entfalten kann und wo man ihn anerkennt. Er hört, bis ins Tiefste erschüttert, die Uraufführung des Tristan. Und kurz darauf (1866) erfährt er, der von Frauen so oft Mißachtete, eine seiner bittersten Enttäuschungen, die Absage der Josephine Lang. Im selben Jahr steigert sich überdies der Gegensatz zu den "Krähwinckler-Charakteren" seiner Linzer Umgebung zum Höhepunkt. Er bewirbt sich um die ausgeschriebene Chormeisterstelle und wird abgewiesen. Intrigen entzweien ihn mit einem seiner wenigen Freunde. Bereits 1864 schreibt er, er "leide schon längere Zeit wieder an schrecklicher Melancholie". Und als nun alle Spannungen sich so verschärfen und noch dazu die Folgen der langjährigen Überarbeitung sich einstellen, kommt es zu einer Nervenkrise, über die Bruckner selbst berichtet: "Es war gänzliche Verkommenheit und Verlassenheit – gänzliche Entnervung und Überreiztheit... Dr. Fadinger kündigte mir den Irrsinn als mögliche Folge schon an. Gott sei's gedankt! Er hat mich noch gerettet." Wahrscheinlich ist es in der Tat nicht nur die Wasserkur in Kreuzen, die ihn vor dem Los bewahrte, dem andere große Geister gerade dieses Jahrhunderts verfielen. Die Werke dieser Zeit sind ein erschütternder Ausdruck seiner religiösen Krise und Heilung.
Die Zahl der reifen Werke Bruckners – zu den genannten kommen noch eine Reihe kleinerer geistlicher und weltlicher Vokalwerke (unter diesen namentlich "Germanenzug" und "Helgoland") – ist demnach geringer als die Werkzahl anderer Meister. Doch sie ist groß im Verhältnis zu ihrem Umfang, dem gedrängten Reichtum ihres Inhaltes, ihrem kunstvollen Gefüge und angesichts der Schaffensweise Bruckners: die Skizzen zeigen, wie er feilt und durchstreicht und nochmals feilt und so oft erst nach vielen Versuchen Teile des Ganzen vollendet – und nach einiger Zeit, oft nach vielen Jahren, pflegt er das Werk noch einmal umzuarbeiten. Und sie erscheint groß, bedenkt man seine Spätreife, seine Krankheit und die übrige Arbeitslast. Seine Mitbürger, die so viel Geld für andere Dinge ausgeben, gewähren ihm nicht das wenige, das er für seinen bescheidenen Lebensunterhalt braucht. Er muß kostbare Zeit für seine Lehrtätigkeit verwenden (vorübergehend dient er beispielsweise als Klavierlehrer an einem Lehrerseminar) und für Bewerbungen, die fast sämtlich erfolglos bleiben. "Eine Symphonie, meine ich, hätte ich in der Zeit schreiben können, die ich in ganz unnützer Weise hier zu solchen Zwecken verlaufen bin", schreibt er 1875. Und zehn Jahre später: "Außer den vielen Schulstunden am Wiener Conservatorium muß ich auch noch Privatunterricht in der Musik erteilen, so daß mir nur sehr wenige Erholungsstunden zur Composition übrig bleiben." Die Spannungen zwischen Bruckner und seiner Mitwelt waren schon vorher zahlreich; nun aber, in Wien, verschärfen sie sich noch. Er verschließt sich zwar nicht in Trotz und Stolz, sondern es drängt ihn nach Ehre, Freundschaft, Geselligkeit. Aber gerade darum ist er leicht verwundbar und empfindlich, mißtrauisch und schwermütig. Es mangelt ihm an weltmännischer Gewandtheit, Konversationsbildung und großbürgerlichen Umgangsformen. Und in geschäftlichen Dingen ist er, wie er bekennt, "unwissend wie ein Kind". Er ist das genaue Gegenteil eines erfolgstüchtigen und kurz entschlossenen Willensmenschen. Die Eigentümlichkeiten seiner genialen Künstlernatur erscheinen den Leuten (und auch anderen Künstlern) als närrisch. Man belächelt die altväterische Tracht, "die der Schneider von Sankt [147] Florian aus schwarzem Bauernloden für ihn baute"; Josephine Lang weist ihn ab, weil er ihr zu alt und linkisch und "weil er immer so narrisch an'zog'n war". Den Großstädtern erscheint dieser Provinzler wunderlich und andererseits zu gewöhnlich, zu bieder, zu unscheinbar für einen genialen Künstler. Der "Mangel an Bildung", die "etwas altväterisch submissen Ausdrücke des Respectes" und namentlich seine Frömmigkeit und das religiöse Gepräge seiner Werke gereichen den Freisinnigen zu Spott und Ärgernis. Dazu kommt noch die Schwerfaßlichkeit und Neuartigkeit seiner Musik und als wichtigste Ursache seines Martyriums der Widerstand herrschender Kreise des Musiklebens gegen ihn und die Richtung, der er vermeintlich angehört. Die konservative Partei um Brahms und Hanslick sah in einer teils tragischen, teils bösen Verkennung an dem eigentümlichen Gehalt dieser Musik vorbei. Dieser Hinterwäldler schien Wagners an sich schon verfemten Stil in das geheiligte Gebiet der Symphonie zu übertragen. Unglücklicherweise gehörte die Mehrzahl der in Wien maßgebenden Musiker und Kritiker zu dieser Partei. Sie bekämpften ihn mit allen Mitteln, mit Schimpfwörtern und Verdächtigungen, sie nahmen das bildungsbürgerliche Publikum, das Bruckner an sich schon abgeneigt war, vollends gegen ihn ein und versperrten seinen Werken den Zugang zur Öffentlichkeit. Die Zahl der Aufführungen und Notenausgaben ist zumal vor 1885 gering (und das einzige Druckhonorar, das Bruckner je erhielt, waren fünfzig Gulden für das Tedeum). Darum bekamen nur wenige Zeitgenossen Werke von Bruckner jemals zu hören.
 |