 |
[Bd. 2 S. 246]
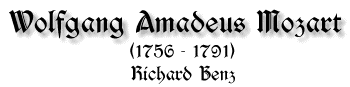
Es ist die untergehende Sonne des Barock und seiner hohen höfischen Kultur, deren letzter Schein diese Doppelszene vergoldet. Glucks Spätwerk schon steht in dem kühleren Licht eines neuen klassischen Tags, in dessen reine Menschlichkeit er [247] den Mythos des Barock als letzte Geist-Gestaltenwelt herüberrettet. Sein Erbe Mozart aber wird noch einmal das innere Wesen dieses Barock beschwören – nicht seinen Mythos, nicht sein Ideal: aber seinen Alltag, seine Wirklichkeit von Menschen-Lust und ‑Leid, und wird es zur zeitlosen Göttlichkeit des Lebens selbst verklären. Neben der geschichtlichen Macht: dem Gesetz von Grund und Folge, thront höher der metaphysische Sinn: der scheinbar sinnlose Sinn, der Geister auswählt und beruft, indem er ihr Leibliches kreuzigt und vernichtet: der Völkern Künste schenkt und wunderbare Taten, und doch ihr Auge dafür mit Blindheit einhüllt. Das unwahrscheinlichste Schicksal hat Mozart gehabt. An ihm wird uns mit Schaudern offenbar, welches notwendige Opfer an den höheren Sinn die Sinnlosigkeit eines Erdenlebens bedeutet. Fast muß uns Scham ergreifen, sollen wir berichten, wie ein Liebender des Lebens nicht Liebe des Lebens empfing. Und doch war Eingehen in allen Wahnsinn, Not und Tod, den diese Erde hat, Bedingung, das Zeugnis von der ewigen Schönheit und Herrlichkeit des Seins über alle denkbaren Zweifel zu erhöhen. Man hat auch dieses Leben nach Grund und Folge zu betrachten versucht und hat erweisen wollen und für vernünftig-nüchternes Verstehen auch erwiesen, daß bei einem Charakter wie dem seinen und bei einer Erziehung wie der seinen es nicht gut anders kommen konnte, als es kam. Nur eines ist in diese Rechnungen nicht eingestellt: das Überweltliche, der Dämon: der es auch so haben wollte, wie es ja erging; dessen Walten aber das irdische Urteil aufhebt und verbietet, da er des Menschen-Maßstabs in dem Sinne spottet, den Goethes Weisheit meint, da ihm, beim Anblick Mozarts und seinesgleichen, das tiefgeheime Wort sich auf die Lippen drängt: "Der Mensch muß wieder ruiniert werden"; das ihm den frühen Untergang des Großen durch das "natürliche" Spiel des Dämons erklärt. Ja, es ging alles höchst natürlich zu im Dämon-Sinn: denn jede göttliche Gabe wurde mit einer menschlichen Niederlage und Einbuße bezahlt, bis das natürliche Leben im sittlich-bürgerlichen wie im körperlichen Betracht so unterhöhlt war, daß es das lastende künstlerische Werk nicht mehr trug. Gleich jene erste Szene am kaiserlichen Hofe in Wien hat das Nachspiel gehabt, das nun bei jeder dieser der Natur zu früh abgerungenen Kunstreisen wiederkehrt: Mozart wurde krank – ein Scharlachfieber warf ihn nieder, wie auf der nächsten Reise nach Paris und London der Typhus mit immer neuen Rückfällen ihn heimsucht. Aber das sind nur die sichtbaren Krisen, wo die Natur sich deutlich hilft, wenn sie die Geistesanforderung nicht mehr erträgt – was die gesamte Organisation an Anstrengungen und Spannungen innerlich hergeben mußte, ohne in Ruhe und Krankheit sich flüchten zu können zum Ersatz, das eben hat jene fortwirkende Zehrung und Schwächung begründet, die dann, als auch noch wirkliche Entbehrung, Sorge, Hunger hinzukommt, dem nun zum Höchsten gerade sich entfaltenden Geist den Körper-Dienst versagt. [248] Aber das unwahrscheinliche Tempo dieses Lebens ist nicht bloß äußerlich rasender Verlauf – man bedenke, daß nur neun Jahre die Reihe der Meisterwerke von der "Entführung" bis zum "Requiem" umfassen – es ist zugleich innerlich verzehrender Trieb: von dem ersten entscheidenden Werkzeug des Dämons, dem Vater, wohl geweckt, aber durch die frühe Gewöhnung an unablässige Arbeit zur Rastlosigkeit der Nerven und des Bluts gesteigert: von dem allzukurzen flüchtigen Schlaf, den dieses innere Triebwerk sich gönnt, bis zu dem ewigen Umgetriebensein in Tanz, Geselligkeit und Menschenberührung, bis zu dem ewigen Tätigsein und Regen des immer Beweglichen, dem niemals ruhenden Spiel der Hände, die mit Gegenständen vibrieren, wenn keine Tasten des Klaviers erreichbar sind. Wie hier ein Übermächtiges, Fremdes Herr geworden ist über ursprüngliche Anlage und Natur, das erweist jenes oft bezeugte Zurückfallen in dumpfes Träumen und Dämmern innerlich, in Beschaulichkeit, Bequemlichkeit und Unentschlossenheit in Dingen des Lebens, wenn der gebietende äußere Zwang einmal schweigt. Wäre er vielleicht eines von den stummen, unerkannten Genies geworden, die sich nicht durch Werke offenbaren, wenn nicht die frühe Erkenntnis und Zucht seines Talents durch den Vater sein Wesen zu dauernder Äußerung gedrängt hätte? Noch aus der höchsten Schaffenszeit ist uns ja überliefert, wie er ungern und nur gezwungen schrieb, wie er seine Musik so lange wie möglich träumte und viele sicherlich für sich geträumt hat, die er niemals niederschrieb. Es ist sein ausdrückliches Geständnis aus dem letzten Jahr, daß er, im Gefühl schon des herannahenden Endes, sich wirkliches "Arbeiten", und das heißt bei ihm: wirkliches systematisches Niederschreiben, auferlegt. Zu dieser ursprünglichsten genialen Anlage: der Kontemplation, der völligen Versunkenheit, Versenkungsfähigkeit, die alles im Grunde nur als Spiel für sich treibt, aber auch ganz und einzig bis ins letzte in diesem Spiele aufgeht, kommt jenes andere: die zarteste Empfindlichkeit, Empfänglichkeit gegen jeden Reiz von außen, die unglaublichste Einfühlkraft in jedes fremde Ding und Wesen – sie hat ihn nicht nur zum allseitigsten Beherrscher jeder Art und jeden Stils in seiner Kunst, sondern zum stets verwandlungsbereiten und dämonisch verwandlungsfähigen Menschenergründer und Menschenschöpfer gemacht. Der Salzburger Hoftrompeter Schachtner, dem wir die genaueste Schilderung des Kindes Mozart verdanken, spricht etwas sehr Tiefes aus, wenn er schreibt: "Er war voll Feuer, seine Neigung hing jedem Gegenstand sehr leicht an; ich denke, daß er im Ermanglungsfalle einer so vorteilhaft guten Erziehung, wie er hatte, der ruchloseste Bösewicht hätte werden können, so empfänglich war er für jeden Reiz, dessen Güte oder Schädlichkeit er zu prüfen noch nicht im Stande war." Der Vater hat auch diesen Trieb ins praktisch Schöpferische gewendet, durch Anleitung und eigenes Beispiel ihn ins kritisch Auffassende gedrängt und damit seine Empfänglichkeit zu der unheimlichen Menschenbeobachtungskunst gesteigert, [249] der er so viel Unglück im Leben, aber zugleich alle Shakespearesche Darstellungslust am menschlichen Charakter verdankt. Wer war dieser Vater, dessen bewußte Erkenntnis und Leitung aus Mozarts Leben nicht wegzudenken ist? Ist er der starre, herrschsüchtige Pedant gewesen, gegen dessen Bevormundung der Sohn sich schließlich auflehnen mußte, das Verhängnis Mozarts, wie man ihn genannt hat? Oder war er der wohltätig Erweckende und umsichtig Führende, der seltene Erzieher des Genius, dem die Nachwelt die Hälfte des Dankes für eine der größten menschlichen Werkleistungen schuldet? Er war ein Charakter sicherlich und ein kluger Beherrscher und Beurteiler des Handwerklichen seiner Kunst, dem nichts anderes beikommen konnte, als das früh hervortretende wunderhafte Talent des Sohnes zu allem Technischen der Musik in die besten damals denkbaren Bahnen von Erfolg und Ruhm und praktischer Verwertung zu lenken. Er war aus Augsburg gebürtig und trägt wohl deutliche Charakterzüge des schwäbischen Stamms, in welchem mit großer Lebensklugheit und Geisteskraft sich oft eine seltsame Starrköpfigkeit verbindet, und dazu ein empfindliches Mißtrauen gegen andere Menschen, das nicht als Mißgunst sich nach außen wendet, sondern unter vermeintlicher Zurücksetzung, Kränkung und Verfolgung selber am meisten leidet. Eine pessimistische Einsicht ins wesentlich Böse der menschlichen Natur mag durch Weltweisheit der Zeit genährt, jedenfalls durch Erfahrungen verstärkt worden sein, wie sie nicht nur der höfische Dienst darbieten mußte, sondern der sprichwörtliche Künstlerneid beim Umgang mit Sängern, Virtuosen, Komponisten überall bestätigte. An allgemeiner Bildung hat es Leopold Mozart, der anfangs zum Gelehrten bestimmt war und auch eine Zeitlang die Universität besuchte, nicht gefehlt – bezeichnend ist seine Verehrung für Gellert, mit dem er Briefe wechselte: ein so frommer Katholik er war, blieb er doch von der norddeutschen Aufklärung nicht unberührt, wie ihn auch musikalisch manches mit der protestantischen Organistenschule verband. Was ihn vor allem auszeichnete, war sein künstlerischer Ernst, mit dem er nicht nur sein Amt als Konzertmeister und Vizekapellmeister am erzbischöflichen Hof versah, sondern mit dem er auch bei seinen Kindern das Talent als eine göttliche Gabe ehrte, deren man sich nur durch eine hohe Verantwortlichkeit in Ausbildung und Pflege wert mache. Mit seiner Frau, einer einfachen derb-lebenslustigen Salzburgerin, hatte er sieben Kinder, von denen nur die jüngsten beiden am Leben blieben: Maria Anna, das Nannerl genannt, die 1751 geboren wurde, und Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus, der am 27. Januar 1756 das Licht der Welt erblickte.
Es ist, als ob die Ausbildung all der verschiedenen Werkzeuge der Musik, die damals selbst so wunderhaft in kurzer Zeit sich bis auf unsern heutigen Stand vollendete, nur darauf gewartet hätte, daß einer käme, der sie sich alle dienstbar mache. Denn hier ist nicht die oft erlebte Virtuosität auf einem einzelnen Instrument, sondern die Beherrschung aller und ihres sinnvollen Gebrauchs, die wie durch eine geheime Wahlverwandtschaft auf unerklärliche Weise plötzlich da ist. Diese Eroberung des musikalischen Rüstzeugs darf im siebenten Jahre als abgeschlossen gelten: auf der damaligen Kunstreise der Geschwister, die über München, Augsburg, Mannheim führt, ist uns durch eine Anzeige in Frankfurt der ganze Umfang des Könnens vor Augen geführt; es heißt da, der Knabe werde nicht nur ein Violinkonzert spielen und bei Sinfonien mit dem Klavier akkompagnieren, sondern werde auch auf dem Flügel und auf der Orgel, so lange man zuhören wolle, und in den schwersten Tönen, die man ihm benennen würde, "vom Kopf phantasieren". Damals hörte ihn Goethe: "Ich selber war etwa vierzehn Jahre alt", sagt er 1830 zu Eckermann, "und ich erinnere mich des kleinen Mannes in seiner Frisur und Degen noch ganz deutlich." Aber das Ziel der Reise ist Paris und London – und hier beginnt schon eine zweite Epoche: die Zeit des regelrechten Selbstschaffens, das nun zunächst ein ebenso wunderbares Aneignen und Beherrschen der vorhandenen Kompositionsstile darstellt, wie das bisherige Aneignen und Beherrschen des reinen musikalischen Mittels es war. Man hat bis ins einzelnste die Einflüsse nachgewiesen, denen damals der Lernende offensteht, von Schobert in Paris (1763) und Christian Bach in London (1764) bis zu den Wiener Sinfonikern (beim zweiten Wiener Aufenthalt von 1768) und den wirklichen Italienern (von 1770 an), den Mannheimern (seit 1777); und man hat aus der Neigung und Fähigkeit, in immer wechselnde Geistesformen vollkommen unterzutauchen und doch dabei jedem Stil eine eigne neue Vollendung und Schönheit zu schenken, den Schluß auf Mozarts Wesen und Charakter ziehen zu müssen geglaubt, in dem man ihn als "feminines" Genie bezeichnete, das immer nur an einer Anregung von außen entbrannte und dem nichts ferner liege als eine ursprüngliche eigene Sprache eigener innerer Welt. Aber der moderne Trieb, das Wunder zu erklären, kommt hier nicht auf seine Rechnung, und erst recht nicht der Versuch, Mozart in eine zweite Klasse von Schöpfern einzureihen. Denn weiblich kann die Fähigkeit solch unbegrenzter Aufnahme nur genannt werden in dem Sinne, indem jeder Genius dem anschaulichen Eindruck der Welt empfangend offensteht; es kann dies oft bis zur völligen Preisgabe und Überflutung durch Fremdes führen; was ihn von allen bloßen Nachahmern und Epigonen unterscheidet, ist, daß ihn dies nicht umbringt, daß [251] er herrlicher und einzigartig auch dem Ungemäßesten enttaucht. Auch bei Schubert und Beethoven ist es nicht wesentlich anders gewesen; die große und wechselnde Anzahl der Vorbilder bei Mozart ist aber schon durch das kindliche Alter erklärt, in dem er überhaupt bereits schöpferisch zu lernen vermochte. Ja, es ist eher als Zeichen unberührter innerer Gesundheit zu werten, daß er bei aller wunderhaften Frühe seines Könnens den wirklich eigenen und unverwechselbaren Ton erst in dem Alter findet, da auch andere plötzlich ganz sie selber sind – eine wirkliche Frühreife seelischer Selbstverwirklichung hätte sein Leben ohne Zweifel noch viel rascher erschöpft. In Wahrheit lehrt Mozarts besondere Empfangs- und Eindrucksbereitschaft noch etwas ganz anderes: daß er nämlich, wie im Beherrschen aller Instrumente und Musikarten, auch im Stilistischen der schlechthin Universale ist, der deshalb alles in sich aufnimmt, weil er die ganze erschienene Welt der Musik wie kein anderer zusammenfassen und gebrauchen sollte. Waren die einen sonst nur im Sinfonisch-Innerlichen groß, wie Haydn und Beethoven, oder nur im tragischen Kunstwerk der Oper, wie Gluck; hatten jene nur die Form der Sonate erwählt und ausgebildet, andre dagegen, wie Bach und Händel, die Fuge und kontrapunktische Polyphonie und das kirchliche Kunstwerk: so sehen wir Mozart fast überall gleich herrschend und groß, als den Ersten, der über alle Welt- und Willensstimmen einer neuen Sprache der Menschheit gebietet. Und er lernt nicht nur; er nimmt auch voraus, was nach ihm erst sich ganz entfalten sollte. Wenn Christian Bach in seinen ersten Sinfonien lebt und italienische Schönheit im Gebrauch der Menschenstimme noch in seinen Meisteropern unverloren ist, so hat er doch auch, in Quartett und Quintett, die Schwermut und Erdenferne des späten Beethoven zuzeiten beschworen und in der Phantasiesonate Schuberts Seelentöne angeschlagen. Die Zeitgenossen haben das viel deutlicher gespürt als wir, die wir die Klänge späterer Meister zu gewohnt sind – ihnen galt er als der große Revolutionär, der kühne Neuerer, ja Romantiker, dessen dämonischer Ausbruch oft erschreckte und alle überlieferte bloße "Schönheit" in Frage stellte. Und hier müssen wir vor allem seines Deutschtums gedenken, das ihm als Allererstem ein bewußtes und erwähltes Leitbild war. Er war der letzte große Meister, der lernend in die Fremde ging, und war zugleich der erste, der die Möglichkeit eines deutschen Kunstwerks sah und sie so stark auch in dem, was uns heute noch südlicher Herkunft dünkt, verwirklichte, daß er gerade den Italienern immer am fremdesten geblieben ist. Die Römerzüge der deutschen Kunst hören nach ihm auf; aber er selbst hat alles noch in Besitz genommen wie der heimliche Kaiser eines Römischen Reichs Deutscher Nation. Und noch in einem andern steht er auf der Scheide der Kulturen: er ist der letzte im höfischen Dienst des Barock; und ist der erste, der sich in Kampf und wilder Auflehnung aus ihm befreit. Fast hat das empörende Schauspiel der Mißachtung und Versklavung des Künstlers, die ein enger und starrer Fürst hier auf die Spitze trieb, für immer uns das [252] große und leuchtende Bild des Mäzenatentums verdunkelt, aus dem doch unsere Kunst Musik ursprünglich einzig lebte. Auf beiden Seiten war hier plötzlich etwas anders geworden, am Vorabend der Französischen Revolution. Mozart hat auch hier den Weg bereitet; wenn auch noch als Opfer für ein Ziel, das erst Beethoven erreichte: der Selbstherrlichkeit des freien Künstlers hat sich erst in ihm die Welt gefügt. Leopold Mozarts Reisen mit seinen Kindern waren [nicht] bloß Urlaubsreisen und wurden ihm in Salzburg bald genug verdacht. Denn auch das ist wichtig und bedeutsam, daß kein Fürst es selber war, der als Entdecker und Förderer Mozart in die Fremde schickte, wie es Unzähligen vorher und noch Gluck geschah – der Vater hat es alles auf eigene Rechnung und Gefahr getan; und da darf es uns auch nicht wundernehmen, wenn in seinen Briefen der Geldverdienst eine breite Stelle einnimmt und der bloßen Ehre oft fast höhnisch gedacht wird, wenn die materielle Ernte ausbleibt. Wohl hält der Vater sich vorwiegend an die Höfe, die überall noch Mittelpunkte musikalischen Lebens sind, sucht sich womöglich nur mit "Standespersonen" einzulassen; aber solange es sich ums Lernen handelt, wahrt er die freie Wahl der Orte zu planmäßiger Kenntnisnahme dessen, was sie bieten können.
Für uns bedeuten diese italienischen Reisen noch eine andere Bereicherung: hier ist es, wo in seinen Briefen die Fülle der Selbstzeugnisse beginnt, wie wir sie so und aus so früher Jugend von keinem anderen besitzen. Da tritt der Vierzehnjährige uns schon mit allen den Eigenschaften entgegen, die wir am reifen Manne wiederfinden: mit einem unbeirrbar sichren, fast mitleidslosen Urteil, das schlagend mit wenig Strichen Kunst und Mensch charakterisiert; dazu mit einem Humor und hemmungslosen Übermut, der sich der Sprache scheinbar nur zu Wortspielen und Verdrehungen bedient. Es gibt nur einen großen Deutschen, bei dem wir dies wiederfinden, und der bezeichnenderweise italienischer Blutmischung entstammt: Clemens Brentano hat ähnlich mit Reim- und Wortgeklingel und ewigem Scherz und Narrenspiel im Leben ein Tieferes zu hüten gewußt, was seiner Kunst sonst schmerzlich-melancholisch entströmte. Für Mozart war es die einzige Berührung mit der Welt, die einem Geiste möglich war, der im Leben das Spiel und in der Kunst allein den Ernst erblickte, und doch mit ernstester Kunst das Spiel der Welt verherrlichen mußte. Noch vom späten Mozart wird uns immer wieder die Beobachtung bezeugt, daß er "nie weniger in seinen Gesprächen und Handlungen als großer Mann zu erkennen war, als wenn er gerade mit einem wichtigen Werk beschäftigt war" – er ist dann schlimmer noch als sonst zu Späßen, Hanswurstiaden, ja Frivolitäten aufgelegt; sucht und erträgt womöglich nur Menschen einfachster Art, die in denkbar weitester Entfernung zu dem ihn innerlich Bewegenden stehen müssen. Im Grunde hat er – Haydn ausgenommen – nie einen Freund und geistig Vertrauten gehabt, dem er ein Wort über sein inneres Leben schuldig gewesen wäre – er vermißt das nicht, er bedarf dessen nicht, er hat sich nie im Leiden an innerer Einsamkeit, in Sehnsucht nach Verständnis verzehrt. Man kann es zuletzt nicht Einsamkeit nennen, worin er eingekerkert lebt, sondern bloßes notwendiges Fürsichsein, wie es niemals wieder so rein in irdischer Hülle da war: wenn je ein Mensch, so war er sich in seinem Geist genug; wenn auch sein Leibliches nach dauernder Gemeinschaft mit andern: Gesellschaft, Tanz und Spiel und Liebelei verlangte. Er brauchte die gleichgültige Menschenbrandung um sich herum, um den Sturm des Innern auszuhalten in dem Maß, daß er später oft nur niederschreiben konnte, wenn seine Frau ihm Märchen erzählte oder wenn man um ihn scherzte, spielte, sprach und er sich ruhig wie ein anderer daran beteiligte. Welcher Sterbliche vermag die Welt sich vorzustellen, in der er wirklich und einzig lebte! Wir ahnen nur, daß die höhere Sprache der Töne hier zu einer solchen Hoheit und Unberührbarkeit in einem Menschen aufgestiegen war, daß alles Alltagswort dagegen nichts mehr wog, nichts anderes als Scherz und Narretei bedeuten konnte. Aber ein solcher verliert dann auch das Maß für das, was er noch spricht, versteht [254] nicht mehr, was Worte wirken können – so hat dieser Gutherzige, Menschen-Liebende, Edle, Ritterliche mit scharfem Urteil, schlagender Antwort, treffender Ironie oft, ohne es zu wollen und zu wissen, Menschen tief gekränkt und sich verfeindet, und mancher spätere Mißerfolg ist auf diesen ahnungslosen Freimut zurückzuführen. Dem Wunderkinde ließ man dergleichen hingehen, es konnte eher noch als ein Reiz mehr an ihm gelten; und der kluge und weltgewandte Vater, insgeheim selber scharf und aburteilend genug, mochte äußerlich noch mildern und ausgleichen. Aber die italienischen Reisen waren die letzten großen Reisen mit dem Vater. Er begleitet ihn noch nach Wien im Jahre 1773, erlebt mit ihm im Januar 1775 den großen Erfolg der "Finta giardiniera" ("Gärtnerin aus Liebe"), der ersten geglückten Opera buffa, in München. Aber aus Salzburg ist unter dem neuen Erzbischof nicht mehr leicht fortzukommen – auch der Sohn Mozart war ja seit der italienischen Reise als Konzertmeister hier angestellt – auf der letzten großen Reise in die Fremde, zu der es Mozart aus den engen Salzburger Verhältnissen drängt, kann der Vater nicht mehr mit ihm sein, und er selbst muß förmlich seinen Abschied aus dem Hofdienst nehmen, um wegzudürfen – die Mutter begleitet ihn jetzt allein, damit sein weltfremdes und unpraktisches Wesen in etwas behütet sei. Und es zeigt sich, daß das nötig ist: nach den derben Tändeleien mit dem "Bäsle" in Augsburg verliert er sein Herz an Aloysia Weber in Mannheim und plant mit ihr die abenteuerlichsten Dinge: will mit ihr und ihrer ganzen Familie, der es schlecht geht, nach Italien, im Vertrauen auf sein Talent, das sie schon durchbringen wird; und nur die strengen Briefe des Vaters, der von der Mutter geheim ins Bild gesetzt wird, vermögen ihn, dergleichen aufzugeben und schließlich dem Ziel der Reise, Paris, sich zuzuwenden. Aber auch hier erweist sich, daß er ohne die betriebsame Lenkung durch den Vater äußerlich nicht vorankommt; Empfehlungen nützen ihm wenig, er lehnt sich gegen die unwürdige Behandlung in den adligen Häusern auf, und vermag schon wegen des Streites um Gluck, der damals alles in Atem hält, sich nicht durchzusetzen. Der Glanz des Wunderkinds ist auch für seine Gönner, wie Grimm, verblaßt, und der "andere" Mozart hat sich ihnen noch nicht erwiesen – die einzige Frucht des Aufenthalts wird das Ballett "Les petits riens", das der berühmte Tanzmeister Noverre bei ihm bestellt. In Paris, in der Fremde, muß ihm 1778 die Mutter sterben. Wie nahe liegt es, jetzt in Selbstvorwürfe und Verzweiflung auszubrechen; denn für ihn ging sie doch mit. Aber da zeigt sich plötzlich, aus welchen Tiefen dieser Jüngling lebt: er ist es, der den Vater schonen muß, ihn langsam und mit falschen Nachrichten auf das Geschehene vorbereitet. Man liest zwar, wie furchtbar es ihm ist, die Mutter sterben zu sehen, ihm, der noch niemand sterben sah – aber für den Vater kommt Trost aus seinem Mund, er findet Worte des Vertrauens in die ewige unabänderliche Ordnung des Seins, die uns ahnen lassen, wie dieser Sorglos-Heitere im Innersten dem Tode nahe und befreundet lebt.
Aus all den Kämpfen, die der nun ganz auf sich Gestellte führt, taucht das erste Wunderwerk ewiger Jugend empor: die "Entführung" – das erste ganz persönliche und innigst deutsche Werk, das einen Umsturz in unserm ganzen Verhältnis zur Musik bedeutet – sie wurde am 16. Juli 1782 unter gewaltigem Beifall aufgeführt und ging bald über alle deutschen Bühnen. Goethe bezeugt es in seiner Italienischen Reise, da er seiner eignen Bemühungen um ein deutsches Singspiel gedenkt – es war damit zu Ende, "als Mozart auftrat. Die Entführung aus dem Serail schlug alles nieder". Sie ist bräutliche Huldigung ans Leben – noch heute schimmert durch alles Ferne, Märchenhafte die Liebe des Genius hindurch, die er einem sterblichen Weibe weihte; und die vielleicht nicht einmal erwidert ward – und die ihn doch in seinem Irdischen beglückte und erlöste; die ihn dämonisch ganz auf sich stellte, auf seine ganze Unfähigkeit nicht zur Kenntnis, sondern zur Berechnung der Welt, in welcher er mit seinen göttlichen Gaben allein sein irdisches "Glück" zu machen gedachte und eine Familie gründen wollte wie ein andrer Mensch. Wer wollte mit der Frau rechten, die ihn an sich zog, die sich wohl auch ein anderes Leben von seinem Talent versprach, und der nur das Wichtigste für eine solche Ehe [256=Faksimile] [257] gebrach: besonnen-wirtschaftende Frau zu sein, die ihm die Fürsorge von Vater und Schwester hätte ersetzen können. Zu sehr war sie ihm selbst verwandt in ihrer Gleichgültigkeit gegen die äußeren Dinge, gegen die Gesetze dieser Welt des Bedürfnisses und der Not – leicht hat sie es selber nicht gehabt in dieser Ehe, in deren kurzer achtjähriger Dauer sie sechs Kinder gebar. Und war sie ihm die geistige Gefährtin nicht, die sein höherer Mensch im Grunde nicht brauchte, so ist sie ihm doch die heitere Gesellin gewesen, deren warme Nähe er kaum auf Wochen mehr entbehren mochte. Es war die fruchtbare Erde, aus deren Berührung dem Genius immer wieder die Kraft kam, die ganze tiefe Wahrheit des Lebens auszusagen: auch die wissende Wahrheit vom Blühen und Vergehen der Liebe, vom ganzen göttlich-grausamen Liebesspiel der Welt. Und die elende, unablässige Sorge ums Dasein, um Geld und Brot für Weib und Kind – sie hat ihn vielleicht erst fähig gemacht, das große Fest des Lebens zu schildern, wie es sonst nie gekündet und gestaltet worden ist. In den ersten Wiener Jahren hat Mozart noch viel öffentlich gespielt, und auch seine Einnahmen waren nicht gering, zur Befriedigung des Vaters, der sich noch ausrechnete, wieviel tausend er jetzt auf die Bank tragen könne. Aber seit dem "Figaro" wandelt sich Mozarts Sinn, eine neue ernstere Leidenschaft des Schaffens kommt über ihn, die es ihm immer unmöglicher macht, sich im virtuosen Auftreten zu verzetteln. Das ist mit ein Grund des wirtschaftlichen Niedergangs gewesen, wenn nicht schon die vielen kostspieligen Krankheiten Konstanzes, die ewigen Umzüge, dazwischen noble Passionen oder gutherziges Verschenken und Verleihen genügen mochten – denn Tantiemen, auch von erfolgreichen Stücken, gab es damals nicht; mit einer Bezahlung am Ort der ersten Aufführung war eine Oper für immer entlohnt. Bis zum "Figaro" noch finden wir Mozart viel mit Klavierkompositionen befaßt; allein die fünfzehn großen Klavierkonzerte entstehen jetzt; auch Bachs Einfluß macht sich geltend in den Fantasien mit Fugen; die c-moll-Messe steht noch unter seinem Eindruck, die Mozart bezeichnenderweise schreibt, um ein Gelübde zu erfüllen, das er in der Krankheit seiner Frau getan hat, oder gar schon früher, in dem Bangen, ob sie ihm zuteil wird.
[258] Das "Deutsche Nationaltheater", von dem sich Mozart seit dem Erfolg der "Entführung" so viel versprach, war gescheitert; er mußte sich wieder der italienischen Oper bequemen, wollte er nicht von der höchsten Drama-Wirkung seiner Musik ausgeschlossen sein. Aber was er am "Figaro" Da Pontes leistet, der ihm das Lustspiel Beaumarchais' zur Opera buffa bearbeitet, das ist noch größere Revolution: er wagt es, das Scherzspiel festgelegten Schemas mit lebendigen plastischen Gestalten zu erfüllen und Gesang der Herzen aus den komisch-parodistischen Masken ertönen zu lassen – ein allverstehender Schöpfergeist erschafft aus dem bedenklichsten Alltag bloßen Zeitgeschehens die zeitlose Mythologie der Liebe selbst; ja er vermag es, diese Zeit, die ganz real geschaute Welt seines Rokoko, in den Mythos eingehen zu lassen: als menschliche Gesellschaft in ihren Wirren, ihrem Treiben, wie sie immer war und immer sein wird. Nicht in Wien, in Prag hat 1786 der "Figaro" seinen größten Erfolg; und für Prag schreibt Mozart 1787 eine zweite Oper und tut den kühneren Schritt, die Buffa mit dem Geist des Tragischen zu erfüllen: "Don Giovanni" steht mehr noch als "Figaro" da als Werk eigener Gattung, für die es nichts Vergleichbares gibt. Nicht wie bei Gluck aus einem einfachen Gegensatz von Tod und Leben, von Bedrohung und behauptetem Sinn hat sich ihm die Tragödie geformt – wie unversehens wächst aus zahllosen schillernden Zügen lebendig wahr die wirkliche Gestalt, an deren Schöpfung das vibrierende Orchester aller Seelenregung den gleichen Anteil hat wie die tönende, in immer neuen Menschenwesen lebende Stimme. Und es erscheint als tragischer Sinn eine Kraft-Bejahung des Lebens und aller seiner Lust und Schmach und Schuld – hingestreckte Dämon-Hand dem Rachegeist – daß Mythen und Religionen vor dieser liebenden Daseinsfrömmigkeit zu verblassen scheinen. Aber hinter dem überlegenen Spiel süßer Verführungsklänge und Höllenakkorde steht der Tod, nicht als Drama-Schluß erdacht, sondern als nahendes Ziel des Lebens schaudernd schon geahnt. Im Jahre des "Don Juan" stirbt Mozarts Vater; drei Wochen zuvor hat ihm der Sohn geschrieben: "Da der Tod (genau zu nehmen) der wahre Endzweck unsres Lebens ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem wahren besten Freunde des Menschen so bekannt gemacht, daß sein Bild nicht allein nichts Schreckendes mehr für mich hat, sondern recht viel Beruhigendes und Tröstendes! Und ich danke meinem Gott, daß er mir das Glück vergönnt hat, ihn als den Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit kennenzulernen. – Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, daß ich vielleicht (so jung als ich bin) den andern Tag nicht mehr sein werde – und es wird doch kein Mensch von allen, die mich kennen, sagen können, daß ich im Umgange mürrisch oder traurig wäre." Der dramatische Atem des "Don Juan" hat dann das höchste Drama auch im Symphoniker Mozart hervorgetrieben: in dem begnadeten Sommer 1788 entstehen in drei einander folgenden Monaten, Juni-Juli-August, die drei letzten Symphonien: es-dur, g-moll, c-dur-Symphonie – nur zu fassen als eine [259=Faksimile] [260] einzige große Trilogie. Wer sie je in einer Folge gehört hat, der weiß, daß diese Form Mozarts, die so allein der Form Beethovens gegenüber sich behaupten, nicht einem Programm oder theoretischen Experiment entstammt, sondern aus einer Seelen-Spannung geboren ist, die in ihrer Fülle und Vielfalt kaum begreiflich scheint: da jeweils vier blühend reiche Akte seelischen Geschehens: als beglückte Welt, als umdüsterte Welt, als frei-gelöst-triumphierende Welt, unerschöpfliche Spiegelungen des gleichen Wesens zusammenfügen, das in der einen überlieferten Form der Handlung sich nicht mehr genügte.
Die erschütternden Briefe an seinen Freund Puchberg, den er immer wieder um Geld und Geld anfleht, lassen ahnen, welche Verhältnisse er bei seiner Rückkehr in Wien vorfand; und die Briefe an seine Frau, die damals in Baden bei Wien zur Kur ist und der er ihr leichtfertiges Wesen vorwerfen muß, machen es gewiß, daß zu dem materiellen Elend noch schlimmster Seelenschmerz kam. Und was ist die Antwort des Genius in ihm auf all die Marter und Erschütterung? – die überlegenste philosophische Musik, die je einem Liebenden des Lebens gelang! Ein letzter Auftrag des Kaisers Joseph II. hat ihm "Così fan tutte" zum Text einer Opera buffa gegeben – und da steht nun in leichten schmeichelnden scheinbar glatten Weisen die Tat der Erkenntnis da: alles Dasein in seinen letzten Trieben ganz durchleuchtend spricht lächelnd-verzeihendes Denkertum. Es ist nicht mehr tragische Gestalt, leidenschaftlich-lebenswirklich geformt, sondern der Mensch als bloße Maske durchschaut – alle nur sind Masken des einen gierig-glühenden Lebenswillens, vor dem die Begriffe Treue und Untreue wesenlos sind, der als das Eine in allen alle Kreatur dionysisch berauschend umarmt.
Aber während die unvergänglichen Weisen nun endlich die Herzen der Menschen wirklich treffen und eine Aufführung nach der andern den einmal erreichten Triumph des Genius verkündet, liegt Mozart zum Sterben hingestreckt, den bitteren Todesgeschmack schon auf der Zunge. Er ist noch einmal, schon schwerkrank, nach Prag gefahren, seinen lieben Pragern, den einzigen, die ihn bei Lebzeiten erkannten, zur Krönung Leopolds II. seine "Clemenza di tito", auch ein Werk der verzeihenden Güte, aufzuführen. Rastlos schafft er weiter; auf der Reise, nach der Rückkehr: er will das Requiem vollenden, das der geheimnisvolle Unbekannte bei ihm bestellt hat und von dem er weiß, daß es die eigne Totenmesse sein wird. Am Tag vor seinem Tode verfolgt er fiebernd noch im Geist die "Zauberflöte", die eben wieder über die Bühne geht, mit der Uhr in der Hand – jetzt kommt die Königin der Nacht – jetzt singt Papageno: "einmal möchte ich doch noch meine Zauberflöte hören" – und er summt sein Lied leise vor sich hin. Noch versucht er am Requiem zu arbeiten, zu diktieren; aber im Lacrymosa verläßt ihn die Kraft; er muß bitterlich weinen und legt die Partitur beiseite. Die Ärzte wissen keinen Rat; man behandelt ihn auf Gehirnentzündung und verordnet ihm kalte Umschläge auf den Kopf, die ihn so erschüttern, daß er das Bewußtsein verliert. In wirren Phantasien scheint ihn immer noch das Requiem zu beschäftigen; er versucht noch mit dem Munde die Pauken nachzuahmen. Nach Mitternacht am 5. Dezember 1791 ist es zu Ende. Klar und gefaßt hatte er dem Tode entgegengesehen – und wollte doch ungern scheiden: ein paar Tage vor seinem Tode hatte der ungarische Adel ihm tausend Gulden jährlich angetragen, und von Amsterdam kam noch ein günstigeres Angebot, das aller Not ein Ende gemacht hätte. Kaum glaublich ist, was bei seinem Begräbnis sich ereignet: der Musik-Gönner Van Swieten bringt es über sich, den Rat zu geben, wegen der großen Dürftigkeit Mozart in einem Armengrab beizusetzen, das zwanzig und mehr Särge faßt. Da läßt man ihn einsam hinab; denn die wenigen Freunde, die seine Bahre begleiteten, sind beim Tore umgekehrt, als ein heftiges Schnee- und Regenwetter sie überfällt. Die große Schmach, die man ihm antut, hat etwas an sich von Scheu und Ehrfurcht vor einem nicht mehr menschlichen Geschehen – der Dämon hat ein letztes Mal die Hand im Spiel. Er scheidet ihn im Tod von den Menschen, wie er ihn innerlich im Leben von ihnen schied. Die Menschen-Geist-Geschichte ist reicher um ein tiefsinnigstes Symbol: der glühendste Sänger des Lebens, er konnte auf dieser Erde nicht anders leben und sterben.
 |
































