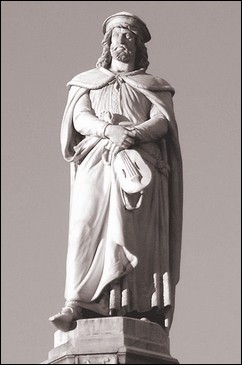|
[Bd. 1 S. 195]
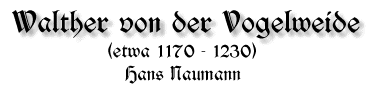
Hier erklingt ein Name, von dem sich Brücken schlagen lassen zu Dante, zu Hutten und zu Stefan George, deren Reihe Walther in gewissem Sinn eröffnet. Hier ist ein Dichter, untrennbar von der staufischen Zeit, deren Größe mit der seinigen verbunden ist, untrennbar aber auch von der deutschen Nation, die er für die beste hielt und darum für berechtigt, dem heiligen römischen Reich den Kaiser zu stellen und die Reichsidee zu tragen. Hier ist ein Minnesinger, dem der höfische Minnesang die Form war, von der Zeit hingereicht, Überzeitliches an Leid und Liebe zu sagen, und der dabei die strengen Grenzen des Sangs der Hohen Minne verließ. Hier ist ein Spruchdichter, der die altererbte germanische Spruchpoesie aus der Lebensweisheit in das Staatsleben übertrug, ein armer Ritter, der das Schwert wohl kaum gezogen, der aber das Wort schwang wie ein Schwert und die Spruchform hinhielt wie einen Schild vor Reich und Kaiser. Ein Ministerialensohn, der fast ein dichtender Staatsbeamter war, in dem Grade, in dem er die Ideen der kaiserlichen Kanzlei vertrat und die Sorgen des Kaisers die seinen waren. Über Walthers irdischen Wandel gibt es nach wie vor nur die eine und einzige urkundliche Nachricht aus den Reiserechnungen des Bischofs von Passau (1191 bis 1204), Wolfgers von Ellenbrechtskirchen, späteren Patriarchen von Aquileja (1204 bis 1218), wonach der Bischof dem Dichter, Walthero cantori de Vogelweide, der sich in seiner Reisegesellschaft befand, eine nach oben abgerundete Summe zur Beschaffung eines Pelzrocks auszahlen ließ. Man hat ermittelt, daß dies am 12. November 1203 am Tage nach St. Martin geschah, auf einer Reise ins Österreichische (bei Zeiselmauer, sagt die Urkunde), vermutlich zur Hochzeit Herzog Leopolds in Wien, daß der Mantel außen einen Fuchspelz tragen, innen aber wie der des Bischofs selbst mit Fehwerk gefüttert sein sollte, daß die gewährte Summe für den Dichter ausreichte, um sich für den frühen und harten Winter 1203/04 nach Art eines Hofbeamten zu kleiden, daß der Titel cantor auszeichnend, klangvoll und durchaus ehrend war, den Dichter von der sonst reichlich hier vertretenen "bunten Sippschaft der Artisten" weithin abhob und daß diese Ehrung auf seiner ritterlichen Abkunft, der Art seines Auftretens sowie auf seinen damals schon lebendigen Dichter- und Sängerruhm beruhte. Geschichtliche Zeugnisse in Chroniken, Annalen oder weiteren Urkunden gibt es bisher sonst über ihn nicht. Unzählige Dichterstimmen seiner eigenen Zeit, darunter solche wie [196] Wolframs und Gottfrieds, sowie der Folgezeit nennen allerdings meist preisend seinen Namen, denn seine Erscheinung prägte die Figur des wandernden Fahrt- und Rügedichters in Deutschland für mehr als ein ganzes Jahrhundert. Sein Bild, nicht porträtmäßig freilich, sondern zeitgemäß in der Idee, haben etwa 70 Jahre nach seinem Tode die berühmten Liederhandschriften wiederzugeben versucht: nach der Geste seines ersten Reichstonspruchs sitzend, Bein über Bein geschlagen, auf einem Stein, in nachdenklicher Haltung, den Ellenbogen aufs Knie gestützt und auf die Hand die Wange; aber seinen äußeren Lebensgang kann man nur aus seinen eigenen, zu diesem Behuf von der Forschung in sinnvolle Ordnung gebrachten Gedichten erschließen. Walther mag etwa von 1170 bis 1230 auf Erden gewandelt sein. Sein Leben fällt also voll in den strahlenden Aufstieg der großen staufischen Epoche, ganz und gar in die höchste Glanzzeit, die bisher den Deutschen beschieden war. Es reicht aus der machtvollen Zeit Barbarossas in die Zeit Heinrichs VI., wo der politische Stern des Reichs am höchsten stand, ging in die Zeiten Philipps und Ottos IV., traf auf den Messiaskaiser Friedrich II., unter dem die Auswirkung des Glanzes die breiteste und strahlendste war, mußte aber zugleich hier, wie einen Wurm in der Frucht, die ersten Anzeichen des Verfalls und der Wende verspüren mit den frühen und vorauseilenden Sinnen des Dichters. Walther sagt nicht, wo er geboren ist, und seine Sprache
Walther nennt sich selbst "Herr", und so nennt ihn die Mitwelt, die Nachwelt, womit sich uns seine ritterliche Abkunft verbürgt, die freilich seine Dichtung selber schon kündet. Er wird ein jüngerer Sohn einer wohl nicht eben sehr reichen Ministerialenfamilie gewesen sein, d. h. Angehöriger eines eigentlich neuen Standes, des kleinen Dienstadels, dem gerade unter den Staufern besonderer Aufstieg beschieden war. Diese neuen Kräfte trugen alsbald die Blüte des deutschen Rittertums, die alten Adelskräfte wuden ihre Schirmherrn. Aufgerufen von den Staufern wurden diese Ministerialen zu Trägern des Staates, des Reichs, der Kultur, der Dichtung, der Christenheit. Zwar ist der früheste Schauplatz von Walthers Auftreten naturgemäß Wien gewesen, der "wünnecliche hof" der Babenberger, in der ersten Hälfte der neunziger Jahre, aber die Zerwürfnisse daselbst, die ihn betrafen, waren doch wohl nur ein anderer Ausdruck für den Drang ins Reich, in die Weite, zu den Staufern selbst, unmittelbar in den staufischen [197] Raum an den Rhein, in eine breitere Welt und auf eine größere Bühne. Literarische Fehden zwischen ihm und Reinmar von Hagenau, dem Hauptvertreter der Wiener Minnehaltung, Minnelyrik und Minnekultur, brachen in Wien aus, etwa 1197, und zogen sich auch nach Wien noch Jahre hindurch durch Walthers Leben. Sie drehten sich im Grunde um eine engere und um eine weitere Auffassung der höfischen Haltung, und an scharfen Schlägen von beiden Seiten hat es nicht gefehlt. Ohne Zweifel ist Walther der angriffslustigere, beleidigendere gewesen, der Tasso dieses Antonio. Der Tod des Wiener Herzogs Friedrich auf dem Kreuzzug 1198, die besondere Gunst des neuen Herzogs Leopold für seinen Antonio, aber namentlich der Tod Kaiser Heinrichs VI. auf dem Gipfel der Jugend und Macht und der dadurch in Walther entfachte Reichs- und Kaisergedanke trieben ihn fort von Wien, nach Worms zu Philipp und führten ihn seinem zweiten großen dichterischen Felde, der politischen Spruchdichtung, zu. Und fortan war er wie der Kaiser selbst auf ewiger Fahrt. Fortan war er persönlich oder gedanklich immer um den Kaiser, mag er nun Philipp, Otto oder Friedrich heißen. Er war für die Kaiser das, was der Erzpoet einst in lateinischer Sprache für Barbarossa gewesen war. Ja er war mehr als der Erzpoet, denn sein Ethos ist tiefer, sein Geist blitzender, seine Klinge schärfer, seine Beziehung zur Kanzlei enger, seine Sprache, weil sie deutsch ist, reichte in der Wirkung viel weiter. Und so hat sein erbitterter, maßloser Kampf gegen die kaiserfeindlichen, besonders römischen Gewalten, gegen den Papst, Tausende auf die Seite des Kaisers gebracht, wie der Friauler Domherr Thomasin von Zirkläre schmerzlich bezeugt. Überwarf er sich mit Philipp und verließ er dann auch Otto IV., so gingen hier politische und persönliche Motive Hand in Hand. Er sah, daß sie nicht seiner Idee von Kaisergröße entsprachen, und ihr zu geringes Ausmaß fand er darin bestätigt, daß sie ihm seine persönlichen Wünsche unerfüllt ließen, die sich auf Haus, Hof und Heim oder wie er selber sagte, auf Feuer, Wein und Pfanne, auf ein eigenes Leben erstreckten. Nahmen sie ihn auch in ihre Haushalte auf, in ihre familia, ihr Ingesinde, so jedenfalls Philipp, vielleicht auch Otto: – trotzdem fand er die Herrentugend der Freigiebigkeit so wenig an ihnen bestätigt wie die staatsmännische Zulänglichkeit überhaupt. Man verwechsele dies nicht mit der bekannten Bettelhaftigkeit jener "bunten Sippschaft der Artisten". Walther sah in sich einen Ministerialen des Reichs, einen Lehnsmann der Kunst, einen Beamten der Kultur und beanspruchte als solcher sein Lehen. Es ist bekannt, daß ihm diesen Wunsch erst der junge Friedrich II. erfüllte, der ihn offenbar in feste Dienste nahm, vermutlich 1220 auf dem Reichstag in Frankfurt, auf die "alten Sprüche" hin und nachdem Walther dichterisch die Wahl des Kindes Heinrich zum König betrieben hatte. Wie sein Minnesang Frauendienst war, so war seine Spruchdichtung Herrendienst. Beides verlangte von Rechts wegen nach Lehen und Lohn. Und so bewies sich ihm Friedrich II. auch in dieser Beziehung als der Erfüllungskaiser. Es zerschlug sich eine erste geplante Form des Lehens, wie es scheint, eine Ritterburg, die in der Tat dem Dichter der [198] Gralsburg gemäßer gewesen wäre als unserm lebensnäheren poetischen Staatsmann. So erhielt er, und wir haben auch an dieser örtliche Legende zu zweifeln nicht den geringsten Anlaß, Haus und Hof in einer Stadt, zu Würzburg, seine curia dicta de Vogilweide. Und
Aber der Lebensraum Walthers ist mit dem Wiener und dem Stauferhof keineswegs schon durchschritten. In dieser Epoche, die sich nach dem Hof und dem dort gepflegten Kulturideal selbst "höfisch" nannte, waren nicht mehr die Klöster und noch nicht die Städte, sondern eben die Höfe, die größeren wie die kleineren, die Mittelpunkte alles Lebens. Wir finden den Dichter mehrfach am thüringischen Hofe zu Eisenach, zuerst wohl 1201, dann 1204 und öfter, wo der Landgraf Hermann in seiner besonderen Weise Leben, Lärm und Kunst um sich entfachte. Wir finden ihn am Hofe des Passauer Bischofs und wieder in Wien, 1203, wohin er zur Hochzeit Leopolds mit dem Bischof reiste. Die Reinmarfehde entbrannte aufs neue, und der größer gewachsene Dichter, aus weitem Raume zurückkehrend, läßt sie seinerseits unter ungeheurer Ausweitung in dem Preislied auf die deutsche Nation, die deutschen Frauen, die deutschen Sitten, die deutschen Männer gipfeln: Ich han lande vil gesehen und nam der besten gerne war usw. Das war nicht mehr ein Antwort an Reinmar allein, der in seiner abgesteckten Fixsternhaltung verblieben war, das war die Botschaft eines Planeten, der zum erstenmal seine große Bahn durchmaß, und ist eine Auseinandersetzung zugleich mit der romanischen Welt an die Anschrift des Dichters Peire Vidal, der die Deutschen beleidigt hatte. Und es blieb höchster Frauendienst doch zugleich. Irgendwann in den nächsten Jahren erreichte ihn in der Ferne die Nachricht von Reinmars Tod. Walther widmete ihm einen dichterischen Nachruf in einem Statuettenpaar schöner Sprüche, darin er den Dichter vom Menschen schied und des Dichters Verlust beklagte, sein Werk verklärte. Wir treffen ihn um 1210 am Hof des Markgrafen Dietrich von Meißen, und dort war es, wo sein Durchbruch vom hohen engen klassischen Minnesang zur reinen reifen vollen Liebeslyrik erfolgte. Er hat in der Tat der Länder viel gesehen, von der Elbe zum Rhein, von Paris bis Ungarn, von der Trave bis an den Po, er kannte das Reich, mit ihm wanderte das Reich und die Reichsidee, auch an die kleineren Höfe. Nirgends kam er als bloßer Gast, nirgends als bloßer Unterhalter, er fuhr als Fahrt- und Rügedichter wie ein Sturmwind umher, unter die Fürsten sowohl wie unter die mächtigen Reichs- und Hofministerialen. Er nahm kein Blatt vor den Mund, geißelte und tadelte, was er zu geißeln und tadeln fand, wurde zum Wächter des Reichs und zum Gewissen der Zeit, oft genug mit gemischten Gefühlen begrüßt und entlassen, zuweilen sich selbst und seinem strahlenden Wesen zum Überdruß und zum Ekel: "Ich schalt solange bis mein Atem stank." Walther hat zu den politischen wie zu den dichterischen Größen seiner Zeit in [199] unmittelbarer persönlicher Beziehung gestanden, zu den drei Führern des Reiches: Philipp (von 1198 ab), Otto (von vor 1208 ab), Friedrich (von etwa 1214 ab). Es braucht nicht mehr gesagt werden, daß er damit keine Parteien wechselte, denn er sah in allen dreien nur den wechselnden Träger des Reichs. Er hatte Beziehung zu dem jungen König Heinrich VII., den er verwarf; zu dem Kanzler und Reichsverweser Engelbert von Köln, zu den Thüringer Landgrafen Hermann und Ludwig, Elisabeths Gemahl, zu den Babenberger Herzögen, zum Herzog Bernhard von Kärnten, zu den Grafen von Katzenellenbogen, dem Markgrafen von Meißen, zum Bischof von Passau, zu Heinrich von Mödling u. a. m. Er hat andererseits in Eisenach Wolfram von Eschenbach kennengelernt, von dem er das Tagelied lernte und der uns einen verlorenen Spruch Walthers zitiert, er hat in Passau vermutlich Albrecht von Johannsdorf getroffen, den reinsten Lyriker der Zeit, kaum ein Minnesinger zu nennen, ebendaselbst wohl auch den Dichter des Nibelungenliedes, das um 1203 gerade seiner Vollendung entgegenging, er hat am staufischen Hof im Elsaß vermutlich Gottfried von Straßburg gesehen, der ihn verehrte und pries und der, wie er, das Ideal von der schmachtenden unerfüllten Liebe verwarf. Er war in Meißen und vielleicht schon früher mit Heinrich von Morungen zusammen, zu dem er mit der Erlebnisnähe im Gedicht, mit der Zufügung von Blut und Leidenschaft ins Gedankliche längst ein nahes Verhältnis besaß. Aber all diese Dichter riß nicht so wie ihn immer wieder die Not des Reichs von der Lyrik weg in die Spruchdichtung, von der reinen Kunst in die Strudel der Politik hinaus. Sie haben ihrer Veranlagung und ihrem Willen gemäß nichts aufzuweisen, was sich Walthers Reichstonsprüchen für Philipp, seinen Kaisersprüchen für Otto, seinem siebensprüchigen Haßgesang gegen den Papst vergliche, Dichtungen, die an Stolz, Wehrhaftigkeit und kühner Kraft neben dem Dom von Worms und dem Löwen von Braunschweig stehen, an Glanz und tiefer Weite neben dem Reiter von Bamberg und der Pfalz von Gelnhausen, unvergängliche und monumentale Zeugen deutscher Größe zur staufischen Zeit wie sie. Betrachten wir Walther zuerst ganz kurz als Minnesinger und sodann als staatlichen Dichter der Staufer. Walther stand auch als Minnesinger von Anfang an geistig mitten im staufischen Raum. Der Anschluß an Kaiser Otto IV. bedeutet in jeder Hinsicht nur scheinbar einen Vorstoß in den welfischen Raum, vielmehr war ja umgekehrt der Welfe, sobald er Kaiser war, staufisch geworden. Vom altheimisch-österreichischen Liebeslied zeigte Walther sich kaum berührt, der antikisierende Archaismus des thüringischen Kreises färbte auf ihn nicht ab, der neue Sang der Hohen Minne schlug ihn sogleich in Bann. Er mußte einen eigenen Weg gehen, um ihn umzubilden oder wieder zu verlassen. Walthers Minnesang begann also in Wien mit klassischer Lyrik der Hohen Minne, sehr stark unter dem Zeichen Reinmars von Hagenau. Die Hohe Minne, ganz auf Erziehung des Ritters durch die Dame ausgerichtet, mit der seltsamen Atmosphäre einer erlebnisfernen, unerfüllten, in edler Trauer getragenen Liebe, [200] war also zunächst der fast schulmäßige Inhalt seiner frühen Lyrik, die weit mehr Ethik und dialektische Gesellschaftsphilosophie darstellte als reine Lyrik an sich. Hohe Minne war eine geschichtlich einmalige, uns heute nur schwer verständliche Form der Liebe, die zur Prägung des Begriffes "ritterlich" äußerst wichtig war. Nicht auf Erfüllung der Liebe kam es an, sondern auf Erfüllung der Form, das enstprach der klassisch-höfischen Haltung der Stauferzeit, und aus dieser geduldigen und entsagungsvollen Formerfüllung heraus verbreiteten sich dann trotz der Haltung des Trauerns und der Klage die sanften und stetigen Wellenkreise der höfischen Freude. Edler ritterlicher Anstand, Zucht, Beherrschung und Sublimierung der Triebe, die indessen an sich nicht verleugnet wurden, aber die Erfüllung ganz dem unerforschlichen Entschluß der allmächtigen Herrin überließen, waren das erzieherische Ideal solcher Kultur. Sein erzieherischer Wille war es natürlich hauptsächlich, der auch unsern Dichter zur vollen, wiewohl nicht unabhängigen Beherrschung solcher Lyrik vermochte. Vielen der Dichter von "Minnesangs Frühling", deren Epoche er abschloß, verdankte er manches, Hartmann, Veldeke, am meisten, wie schon angedeutet, Reinmar, als dessen unmittelbaren Schüler man ihn lange Zeit nicht ganz richtig bezeichnete. Freie und eigene Regungen in ihm trafen damit zusammen, daß er die Dichtung Heinrichs von Morungen kennenlernte, sowie auch, wohl an den geistlichen Höfen, die lateinische Liebeslyrik der Kleriker, die sogenannte Vagantenlyrik. Das, was man Ideenliebe nennen könnte, Minne zu einer idealisierten hohen Erzieherin, vertretend das Geschlecht der reifen edlen Frauen überhaupt, wandelte sich in seinem lebendigen und weiten Geiste allmählich in Personenliebe um, wurde natürlicher, ohne die ritterliche Haltung zu verlieren und schwang sich auf eine ganz neue, bisher unbetretene Ebene der deutschen Lyrik. Dieser ganze, sehr gefährliche Prozeß erlebte bei ihm schließlich doch nur eine einzige Entgleisung, nämlich in dem berühmten, heute zu Unrecht so sehr beliebten Tandaradei-Lied (Under der linden an der heide), worin der Einfluß der lateinischen Klerikerliebeslyrik allzusehr Walthers neue Gretchengestalt, das herzeliebe frouwelin hinter der der philinenhaft leichtfertigen puellula der Vaganten hat zurücktreten lassen, anmutig und leichtfertig zugleich. Diese Schöpfung fällt aus Walthers sonstiger Haltung jedenfalls unendlich viel weiter heraus als die Schöpfung Philinens aus derjenigen Goethes. Hohe Minne meinte, wie gesagt, in der Verehrung der einen die Verehrung aller edlen Frauen und konnte schon deshalb nicht Personenliebe sein. Niedere Minne, wie sie die Vaganten sangen, und wie sie im Deutschen bisher nur ganz selten vorkam, hatte nichts Erzieherisches an sich und erschöpfte sich motivisch in der leichten Gunst und Lust der Stunde. Sie betraf infolgedessen nicht die große edle vornehme Dame, sondern das einfache Mädchen schlechthin. Es ist Walthers Eigentümlichkeit, rasch ein drittes gefunden zu haben, eine Stufe, bei der die Grenzen von hoher und niederer Minne oft untrennbar ineinander verfließen. Er übertrug fast den ganzen zarten Adel der einen Stufe auf die andere, die ihn bislang [201] entbehrte, machte aus der Hohen Minne die herzliche und natürliche Liebe, die die Erfüllung begehrt, ohne das Erzieherische aus sich zu verlieren, indem er die Treue und die Bewährung unbekümmert zum erstenmal auch in dieses Gedicht übertrug, es damit adelte und das Erzieherische unausgesprochen zu Geist- und Herzensbildung erweiterte. Aus reiner Gesellschaftsphilologie in Versen ist so die erste große schöne vollklingende Liebeslyrik in deutscher Sprache geworden. Es sind keine Ansprüche denkbar, denen sie nicht genügte, hundert Jahre vor der großen italienische Liebeslyrik. Das tausendjährige Reich der abendländischen Kaisermystik fand einen seiner Hauptvertreter in unserm Dichter; Zeugnis ist allein schon der geheimnisvolle Stein in der Krone, der Waise, dessen er bedeutungsvoll gedenkt. Aber man darf wohl sagen, daß diese abendländische Kaiseridee ihm unveräußerlich an die deutsche Nation gebunden war, obwohl er so Selbstverständliches niemals irgendwo ausdrücklich sagte. Und der Kaiser war ihm der alleinige Vertreter der Macht auf Erden wie Gott es im Himmel ist, die anderen Souveräne waren ihm arme Provinzkönige, und für den Papst blieb, genau wie für den Parzivaldichter, kein Raum zu einer politischen Rolle. Kaiseramt war unserm Dichter Vogtei Gottes auf Erden, eine besondere Art von Führung der Welt, gestellt auf Verteidigung und Frömmigkeit. Reich, das war ganz und gar eine deutsche Idee geworden, bedeutete Gliederung Europas nach Sinn und Ordnung, nach Recht und Gerechtigkeit, nicht nach Willkür und Vergewaltigung. Solche Reichsidee konnten nicht Napoleon, nicht der Völkerbund ersetzen, denn sie waren auf Vergewaltigung gegründet und verhielten sich zu ihr wie der Antichrist zum Christ. Ist aber das Reich eine solche Idee und Walther einer ihrer stolzesten Wächter, so wundert uns die Gefahr nicht, in der sich immer wieder sein Bozener Denkmal befindet. Wunderts uns nicht, daß ein Denkmal des römischen Feldherrn Drufus es ersetzen soll. Diese Waffen sind scharf geschliffen, denn Drufus, das bedeutet den Flug des römischen Adlers bis an die Weser, bis an die Elbe. Und Walther, das eben bedeutet die erste Proklamierung des Reichs im Lied von der Etsch bis an den Belt. Und der Kaiser, nicht der Papst, war ihm auch der Wächter der Kirche, der Christenheit. Die Kirche ist ihm keine weltliche Macht. Unserm Dichter verkörpert sich die reine christliche Urkirche in der Gestalt eines Klausners, den er immer wieder beschwor. Die Konstantinische Schenkung, an die Walther glaubte wie jedermann damals, war ihm ein Unglück für die Christenheit, ein bitteres Gift, das auf sie fiel. War der Kaiser der Wächter der Kirche und der Christenheit, so oblag ihm der Kreuzzug, so wurde die Verteidigung des christlichen Reichs, dessen Weihestätte das Heilige Grab ist, gegen die Heiden zu Pflicht und Amt. So wurde notwendig der Sänger des Reichs zum Kreuzzugsdichter. Staufisches Reich und Dichtung waren um jene Zeit schon lange eins. Die Kaiser selbst waren Dichter zugleich, die Lyrik Heinrichs VI. eröffnet die Manessische Handschrift, die ganze Dynastie der Staufer dichtete, fast alle Fürsten [202] des Reichs waren Minnesinger, und Kaiser Friedrich übertrug aus Deutschland die Minnelyrik in sein sizilisches Königreich. Es war nur eine Gegengabe, daß nun ein Dichter auch für das Reich eintrat und staatlich wurde. Zu Barbarossas Zeit geschah's auf lateinisch, von Walther ab geschah es deutsch. Und so dichtete denn Walther als Wortführer des staufischen Universalismus, wie es der Erzpoet zur Zeit Barbarossas tat. Längst hatten die Ritter den Geistlichen die Dichtung aus den Händen gewunden, wie sie ihnen die weltlichen Ämter des Reichs abnehmen sollten. Walther ging nur einen Schritt weiter, wenn er auch den Papst aus dem Reiche verwies. Kaiser und Dichter gehörten zusammen, sie starben zusammen im Morgenlande, so Friedrich von Hausen mit Barbarossa, denn beide waren sie Ritter, christliche und deutsche Ritter. Walther rief die Ritter zum Kreuzzug auf für den Kaiser, und es ist möglich, daß er Friedrich II. 1227 ins Morgenland begleitet hat. Sie huldigten alle dem gleichen Kulturideal, Kaiser wie Ritter wie Dichter, das auf germanischen, christlichen wie antiken Elementen in fast gleicher Weise beruhte. Kurzum, das Reich hat sich im Lied verkündet, das ist staufische Zeit, und auf Jahrhunderte noch hinaus wird das deutsche Lied in deutschen und andern germanischen Ländern ein Niederschlag und Echo des staufischen Reiches sein. Die allgemeine Ordnung des höfischen Lebens, des Rittertums sowie der staufischen Welt überhaupt baute sich auf drei Wertgebieten auf. Auch Walther formulierte sie mehrfach, zum erstenmal bei seinem Eintritt in den staufischen Raum: als Gottes Huld, als Ehre und als fahrendes Gut. Gott war das höchste Gut, Spitze des Stufenbaus und zugleich sein ewig tragender Grund, Ehre machte den Ritter aus, aber auch die irdischen Güter des Glückes und des Leibes hatten ihren bestimmten Wert. Walther warf sich nach Heinrichs VI. Tod in den politischen Strom mit der zornigen Klage, daß die politischen Wirren, die sich gegen Kaiser und Reich erhoben, die harmonische Vereinbarkeit der drei Wertgebiete störten und damit die göttliche Ordnung aufs schwerste gefährdeten. Es blieb seine Eigentümlichkeit, die politischen und kulturellen Dinge so untrennbar als eines zu sehen. Stets erschaute er die staufisch-höfischen Ideale in engster Beziehung zum Bestand des Reiches. Lag das Reich zu Boden, so mußte der Hohe Mut schlafen gehen, das heißt, die seelische Grundkraft des staufischen Menschen, die zu den hohen Werten beflügelt und die ein altes Erbteil aus dem Germanischen ist, wurde gelähmt. Dann sank auch die Freude dahin, waren die Ehre, die Stete, die Maaße, die Zucht bedroht, dann war kein höfisches Leben mehr möglich. Andere, Spätere, haben die Formel gefunden, daß sie das Reich im Hohen Mut oder freien Gemüte nicht kümmerte. Das konnte Walther nicht. Und so wurde ihm der Kaiser, der die staatliche Ordnung wiederherzustellen hatte, zugleich zum Retter und Schirmherr der höfischen Kultur, ihrer Grundkräfte wie ihrer Tugenden. Kampf und Streit zwar gehörten zum ritterlichen Weltbild, aber ein Herr mußte sein, ein Führer, ein starkes und strenges Gesicht. Das war der staufische [203] Kaiser und sein Regiment, dem der Papst und alle Könige der Welt sich zu fügen hatten. Walthers Sprüche, Reichs- nicht Herrschersprüche, Anfang und höchste Blüte der deutschen politischen Dichtung, hielten zwar in lieblicher Weise das Bild des jungen staufischen Königs, eben Philipps, und seiner Gemahlin fest, zielten aber alsbald auf das ideale, fast mythisch große Kaiserbild an sich, an dem sie die geschichtlichen Figuren maßen und verwarfen. Wenn die provenzalischen Troubadours zu politischen Ereignissen Stellung nahmen, waren sie oder ihre Gönner immer unmittelbar als Leidtragende oder Nutznießende beteiligt. Dichtungen in der Art Walthers gab es bei ihnen nicht. Walther wurde nicht müde, die eigentlichen Ursachen für die Wirrnis der Welt in Rom zu suchen, beim Papste selbst. Erst recht, wenn er den großen Namen Innocenz III. trug, dessen Bild er schonungslos verzerrte und dem er in Gestalt seines Klausners das Sinnbild der echten reinen unverdorbenen Urkirche gegenüberstellte. Heftig verwies er – nach dem ewigen Grundzug aller guten Deutschen – die "Pfaffen" aus den Bezirken der Politik. Alle Angriffe auf die Religion an sich, ja die Kirche an sich in ihrer gereinigten Gestalt, lagen ihm weltenfern. Ja, die Sorge ums Christentum war in ihm mindestens so lebendig wie die Sorge ums Reich. Er nahm das Gleichnis vom Zinsgroschen wieder auf und wußte, daß man zwar Gott zu geben habe, was Gottes ist, aber auch dem Kaiser, was des Kaisers ist. Den Papst aber verglich er mit Simon Magus, dem Zauberer Gerbert, ja mit Judas selbst, nannte ihn einen Wolf im Schafspelz, ja einen Verderber der Christenheit. Worte und Stil, Wendungen und Bilder sind trotz Glut und Leidenschaft wie in Bronze gegossen, heftig und kühn, scharf und tief, völlig unerhört bisher in deutscher Sprache. Unerhört auch war die hohe Stellung, in die er sich, den Dichter, rückte. Als den unmittelbaren Boten des Herrn stellte er sich hin, als den erzengelhaften Sendling Gottes, der dem Kaiser die großen Befehle bringt: Her keiser, ich bin fronebote, ich bring iu boteschaft von gote, ir habt die erde, er hat daz himelriche. Er spielte ein verwegenes Spiel zu dritt mit Kaiser und Gott, wie er in seiner Lyrik einmal ein Spiel zu dreien zwischen Dichter, Kaiser und Dame spielte. Der Deutsche in Walther war es, der den Deutschenhaß der Kurie zu erkennen glaubte, die wahre Frömmigkeit war es in Walther, die ihn gegen die Politisierung und Verweltlichung der Geistlichkeit und der Kirche in Harnisch brachte, die ihn sogar die Einziehung der Kirchengüter fordern ließ. Und wenn die Kirche aus infernalischer Politik sogar den kaiserlichen Kreuzzug hinderte und verpönte, dann ergab sich das seltsame Schauspiel, daß dann eben der deutsche Dichter die Propaganda für die Befreiung des Heiligen Grabes gegen den Papst für den Kaiser übernehmen mußte. Aber er fügte dann zum frommen sogleich den ritterlichen Ton. Es war eine Symphonie von deutschen Tönen, die immer wieder in ihm erklang, der von sich sagte, daß er sich verfluchen wollte, wenn ihm jemals fremde Sitten besser als die deutschen gefielen. [204] Walther nahm Dante und dessen Lebensführung voraus, wie er ihm ja die kaiserliche Staatslehre und das Verhältnis zum Kaiser sowie die Erhöhung der politischen Idee zur sittlichen um ein Jahrhundert vorausnahm. Heimatlose Wanderer sie beide, an Ziel und Haltung einander artverwandt, gleich im politischen Gedanken vom unangreifbaren Amt des Befehls in der Hand des Führers, der Bedeutung der befehlenden Persönlichkeit und der sittlichen Werte des Reichs, gleich im Reichsgedanken mit dem Ziel der Einheit, des Friedens und des Rechts. Der Name Kaiser Friedrichs II. verband sie so unmittelbar wie unlösbar. Walther schloß sich ihm an und fand in ihm seine Erfüllung nach jeglicher Richtung, Dante feierte seine Wirkung auf die italienische Dichtkunst, die er erweckt hatte, als er aus Deutschland kam. Die Legende hat sie beide unter die Geheimen Räte ihrer Kaiser versetzt.
Mit Stefan George teilt Walther die Struktur des unwirschen und herrischen Hüters der Ordnung und Zucht. Beide waren sie Erzieher, Richter, Gesetzgeber, Führer und Seher in Dichtergestalt. Beide waren sie Dichter ausschließlich in der Form von Lied und Spruch. Dichten war ihnen Würde und Amt, das unabdingbar bindet und löst. Beiden war die Kunst ein Mittel zur Macht und Herrschaft, die im Grunde Dienst bedeutet. Beide waren sie Herz und Gewissen ihrer Zeit in einer staatlichen Dichtung größten Stils. Beide errichteten sie Tafeln von Erz in Zeitgedichten und Sprüchen, deren Wirkung weit außerhalb der Grenzen liegt, die sonst dichterischem Schaffen gezogen sind. Gleich groß waren sie beide an Wille, Schau und magischem Glauben an die begnadete Gestalt, in rücksichtslos erzieherischem Bedrängen und gnadenlosem Verwerfen und wiederum in der ewigen Not des Wandertums.
 |