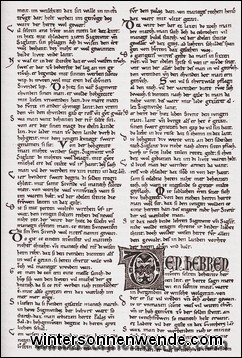|
[Bd. 1 S. 168]

 Es war um das Jahr 1200. Trotz dem jähen Zusammenbruch staufischer Machtträume mit dem Tode Kaiser Heinrichs VI. und trotz dem Doppelkönigtum Philipps und Ottos stand deutsches Leben in einer Blüte wie nie zuvor. Auch die Südostmark des Reiches erlebte unter dem jungen Babenberger Herzog Leopold VI. politisch, wirtschaftlich und kulturell ihre "glücklichste Zeit". Damals gab einer der großen österreichischen Herren – oder war es der Herzog selber? – einem ihm als Dichter irgendwie bereits bekannten Mann aus seinem Gefolge den Auftrag, für eines der strahlenden Hoffeste jener festesfreudigen Zeit ein großes Dichtwerk zu schaffen, das in vieltägigem Vortrag die edlen Gäste unterhalten, durch das verklärte Bild ritterlichen Lebens beglücken und zu gesteigertem Bewußtsein ihres Standes erheben sollte. Der Gedanke eines solchen Auftrages lag damals gewissermaßen in der Luft. Seit den glanzvollen letzten Jahren des Rotbarts, in denen der Name der deutschen Ritterschaft mit bisher nicht gekanntem Schein über die Welt gestrahlt hatte, war die Kunst des ritterlichen Idealromans nach französischem Muster auch in Deutschland heimisch geworden. Zunächst im Westen des Reichs. Am Niederrhein hatte Herr Heinrich von Veldeke den französischen Äneasroman in deutschen Versen nachgedichtet; und am Thüringer Landgrafenhof hatte er sein Werk vollendet, das den Zeitgenossen eine neue Epoche deutscher Dichtkultur einzuleiten schien. Von Schwaben her hatte Herr Hartmann von Aue der deutschen Ritterschaft seinen Erek und jüngst auch den Iwein geschenkt, die beiden Artusepen, in denen der Deutsche das französische Vorbild an Schilderungen ritterlicher Zucht und idealisierender Durchseelung des Stoffes noch überboten hatte. Und soeben hörte man, daß es nun auch in Franken sich regte: für den Grafen von Wertheim dichtete ein Herr von Eschenbach die Geschichte von Parzival und dem geheimnisvollen Gralsreich; ganz kürzlich erst war aus diesem Werk eine erste Kunde von [169] Gachmurets Rittertaten und Liebesabenteuern im fernen Mohrenland auch nach Österreich gedrungen. Nun wollte man in Österreich nicht hinter den andern deutschen Ländern zurückstehn. Fühlte man sich doch sonst in der Kunst der höfisch ritterlichen Dichtung schon seit Jahren auf der Höhe der Zeit. Hatte nicht der Elsässer Reinmar am Wiener Herzogshof eine bleibende Heimat gefunden und dort seine seelenzarten Minnelieder gesungen, in denen das Liebesbegehren zu einem unermüdlichen Streben nach unerreichbar hohem Ziel veredelt erschien? Und war ihm nicht in Walther von der Vogelweide ein heimischer Kunstgenosse entstanden, dessen höfisch-minnigliche Lieder noch vor der Hofgesellschaft erklangen, wenn auch der Dichter selber nach seinem Zwist mit dem Herzog den "wonniglichen Hof zu Wien" hatte verlassen müssen? Auch der Mann, dem jener Auftrag wurde, hatte gewiß schon Proben seines Dichtertums gegeben. Vermutlich gleichfalls als Sänger höfischen Minnesangs. Zum mindesten war er mit der Lyrik seiner Zeit innig vertraut. Überdies scheint die Entwicklung vom Lyriker zum Epiker auch in jener Zeit das Übliche gewesen zu sein: Heinrich von Veldeke, Hartmann und Wolfram haben ihr Dichterwerk als Minnesänger begonnen. Aber wir wissen nichts von Minneliedern des Nibelungendichters. Auch seinen Namen kennen wir nicht, trotz aller Bemühung von Gelehrten und Ungelehrten. Nur daß er ein Mann aus dem Donaulande war, ist sicher. Die Gegend um die Donau zwischen Wien und Passau kannte er genau. Besonders Passau erwähnt er in seinem Werk auffallend gern und eingehend. Das verlockt, ihn uns anstatt am Herzoghof zu Wien in der persönlichen Nähe des Passauer Bischofs zu denken, Wolfgers von Ellenbrechtskirchen, des tätigen und erfolgreichen Förderers der staufischen Sache, des gebefrohen Freundes der Gaukler, Vaganten, der Sänger und Sängerinnen, an dessen Bischofshof Herr Albrecht von Johannsdorf seine Minnelieder vorgetragen hat, und der uns als freigiebiger Gönner auch Walthers von der Vogelweide bezeugt ist. Die auffallende Rolle, die im Nibelungenlied der Bischof Pilgrim von Passau als Oheim und freundlicher Wirt der burgundischen Königsgeschwister spielt, wäre dann eine durchsichtige Huldigung des Dichters an seinen Auftraggeber; an den Herrn, dem er diente. Die Art dieses Dienstes, der Stand des Nibelungendichters, bleibt im Dunkeln. War er ein Geistlicher, so doch nicht seinem tiefsten Wesen nach, das lieber von glänzendem Ritterleben und kriegerischen Taten träumte als vom Kirchendienst; war er ein "Spielmann", so gewiß keiner von der niederen Art, die als Fiedler und, wenn es nottat, mit Gauklerkünsten ein wenig geachtetes Leben hinbrachte. Am liebsten werden wir ihn uns als ritterbürtigen Sänger etwa nach der Art des Vogelweiders vorstellen oder auch nach der Art des nibelungischen "Spielmanns" Volker, der auf Bechelaren der Markgräfin seine höfischen Lieder singt, nachher aber die Fiedel mit dem Schwert vertauscht und seine Herren im Kampf und Untergang begleitet. Denn das ist das Entscheidende: auch der Dichter des Nibelungenliedes trug beide Möglichkeiten in sich. Er war ein Mann der feinen [170] staufischen Ritterkultur, mit zarter Seele und weichem Empfinden für Liebesglück und ‑leid, begeistert für zuchtvolles Benehmen und den Glanz des Hoflebens. Aber er hatte sich daneben – wie Wolfram, ja in noch höherem Grade – den Sinn für das Männlich-Heldische des Kriegsberufs bewahrt. So zeigt ihn sein Werk. Gern wüßten wir, ob in jenem Auftrag auch bereits das Thema bestimmt war, oder ob der Dichter die Mär von Siegfrieds Tod und Kriemhilds Rache aus eigenster Neigung gewählt hat. Denn diese Wahl war in jener Zeit ein Bekenntnis. Nicht eines der Abenteuer- und Minne-Epen der neufränkischen Mode galt es einzudeutschen, sondern eine der alten heimischen Dichtungsstoffe, an denen schon die Väter sich begeistert hatten, war dem veränderten Kulturwillen der Gegenwart gemäß umzuformen und auszugestalten. Und was noch mehr sagt: in einer Zeit, in der die Phantasie der führenden Dichter von der beglückenden Harmonie festlichen Ritterlebens träumte und alle Härten des Daseins grundsätzlich verschwieg oder umschleierte, in der alles Romangeschehen nur dann befriedigte, wenn es in der höfischen Freude und im "Wunschleben" ausklang, erkor sich der Österreicher einen Stoff, vor dessen erbarmungsloser Tragik jeder Schleier zerreißen mußte, und der andere Kräfte im Dichter und Zuhörer wachrief als Wunschtraum und Schönheitssehnsucht. Wir dürfen den Gegensatz geographisch-stammeskundlich fassen: in der Südostmark, der dem rheinischen Leben fernsten Ecke des Reichs, war – trotz Reinmar oder Jungwalther – unter der Bildungsschicht staufisch-ritterlicher Seelenkultur das Gefühl für die dem Deutschen aus seiner germanischen Zeit ererbten heldischen Werte noch bewußt lebendig, ertrug und bejahte man noch das Wunschbild heroischen Sterbens. So konnte der Österreicher den durch die westliche Kultur bezauberten Deutschen der Stauferzeit aus dem geistigen Erbe seines Stammes das Epos schaffen, das als ewiges Vermächtnis des deutschen Mittelalters an die deutsche Zukunft edelste Seelenkräfte unserer Frühzeit, durch die Kunst zu unvergänglichem Leben geformt, wirkungsstark durch die Zeiten trägt.

Die erste Aufgabe, die sich ihm stellte, war die Wahl einer einheitlichen Versform. Daß er dafür die Kürenbergstrophe der "älteren Not" wählte, bedeutet eine wahrscheinlich bewußte, jedenfalls folgenreiche Absage an den Westen. Statt der Modeform des Reimpaarepos, das mit seinen schnell sich findenden, pausenlos fließenden Reimzeilen einer leichter und leiser gewordenen spannungsärmeren höfischen Unterhaltung entsprach, war die altheimische Strophe gewählt, die grundsätzlich anderes vom Dichter und Vortragenden verlangt: er muß langsamer sprechen und den Mund voller nehmen; die Langzeilen wollen höher herausgewölbt werden als die Kurzverse des Reimpaares, und der betonte Strophenabschluß fordert die spürbare Pause. So brachte schon die Wahl der Strophenform den pathetischeren Sprachstil mit, einen Stil der stärkeren Worte, der knapperen aber lauteren Reden, der in sich gerundeten, eigenständigen Strophen. Man versuche, sich die Schlußszenen des Nibelungenliedes als Reimpaarerzählungen nach der Art von Hartmanns oder selbst Wolframs Epen vorzustellen, und man wird spüren, wie hier die Wahl der Versform über Sein oder Nichtsein einer Dichtung entschieden hat. Inhaltlich standen die beiden nach Umfang und Darstellungsart so verschiedenen Quellendichtungen bereits eng zusammen. Das Notepos erzählte die Rache Kriemhilds für Siegfrieds Tod, setzte also die Handlung des Liedes als bekannt voraus. Doch es gab Widersprüche zwischen den beiden Darstellungen, die beseitigt werden mußten. Um die Handlungseinheit des neuen Ganzen deutlich zu betonen, stellte der Dichter sein Werk unter den einen Namen: Kriemhilds Glück, Jammer und Rache, so etwa wäre nach seiner ursprünglichen Absicht der Inhalt des Gesamtwerkes zu umschreiben, das er mit Kriemhilds Namen eröffnet und mit Kriemhilds Tod beschließt. Da außerdem das neue Großepos in seinen beiden Teilen einigermaßen ausgewogen sein sollte, war der Siegfriedsteil im Vergleich mit seiner Liedquelle auf den etwa zehnfachen Umfang zu bringen, während für den zweiten Teil eine Anschwellung auf schätzungsweise das Doppelte der "älteren Not" dem Stilwillen des Dichters genügte. Das bedeutet, daß er im ersten Teil sehr viel mehr Eigenes zu leisten hatte als im zweiten; der schnelle Schritt des Geschehens war zu verlangsamen, das ganz auf heftige Handlung gestellte Lied zum ruhigen Kultur- und Seelengemälde epischen Stils umzuformen und in allen Einzelheiten möglichst einleuchtend zu motivieren. In diesem ersten Teil schafft der Dichter vornehmlich aus den höfisch-ritterlichen Bildungsbereichen seiner Seele. Sein Ziel scheint zunächst ein Minneroman, in dem er an Zartheit des Gefühls, an Eindringlichkeit der Seelenzeichnung, an Glanz und Fülle höfischen Lebens mit den Epen des Westens zu wetteifern versucht. [173] Den heimatlosen Recken Siegfried zeichnet er zum wohlerzogenen rheinischen Königssohn um, in dessen sorglich gehütete Jugend sich das Drachenabenteuer freilich nicht recht fügen will. Der bloße Ruf von Kriemhilds Schönheit treibt den Jüngling zur Werbefahrt nach Worms. Dort, nach einer humorvoll wirkenden kurzen Entgleisung in das laute Wildlingsbenehmen des unbändigen Drachentöters, zarteste Schilderung aufkeimender Liebe: heimliche Blicke, verräterisches Erröten, stummer Händedruck, langwährender Dienst. Das rasch erledigte Abenteuer des Sachsenkriegs, ja Siegfrieds Teilnahme an der schicksalsvollen Fahrt nach Isenstein bilden nur Kapitel in seinem Liebesroman. Aber das lichte Bild ist vom ersten Anfang an überschattet: der Gegensatz Siegfried Hagen kündet sich früh an; und immer wieder deutet der Dichter auf das Unheil in der Ferne. In dem doppelten Betrug an Isenstein und in Gunthers Brautkammer wird der Keim zu dem Schicksal gelegt, das die Harmonie des heiteren Daseins zerstören wird. Diese Szenen, Siegfrieds unsichtbare Hilfe beim Wettkampf und im Schlafgemach, waren nun freilich ihrer ganzen Erfindung nach grob unhöfischer Natur. Aber für die Fabel waren sie nicht zu entbehren. Unser Dichter hat versucht, ihre Rohheit zu mildern: ging es im Liede in Gunthers schlimmen Brautnächten um die Entjungferung der Überstarken, die mit ihrem Magdtum auch ihre Überkraft verlor, und vollbrachte Siegfried diese Tat für den Freund, so genügt im Nibelungenlied die Niederringung der Widerspenstigen, dessen Widerstandswille durch Siegfried gebrochen wird. Vor allem aber rettet sich unser Dichter in das Burleske der Szenen, indem er das Bild der späteren Gegnerin Kriemhilds – wohl im Anschluß an das Lied – ins Grotesk-Athletische übersteigert: vier Kämmerer tragen ihren Schild, dreie den Ger, und an dem Stein, den sie im Wettkampf werfen wird, haben zwölf Helden zu schleppen; da entfällt selbst Hagen der Mut beim Anblick dieser Erwählten seines Herrn, die besser die Braut des Teufels in der Hölle wäre. Und ähnlich ist die Tonart in Gunthers Gespräch mit Siegfried nach der bösen Brautnacht: "Ich habe mir den Teufel ins Haus geholt", sagt er; "nähmest du ihr das Leben, ich würde es dir verzeihen: sie ist ein entsetzliches Weib!" Siegfried hat das Bewußtsein, daß er durch seinen Kampf mit Brünhild das Verhältnis zwischen Mann und Weib für immer entscheidet: unterliegt er, so haben alle Frauen in Zukunft das Recht, ihren Männern aufsässig zu sein; und die gedemütigte Brünhild bestätigt ihrem Bezwinger, daß er es versteht, eine Frau zu meistern. Man denke sich diese Partien vor einer Hofgesellschaft vorgetragen, die in der Dichtung an die schattenlose Verklärung der Frau als der Minneherrin gewöhnt war; man stelle sich das herzhafte Gelächter vor, wenn Gunther an Händen und Füßen gebunden am Nagel hängt, das verständnisvolle Schmunzeln der Männer, wenn Siegfried die starke Teufelin bändigt! In diesen Szenen kommt ein sehr anderer seelischer Bereich zu Wort als der höfisch-ritterliche: der unhöfisch-männliche Bereich, der erst zwei Menschenalter später, nach [174] dem Zusammenbruch der staufischen Idealgesinnung, recht literaturfähig geworden ist, der im Nibelungenlied aber auch in Siegfrieds drohender, von Kriemhild später schmerzlich bestätigten Andeutungen über die rechte Art, den Frauen ihre Hoffart auszutreiben, sein Dasein unter der Kulturdecke verrät. Auf die schicksalsträchtige Doppelhochzeit in Worms folgen ein paar ruhige Bilder besonnten Fürstenlebens: Siegfried und Kriemhild als Herrscherpaar in Xanten, Einladung nach Worms, Beratung, Aufbruch, festlicher Empfang. Höfisches Zeremoniell und besonders das Anlegen der Feiertagsgewänder ist unserem Dichter der immer wieder verwendete, symbolische Ausdruck für die festliche Seite des Ritterdaseins. Dann beginnt in Worms beim Frauenzank die Unheilssaat aufzugehen. An dieser entscheidenden Stelle kommt dem Dichter sichtlich alles darauf an, den Wandel in Kriemhilds Sele begreiflich zu machen. Wie sie, die bisher nichts als Sanftmut und Liebe war, im beglückten Stolz auf den strahlenden Gatten unter den ihr unverständlichen, hartnäckigen Entgegnungen der Schwägerin Schritt für Schritt dazu gelangt, Siegfried erst ihrem Bruder Gunther gleich, dann ihm überlegen zu erklären, wie sie sich weiter zu der Reizrede hinreißen läßt, die den öffentlichen Rangstreit vor dem Domportal und die dort fallenden tödlichen Beleidigungen nachzieht, das ist ein seelischer Ablauf von überzeugender Notwendigkeit. Nach dem Kirchgang aber ist das Schicksal nicht mehr aufzuhalten; es bedarf nur noch des kaum merkbaren Anstoßes durch Brünhild, und Hagen schreitet zur Tat. In dem Folgenden hat der Dichter eine sehr eindrucksstarke Szene neu geschaffen. Um zu begründen, wieso Hagen das Geheimnis von Siegfrieds verwundbarer Stelle weiß, erfindet er den Besuch des Verräters bei Kriemhild: in der Blindheit ihrer durch das Schuldgefühl geweckten Sorge um den geliebten Mann gibt die Frau, die das noch gestaltlos sie bedrohende Unheil abwenden möchte, das Leben des Gatten in die Hand dessen, der schon entschlossen ist, ihn zu töten. Daß in dieser Erfindung sachlich nicht alles stimmt (wie kommt das Unheilskreuz auf Siegfrieds Jagdkleid? Wollte er nicht zum Ernstkampf gegen die Sachsen?), ist den Hörern gewiß so wenig bewußt geworden wie dem Dichter selber; sie spürten erschüttert die enge Verknotung von Liebe, Schuld und Tod.
Am Schluß des ersten Teiles ist nichts anderes mehr in Kriemhilds Herzen als untröstlicher Jammer und der Haß gegen Hagen. Diese Kriemhild hat mit den im Grunde schicksallosen Idealgestalten der staufischen Ritterepen, mit der Welt der Minne und Maße, der schönen Form und beglückenden Harmonie nichts mehr gemein. Sie ist unter ihrem Schicksal eine andere geworden, sie wartet nur noch auf die Stunde der Rache. Und ihr gegenüber Hagen, der von allen Burgunden die Gegnerin am tiefsten versteht: kein Mittel ist ihm zu grausam, sie an der Rache zu hindern; so raubt er ihr die letzte Waffe und versenkt den Nibelungenschatz in den Rhein. Der zweite Teil kündigt sich an. Überschauen wir den ersten Teil noch einmal aus der Ferne. Die Liebe des Dichters gehört dem reinen Liebespaar Siegfried und Kriemhild. Dessen Schicksal hat er, soweit es das Eigengesetz des Stoffes zuließ, aus dem verfeinerten Empfinden seiner Zeit heraus neugeformt. Ein Schicksal, das mit entsetzlicher Grausamkeit vom strahlenden Glück in verzweifelten Jammer führt. Aber kein Heldenschicksal. Siegfried hat sein Schicksal nicht in seinen Willen aufgenommen; fast ohne sein Zutun tritt es von außen an ihn heran; darum kann sein Tod wohl ergreifen, aber er hebt den Hörer nicht über sich hinaus, zwingt ihn nicht zum heldischen Ja. Hätte der Dichter nur diesen ersten Teil seines Epos geschaffen, sein Platz wäre unter den großen Gestaltern der Stauferzeit. Den Eintritt in die Gemeinschaft der Unsterblichen, die dem deutschen Volk nie versiegende Quellen der Kraft erschlossen haben, verdient er sich erst durch den zweiten Teil. Erst die Burgundentragödie gibt auch dem Kriemhildschicksal die hohe Würde des Heldischen.
 [176] Die Erzählung vom Untergang der Burgunden am Hunnenhof war, wie wir sahen, schon im 12. Jahrhundert zu einem umfangreichen Heldenepos geformt worden. Die neue Aufgabe verlangte hier nicht soviel an Stofferfindung. Es galt vor allem, die Erzählung des Vorgängers den gesteigerten formalen Anforderungen der Gegenwart anzupassen. Doch fand unser Dichter gerade im zweiten Teil Gelegenheit zu seinen größten Neuschöpfungen. In den ersten Szenen, Etzels Werbung um Kriemhild, Beratungen in Worms, Kriemhilds Ostfahrt, Hochzeit in Wien, Kriemhild im Hunnenland, Einladung der Brüder, Beratung und Aufbruch in Worms, schwelgt er noch einmal in der alten Weise in Empfängen und Verhandlungen, Festen und Abschieden, das heißt in Schilderungen höfischen Lebens. Wir vermerken im Vorübergehen die gewichtigste Neuerung: den Eid, durch den sich Markgraf Rüdiger als Brautwerber Etzels in Kriemhilds Hand gibt; erst die deutlicher sich abzeichnende Aussicht auf Rache macht der untröstlichen Frau den Gedanken der neuen Ehe erträglich; und Rüdigers Bild enthält den entscheidenden Zug: dieser Eid wird ihn später in seelische Nöte stürzen, wie sie keiner der andern kennt. Die Weissagung der Wasserfrauen hat unser Dichter um den Zug vermehrt, daß nur des Königs Kaplan die Heimat wiedersehen wird; daß Hagen sich nachher am Priester vergreift, zeichnet ihn in seinem der Kirche fernen Wesen und vertieft zugleich sein Wissen um das Kommende: der letzte Versuch, die Unheilsprophetinnen Lügen zu strafen, ist mißglückt; nun steht es ihm endgültig fest, daß es keine Rettung mehr gibt. In deutlicher Abneigung gegen die räuberischen Nachbarn erfindet der Österreicher den Kampf der burgundischen Nachhut mit Gelpfrat und seinen Bayern und zeigt bei der Gelegenheit seine Darstellungskunst an einer nächtlichen Szene mit hallendem Hufschlag und aus dem Dunkel blitzenden Schilden. Der Besuch auf Bechelaren mit Verlobung und Waffengeschenken war schon in der älteren Not ein letztes sonniges Bild auf dem Weg ins Dunkel; unser Dichter verstärkt die heiteren Farben: festlicher Empfang der reisemüden Gäste durch die Frauen (der Schauder der "jungen Markgräfin", die sich sträubt, Hagen zu küssen, wirft einen schnell vorübergehenden aber zeichnenden Schatten auf das Bild des "vorhtlîchen" Helden), zierliche Reden vor und nach der Verlobung, Volker als Minnesänger vor Frau Gotelind; ein letztes Mal bricht die Sonne höfischer Freude durch die Wolken. Dann geht es den Unheilsweg dem Ende zu. Die Ereignisse am Hunnenhof vor dem Ausbruch des Kampfes bereichert der Dichter um zwei Szenen von unvergeßlicher Bildkraft: Hagen und Volker auf der Steinbank gegenüber dem Frauengemach, Kriemhild an der Spitze von vierhundert Gewaffneten vor ihrem Todfeind; Hagen weigert der Königin den Gruß, er legt ihr zum Hohn Siegfrieds Schwert, das er seit dem Morde trägt, quer über die Knie und bekennt sich offen und ausdrücklich zu seiner Tat; aber trotz aller Versprechungen Kriemhilds wagt keiner der Hunnen, die beiden Helden anzugreifen, und Kriemhild muß, ohne etwas erreicht zu haben, zurückgehen: die beiden Haupt- [177] gegner stehen einander gegenüber; noch zerschellt die Angriffsabsicht Kriemhilds an Hagens und seines treuen Waffenbruders übermenschlich wirkender, aber noch ruhender Kraft. Dann die nächtliche Schildwacht: Hagen als Hüter vor dem Schlafsaal der müden Fahrtgenossen, und sein Freund Volker geigt die Herren mit immer leiser werdendem Saitenspiel in Schlummer; wieder blinken Waffen aus dem Dunkel, und wieder weichen die Hunnen vor den beiden gewaltigen Türhütern entsetzt zurück. Am andern Tag, nach dem Gottesdienst und einem Festturnier, bei dem die aufflackernde Feindschaft noch ein letztes Mal erstickt wird, der Ausbruch des Kampfes, unaushaltbar gräßlich in der Quelle: Kriemhild opfert ihren und Etzels Sohn ihrem Racheplan, indem sie ihn beim Festmahl gegen Hagen vorschickt; sein Schlag gegen den Oheim und sein Tod muß das große Morden in Gang setzen. Unser Dichter macht daraus eine Szenenfolge von begreiflicherem, darum weniger verletztendem Ablauf: Auf Kriemhilds Geheiß wird der kleine Etzelsohn in den Saal getragen, in dem die Herren beim Festmahl sitzen; Hagen weissagt ihm ein baldiges Ende; darauf betretenes Schweigen. Inzwischen eröffnet Blödel mit tausend Hunnen den Kampf gegen die burgundischen Knechte, die unter Dankwarts Obhut speisen; Blödel fällt als erster unter Dankwarts Schwert; aber die waffenlosen Knechte werden alle erschlagen; nur Dankwart schlägt sich zum Festsaal durch und ruft hinein, daß draußen das Morden begonnen hat. Da erhebt sich Hagen: nu trinken wir die minne / und gelten sküniges wîn! Und er schlägt dem Etzelsohn den Kopf ab, daß der der Mutter in den Schoß springt. Als Antwort auf das heimtückische Vorgehen der Hunnen gegen die ungewaffneten und unschuldigen Knechte erscheint dieser Schlag besser motiviert und verliert dadurch etwas von seiner Roheit. Mit ihm gibt Hagen das Zeichen zum Kampf im Saal. Dankwart besetzt die Tür, daß kein Hunne hinaus oder herein kann; drinnen aber beginnen die Burgunden, die sich auf Hagens Rat gewaffnet zum Mahl gesetzt haben, das große Blutbad. Bis König Dietrich auf einen Tisch springt und in das Getümmel brüllt, daß die weite Burg erdröhnt. Er verlangt freien Abzug für sich und seine Mannen und führt auch Etzel und Kriemhild aus dem Saal, und die Burgunden lassen ritterlich die Todfeindin entkommen; auch Rüdiger darf mit seinen Recken abziehen. Was aber an Hunnen im Saal ist, wird bis auf den letzten Mann erschlagen. Die letzten Kämpfe sind in der Nacherzählung der Dietrichsage so entstellt, daß der Vergleich sich kaum mehr im einzelnen führen läßt. Neu geschaffen hat unser Dichter die große Sage vom Kampf und Tod der Dietrichsrecken mit dem ergreifenden Schlußbild, wie König Dietrich vom alten Hildebrand den Tod seiner Mannen erfährt, diesen schwersten Verlust, der den landlosen Vertriebenen treffen konnte: so hât mîn got vergezzen / ich armer Dietrîch! Wer sol mir danne helfen / in Amelunge lant? Im übrigen hat der Dichter die Kämpfe zu sich steigernder Wirkung geordnet. Aber diese formalen Änderungen bedeuten [178] wenig gegenüber dem Geist, in dem er diese letzten Szenen nachgeschaffen hat. Denn jetzt trägt ihn sein Stoff zu den letzten Höhen heldischer Größe; gemanisches Urgestein durchbricht die ritterlich-höfische Kulturschicht. Aus diesem Urgestein ist Hagen von Tronje, der Held, der von Anfang wissend dem Untergang entgegengeht, der die Last seines Wissens schweigend und aufrecht trägt und sich seinen Willen nicht beugen läßt: er kämpft um sein Schicksal, solange er atmet. Auch als er wehrlos, gefesselt, als letzter Überlebender vor der rasenden Todfeindin steht, ist sein Kampfwille nicht gebrochen:
der sol dich vâlandinne / iemer wol verholen sîn! Noch im Augenblick des sicheren Todes triumphiert sein Haß über die Gegnerin; und er stirbt mit dem Ja zu seiner Tat, als ein Ganzer, der dem Schicksal bis zum letzten Atemzug abtrotzt, was an Tat es ihm noch freiläßt. Der gleiche unerschütterliche Heldensinn lebt in allen Nibelungen. Ihr Gesetz ist: lieber sterben als nachgeben in dem, was sie als bindende Verpflichtung ihrer Ehre über sich fühlen: daß sie selbst um den Preis des Lebens nicht voneinander zu trennen sind. So stehn sie in "Nibelungentreue" für den einen Hagen: sine konden von ir triuwen / niht ein ander verlân. Und sie alle sterben ohne ein Wort der Klage und ohne jeden Aufblick zu Gott, ohne einen Gedanken an Seele und Jenseits. Es geht ein Rausch von Tod und Wunden durch Etzels Saal, in dem beide Parteien verbluten; zugleich ein Rausch des zur höchsten Leistung gesteigerten Lebens. Dies Übermaß des Kraftrausches formt sich dem Dichter zu den Worten des sterbenden Wolfhart, des jugendlichen Draufgängers unter den Dietrichsmannen. Er hat von Giselher den Todeshieb erhalten, aber auch seinen Gegner noch mit dem letzten Hiebe zu Boden gestreckt:
den naehsten und den besten / den sult ir von mir sagen daz si nâch mir niht weinen: / daz ist âne nôt. vor eines küneges handen / lig ich hie hêrlîchen tôt. Im Hochgefühl seiner Taten und stolz, einem würdigen Gegner erlegen zu sein, verbittet er sich jede Totenklage: der Ruhm ist ihm gewiß, das ist genug. Wolfhart stirbt – wie sie alle – in der unbedingt sicheren Haltung des Helden. Auch Kriemhild stellt sich in ihren Kreis. Seit Rüdigers Eidschwur ihr in der Ferne die Aussicht auf Rache gezeigt hat, gilt all ihr Sinnen und Tun dem einen Ziel. Es zu erreichen, ist jede List und jede Grausamkeit ihr recht. Unaufhörlich schürt sie die Zwietracht; einen Helden nach dem andern, Blödel, Iring, Rüdiger, treibt sie in den Tod; ihr Werk, das Werk einer rasenden Frau, ist der Saalbrand, der alle ritterliche Gesinnung verhöhnt. Und wenn sie am Schluß Gunthers Kopf an den Haaren vor Hagen trägt und dann den gefesselten Gegner mit eigener Hand erschlägt, so reicht die Erinnerung an Siegfrieds Ermordung nicht mehr aus, [179] erst ihr eigener Tod läßt die Gräßlichkeit dieser letzten Szene ertragen. Und doch steht das Bild der Rächerin Kriemhild dem Hörer letztlich unbefleckt in der Erinnerung: eine Vorzeitheldin, die nicht klagend in ihrer Witwentrauer versinkt, sondern mit harten, zuletzt fast versteintem Willen das Schicksal zu dem von ihr gewollten Ziele zwingt. Nur einer lebt in der weicheren Luft der neuen Zeit: Rüdiger von Bechelaren. Wo immer er auftritt, weht ein Hauch höfischen Staufertums. Und als dann der ritterliche Markgraf in den erbarmungslosen Mahlstrom des Untergangs endlich auch hineingetragen wird, da ist er der einzige unter den Helden, der nicht ohne Besinnen weiß, was er zu tun hat, und dem die Christenfrage nach dem Schicksal der Seele Not macht. Kriemhild erinnert ihn an den Eid, den er ihr einst in Worms geschworen hat.Und Rüdiger gibt ihr zu: Ehre und Leben habe ich Euch verschworen; daz ich die sêle vliese / des enhân ich niht gesworn. Als Geleitsmann der Burgunden kann er ihnen den Frieden nicht brechen. Daß König und Königin ihm bittend zu Füßen fallen, zerreißt ihm das Herz: Ehre, Treue, alle höfischen Tugenden stehen auf dem Spiel; jede Entscheidung ist eine Entscheidung zum Bösen. Bis er sich der fordernden Bitte Kriemhilds nicht länger weigern kann und in den Kampf geht, bei dem er mit dem Leben auch seine Ritterehre und seiner Seele Seligkeit einsetzt; denn den Kampf mit den Freunden, die in seinem Schutze hergekommen sind, wird ihm auch Gott nicht verzeihen. Aus diesem Zwiespalt rettet ihn der Dichter auf ergreifende Weise: ehe es zum Schlagen kommt, ruft Hagen den Markgrafen an und gibt ihm Gelegenheit zu der großen symbolischen Geste der vollendeten Ritterlichkeit: "Den Schild, den mir Frau Gotelin in Bechelaren schenkte, den haben mir die Hunnen vor der Hand zerhauen; nun gib mir deinen." Und Rüdiger schenkt seinen Schild dem Gegner und Freund, der daraufhin, erschüttert durch diesen Grad der Hochherzigkeit, dem Kampfe fernbleibt. Damit ist dem edlen Markgrafen Ehre und seelisches Gleichgewicht wiedergewonnen. Wenn er nun von demselben Schwerte fällt, das er daheim dem Gernot geschenkt hat, und, schon zum Tode verwundet, seinen Gegner noch tötet, so liegt in ihm der "Vater aller Tugenden" erschlagen. In Markgraf Rüdiger hat staufisches Rittertum sich sein Heldenbild geschaffen; auch er geht offenen Auges in den gewissen Tod; doch sein Heldentum ist bedroht von den Zweifeln einer sehr viel bewußter gewordenen Zeit; der Kampf zwischen den Pflichten wird ihm zur religiösen Not, sein Heldentum zum religiösen Wagnis. Aber wie er dies Wagnis auf sich nimmt: daß die Zerrissenheit seines Herzens ihm doch die Kraft zum Kampf und den Mut zum Tode nicht lähmt, und wie er durch das Schildgeschenk seine innere Ehre wiedergewinnt, das stellte den staufischen Rüdiger ebenbürtig neben die anderen Großen, seine Genossen im Untergang. Je mehr wir nachfühlen, daß in die Gestalt Rüdigers am meisten von des Nibelungendichters eigener empfindungsreicher Seele eingegangen ist, um so mehr müssen wir das Künstlertum und die menschliche Größe des Dichters bewundern, [180] der auch die übermächtigen Gestalten der alten Sage so überzeugend lebendig nachzuschaffen vermocht hat. In diesen letzten Szenen des zweiten Teiles ist der Dichter des Nibelungenliedes an seinen Helden über sich selbst und seine Zeit hinausgewachsen, hat er über ihnen seine höfisch empfindsame Umwelt, ja fast sich selbst vergessen. Sich selbst nicht ganz. Seine Klagen über das unabwendbare Schicksal, sein Tadel gegen Hagens Übermut, die spürbar zunehmende Abneigung gegen Kriemhild und vor allem das weichherzige Schlußwort von der Trauer, in die alle Freude endet – das alles verrät uns, wie seine Seele unter den harten Taten und der wilden Größe der von ihm geschauten Gestalten gelitten hat. Aber wie sein Markgraf Rüdiger trotz aller Seelenqual die heldische Haltung bewahrt, so ist auch unser Dichter der übergewaltigen Größe seiner Gestalten nicht erlegen. Er ist, wenn auch fast widerstrebend, ihnen nachgeschritten in die atemberaubende Eisluft ihres zeitlosen Heldentums, des stahlharten, nur in sich selber ruhenden Willens und des germanischen Todestrotzes.
 In einer Zeit, die den Tod des Helden in der Dichtung vermied oder zum Quell endloser Klagen macht, hat der Dichter des Nibelungenliedes den Deutschen das Bild wahren Heldentums und tragischer Größe gerettet. Das ist sein ewiges Verdienst. Aber wenn sein Epos auch von Zeitgenossen und Nachfahren viel gelesen worden ist – mehr als dreißig Handschriften des Textes zeugen davon –, so empfand man doch bald das Bedürfnis, die Wucht der Tragödie zu mildern. Wohl noch zu Lebzeiten des Dichters erhielt sein Werk eine Art von Fortsetzung in grundanderem Geist und grundanderem Stil: die "Klage", in der die vom Meister noch männlich zurückgehaltenen Tränen hemmungslos die kurzen Reimpaare durchströmen, und in der die Schuldfrage im Sinn einer Rechtfertigung von Kriemhilds Liebestreue auf Kosten des "Teufels" Hagen breit erörtert wird. Bald darauf hat ein anderer Landsmann des Dichters das Nibelungenlied selber in ähnlichem Sinne umgearbeitet. Immer mehr versucht man, die strengen Züge des hohen Bildes zu erweichen und zu moralisieren. Nicht viel anders steht es mit den Neuschöpfungen, die das Vorbild des Großepos aus altheimischem Stoff bald im bayrisch-österreichischen Raum hervorlockt: Kudrun, Walther, Alphart, sie alle haben von der Kunst, nicht aber den Geist des einzigen Großen lernen können. Auch Wolfram von Eschenbach scheint unter dem Eindruck des Nibelungenliedes den Plan zu seinem strophischen Epos von Sigune und Schionatulander gefaßt zu haben; er ist über zwei Szenen aus dem Beginn des Liebesromans nicht hinausgekommen, so daß wir nicht wissen, wie sich ihm der Tod seines Helden dargestellt hätte; doch hätte auch er die zeitlose Größe der Nibelungentragödie gewiß nicht erreicht. Schon im dreizehnten Jahrhundert steht der Dichter des Nibelungenlieds auf sehr einsamer Höhe. Mit dem fünfzehnten Jahrhundert verschwindet sein Werk aus dem deutschen Schrifttum. Als einer [181] der letzten hat Kaiser Maximilian, der "letzte Ritter", sich mit ihm beschäftigt. Dann geht es auf lange Zeit den Deutschen verloren. Erst als, drei Jahrhunderte später, die wachsende deutsche Not die Augen aller Vaterlandsfreunde auf die großen Leistungen der deutschen Vergangenheit lenkte, schien auch die Zeit für ein neues Verständnis des Nibelungenliedes gekommen. Jetzt feiert man das wiederentdeckte als die "teutsche Ilias"; der Führer der romantischen Schule preist das "Werk von kolossalem Charakter, von erstaunenswerter Hoheit in den Gesinnungen" und verlangt, es müsse "wieder ein Hauptbuch bei der Erziehung der deutschen Jugend werden". Und im Jahre 1815 erscheint im kleinsten Format eine Ausgabe des Textes, dazu bestimmt, den Freiwilligen des Befreiungskrieges "ein traulicher und treulicher Feld- und Zeltgesell zu werden". Aber mit den Flammen der nationalen Begeisterung erlosch auch das brennende Fragen nach den Lebenswerten der deutschen Vorzeit. Das Nibelungenlied wurde zu einem Lehrgegenstand der Schule und zu einem Streitobjekt der Gelehrten, die über ihren leidenschaftlichen Kämpfen das Kunstwerk selbst und die Gestalt seines Dichters fast aus den Augen verloren. Nach Lachmann hatte das Epos überhaupt keinen eigentlichen Verfasser; es war zusammengesetzt und zusammengewachsen aus vielen Einzelliedern, die jedes nur einen Ausschnitt aus dem Gesamtverlauf behandelt hatten. Mit dieser Blickeinstellung war die künstlerische und sittliche Leistung, die im Nibelungenlied vorliegt, nicht zu würdigen. Wohl ließen einzelne sich durch die Gelehrten das Gefühl nicht verwirren. Hebbel, der deutscheste unter den Dichtern der Jahrhundertmitte, wußte sich während der Arbeit an seiner Nibelungentrilogie durchaus als "Dolmetsch eines Höheren", dieses "Dramatikers vom Wirbel bis zum Zeh", dessen Werk er nur zu seiner wahren Gestalt erlösen und damit zur vollen tragischen Wirkung bringen wollte. Aber auch Hebbel blieb einsam wie sein großer Vorgänger. Mochte die Kenntnis des Nibelungenliedes durch Schullektüre und Übersetzungen sich verbreiten, den Geist seines Dichters hat das neunzehnte Jahrhundert nicht zu beschwören vermocht. Noch um 1880 hatte die große Allgemeine Deutsche Biographie, die doch jedem kleinsten Meistersingerlein sein bescheidenes Denkmal setzte, für den Dichter des Nibelungenliedes keinen Raum. Erst nach der Jahrhundertwende glückte die endgültige Abkehr von den blutleeren Schatten gelehrter Abstraktion. In dem gleichen Maße, wie die Gestalten der ältesten germanischen Heldendichtung, von den mythischen Nebeln befreit, mit denen frühere Forschung sie umwölkt hatte, dem Nacherleben deutlich wurden, trat auch der Dichter des Nibelungenliedes mit seiner einzigartigen Leistung in helleres Licht. Heute hat der Schöpfer des deutschen Nationalepos, der große Bildner, der germanische Heldengestalten mit den Mitteln seiner reicher und reifer gewordenen Kunst neu erstehen ließ, in dem Kreis der starken Nothelfer des deutschen Volkes seinen unverlierbaren Platz.
 |