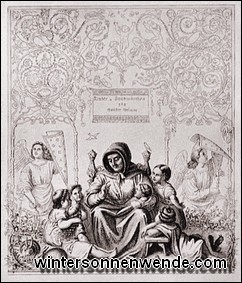|
[Bd. 3 S. 185]

Die wenigen Zeilen spiegeln wider, was Grundton dieses Lebens war: Schlichtheit, die nüchtern erscheinen könnte, eine fast rührende Frömmigkeit und eine Liebe zum Vaterlande, zu Volk und Heimat, aus der sein Bestes, sein ganzes Werk aufblühte und wuchs. Dazwischen klingt als süßerer Ton das Kindhafte, das jederzeit ihn "Vater" und "Mutter" gedenken läßt. "wie ich confirmiert wurde", steht irgendwo auf einem Zettel, der unter vielen Notizen lag, "und zuerst zum abendmal gieng, sah ich wie die mutter ganz klar aus dem stuhl heraus das lied mitsang und wie sie das gesangbuch hielt und dabei weinte." Ein andermal in einem Brief: "ich erinnere mich genau, daß ich mit dem vater, als er noch stadtschreiber in Hanau war, einmal in einer winternacht oder doch abends durch [186] den schnee in ein dorf fuhr, wo er leute zu verhören hatte; die stube war voll bauern, tabaksdampf und trüber lichter." So lebt er, die Augen zurückgewandt, immer dem Früher aufs engste verbunden. Sein Lebenslauf berichtet von ihm, wie er zusammen mit seinem Bruder nach Kassel geschickt ward und nach vier Jahren, im Frühjahr 1802, nach Marburg ging. Wilhelm folgte ihm im nächsten Jahre. In Marburg entschied sich ihr späterer Weg. Sie hatten als Juristen begonnen. Aber bereits ins erste Semester klangen die Stimmen der jungen Romantik. "Am Sonntag", schrieb Jacob 1802, "besah ich die hiesige Elisabetherkirche. Ein wahres Meisterstück, in ächt gothischem Geschmack, und die farbigen Fenster – eine leider jetzt verlorene Kunst – wie feierlich, und die Gruft mancher Landgrafen wie schauerlich! Der Vorwelt Schattengebilde umsäuseln uns und erinnern uns an unsre Vergänglichkeit! – Auch findet man da Gemälde von dem berühmten Alb. Dürer." Eine verlorene Zeit stieg empor, noch schattenhaft, noch nicht zu halten – aber die Brüder verfielen ihr. Wachler, der Literarhistoriker, wies sie auf Heinrich von Ofterdingen, des jungen Novalis herrliches Werk. Und Savigny weckte die Gedanken an alte "Quellen". Er auch zog Jacob für einen Sommer (1805) nach Paris, wo er die Lust am Spüren nach Quellen und alten Handschriften recht genoß. Den Kreis um die Brentanos und Arnim erschloß er den Brüdern, die 1817 noch die Klassik verwarfen, das Deutsche forderten. Wilhelm schrieb damals über Goethe: "Daß er die Nachahmung der griechisch. Welt als die zuträglichste preißt, halte ich für falsch zumal in der Mahlerei; die Berücksichtigung der altdeutschen ist viel natürlicher, weil das Leben, das sie darstellt, doch noch vielfach in uns fortlebt." Man hat sich langsam daran gewöhnt, in Jacob den führenden zu sehen, welchem der jüngere Bruder folgte. Aber vielleicht ist das nicht richtig. Mindestens nicht für diese Jahre. – Die Lebensbeschreibung Wilhelm Grimms beginnt mit diesen, ihn zeichnenden Worten: "Ich bin zu Hanau geboren, am 24. Febr. 1786. Obgleich ich erst fünf Jahre alt war, als die Eltern diese Stadt verließen, sind mir doch noch Erinnerungen aus jener Zeit geblieben. Dreißig Jahre später gieng ich an dem Hause vorüber, wo wir gewohnt hatten, und die offene Thüre reizte mich in die Flur einzutreten; ich erinnerte mich gar wohl der innern Einrichtung und sah über die Mauer des anstoßenden Gartens noch den Pfirsichbaum, dessen rothe Blüthe mich als Kind ergötzt hatte. Im Jahr 1790 hatte der Landgraf von Hessen zum Schutz der Kaiserwahl bei der Frankfurt naheliegenden Stadt Bergen ein beträchtliches Corps zusammengezogen; um die große Revue an einem festlichen Tage mit anzusehen, waren die Eltern in das Lager hinausgefahren, und ich besinne mich deutlich, wie ich, zum Kutschenfenster herausschauend, die Regimenter mit den im Sonnenscheine blitzenden Gewehren vorübermarschieren sah und der Donner der Kanonen jedesmal den Wagen erschütterte. Nicht minder lebhaft steht mir noch in Gedanken, wie wir beide, Jacob und ich, Hand in Hand über den Markt der Neustadt zu einem französischen Sprachlehrer giengen, der [187] neben der Kirche wohnte, und in kindischer Freude stehen blieben, um dem goldenen Hahn auf der Spitze des Thurmes zuzusehen, der sich im Winde hin und her drehte." Dann spricht er von der Schwester des Vaters: "Die Festigkeit ihres Geistes verließ sie nicht, bis zu ihrem Ende. In der Nacht, wo sie die Annäherung des Todes fühlte, bat sie die Mutter, ihr ein Gebet vorzulesen; die Mutter fieng das Gebet eines Kranken an 'nein, Frau Schwester', sagte sie, 'suchen Sie das Gebet eines Sterbenden auf'." Der Mann, der sich hier selbst beschrieb, begann wie Jacob mit Anekdoten. Aber wie sehr verschieden sind seine von denen, die der Bruder erzählte. Nichts tritt von seinem Charakter ans Licht. Sondern: das Rot eines Pfirsichbäumchens, das Blitzen und Blinken des goldenen Hahnes, der Lärm der Kanonen blieben ihm haften. Das feste Wort einer sterbenden Frau, in dem sich ihre Seele erweist. Wilhelm war eine Künstlernatur. Ein Dichter, welchem die deutsche Sprache wie wenigen sonst zu Gebote stand. Und um sie beide noch besser zu zeigen, rücke ich zwei ihrer Briefe her, die sie an Weigand geschrieben haben, den Jugendfreund und Studiengenossen. Wilhelm schrieb ihm: "Sey vielmals gegrüßt, lieber Weigand, ich habe so gewiß geglaubt dich Pfingsten hier zu sehen, daß ich schon bittern Schnaps, süßen Wein, Kuchen in Menge bestellt habe, und nun tritt dein Bruder ein und meldet, daß du dort bleiben wolltest. Von dem Schaden nicht zu reden, hast dus auf dem Gewissen, wenn ich als guter Hauswirt krank werde, da ich natürlich alles selber verzehren muß, was wir gemeinschaftlich verfumfeien wollten. Auch muß ich an dich schreiben, da ich viel lieber gesprochen hätte. Der Jacob ist seit einigen Wochen abwesend, indem er mit Urlaub auf 5 Wochen nach Dresden reist über Eisnach, Weimar pp. und als ein gereister Mann der (mit witzenburgerisch und borgerischem Witz) sich auch keine Sau dünkt, zurückzukehren gedenkt. Ich lebe hier nun in Einsamkeit und Arbeit, und kann nur die letztere unterbrechen, nicht die erstere, wenn ich will; einmal geh ich täglich spazieren, wo ich mich erstlich noch viel einsamer fühle als in der Stube, und wo ich zweitens immer viel Juden sehe, welches auch eine Arbeit ist. Zuweilen steh ich am Fenster und üb mich in höflichen Sitten; mitten in der Straße ist eine Schnupftabakfabrik, und da gewöhnlich jeder niesen muß, der vorbeigeht, so ruf ich ihnen Prosit zu, aber das ist rar, daß einer so viel Lebensart hätte und bedankte sich. Mein zweites Divertissement ist ein idealisch lumpiger Handwerkspursch, der unter dem Namen Blaubart hier die Stütze alter Volkssage ist und unter dem angenehmsten Schimpfen stets vorüberzieht..." Daneben stehe ein Brief Jacobs: "Sie können sich leicht vorstellen, daß wenn ich meiner Sehnsucht folgen kann, ich gewiß Christtag nach Kassel komme, allein es tun sich mancherlei Hindernisse auf, eine Fußreise wäre bei der dann vermutlich eintretenden Kälte zu beschwerlich und nicht ratsam, ich könnte wohl einem Dorfbarbier Gelegenheit geben, das in Bekks Not u. Hülfsbuch beschriebene Schnee-Experiment an mir zu machen, wozu ich eben keine Lust habe. – Doch kommt Zeit, [188] kommt Rat. – Ich habe seitdem nichts besonders gelesen außer Briefe von Mathisson. Ganz herrlich... In Bürgers Biographie habe ich gefunden, daß ihm eine Stelle in der Nachtfeier (pervigilium Veneris) so viel Mühe machte, er konnte aber doch die schöne Gedrängtheit des Originals nicht wiedergeben. Es heißt: cras amet qui nunquam amavit, quique amavit semper amet. Bürger gibt mehr als 50 Variationen an, zb: Morgen liebe, wer noch immer – Sich der Liebe Glück erkor..." Ich glaube nicht danebenzugreifen, wenn ich die Brüder so erkläre: in Wilhelm steckte ein verkappter Dichter; in Jacob erwies sich der Philologe. Freilich ein solcher Philologe, wie unsere Zeit ihn kaum mehr sah. Er spürte die Farbe, den Ruch der Wörter, den sie vor Zeiten hatten, auf, wo wir nur dürre Buchstaben sehen. Das ist es, was die Teile A bis C und E des Wörterbuches so teuer macht und ihnen die Dauer verliehen hat. Das aber, die Dichterschaft Wilhelm Grimms, ist auch, was ihm die Finger führte, als er aus dürren Notizen und Worten die Märchen erlas und gedichtet hat. Denn es ist Irrtum, wenn man glaubt, sein Werk sei das des Säuberns gewesen; er hat sie in neue Kleider gesteckt – freilich in solche, von denen wir denken, sie wären von Anfang die ihren gewesen. Bedenkt man das alles, dann wird man glauben, daß jenes Hinneigen zur frühen Romantik viel mehr von ihm als von Jacob ausging. In Jacob steckte der Antiquar, und er verfiel durch Savigny dem kommenden Reize der Handschriftenforschung, zu der ihn jener gezogen hatte. – Das äußere Leben Jacob Grimms verlief bewegter als das des Bruders. Er trat in die Verwaltung ein. Als aber im Jahre 1807 das Königreich Westfalen entstand, war ihm zuwider, das welsche Recht erlernen und sich aneignen zu sollen. Ihn lockte es, Bibliothekar zu werden; jedoch der Staat versagte sich ihm; Hieronymus Bonaparte hat ihn dann an seine Privatbibliothek berufen –, wie es nicht nur dies eine Mal das Schicksal der Brüder gewesen ist, daß sich der Staat seiner Pflicht entzog, geistiges Leben zu hegen und zu pflegen, und für ihn Private eintreten mußten. Fünf Jahre geruhigen Lebens folgten, bis ihn der Winter des Jahres 1813 zum zweiten Male nach Frankreich brachte, diesmal in diplomatischen Diensten. Drüben wie auf dem Wiener Kongreß trug er den Titel Legationssekretär und tat in Wahrheit nur Schreiberdienste; wieder floh er zur Wissenschaft; die öden Stunden des Wiener Winters vertrieb er sich mit den slawischen Sprachen. Die Wiederkehr Napoleons und die Geschäfte des neuen Friedens führten ihn 1815 ein drittes Mal in die Pariser Bibliotheken; er hatte den Auftrag, für die Schätze, welche Napoleon einst entführt, Entgelte zu holen, vor allem Handschriften, durch die Verlorenes ersetzt werden sollte. Die Wanderjahre des älteren Jacobs führten die Brüder eng zueinander. Von Kind auf waren sie zusammen aufgewachsen, hatten zusammen studiert und nebeneinander gehaust. Jetzt spürten sie, was Trennung heißt. Im Juli 1805 schrieb [189] einer dem andern: "Lieber Wilhelm, wir wollen uns einmal nie trennen, und gesetzt, man wollte einen anderswohin tun, so müßte der andere gleich aufsagen. Wir sind nun diese Gemeinschaft so gewohnt, daß mich schon das Vereinzeln zum Tode betrüben könnte." So ist es ihr Leben lang auch geblieben. Wilhelm ist während des Kriegsjahres 1814 in Kassel zur Bibliothek gegangen, und Jacob folgte ihm 1816 nach. Sie wurden zusammen nach Bonn berufen und lehnten ab, und wiederum beide nach Göttingen 1829. Als Wilhelm sich mit Dortchen Wild, der Jugendgespielin, verheiratet hatte, blieb Jacob dennoch mit ihm zusammen. Ihr erster Sohn wird Jacob getauft und hat wie der zweite nur diesen als Paten. Sie schreiben die Hälfte der Bücher zusammen. Man hat in diesem Verhältnis der Brüder Jacob als Gebenden angesehen. Aber das ist ein vorschneller Schluß; sie gaben einander wechselseitig. Ja, manchmal will es den Anschein haben, als wäre Wilhelm der reichere von beiden und Jacob säße an seinem Tische. So zeigen die Briefe, daß er es war, der sie zum alten Deutschen verlockte. Jacob schreibt 1805 in Paris: "Hier habe ich Manuskripte, besonders das Digestum, Codex, Instit. Volumen, Codex Theodosianus, Decretum etc. zu vergleichen, welches eine recht interessante Arbeit ist" – da steckte er also zutiefst im Recht. In diesen Tagen schrieb ihm der Bruder, er habe den Novalis gekauft; Tiecks Minnelieder besaßen sie schon, und dann: "Ich habe daran gedacht, ob du nicht in Paris einmal unter den Manuss. nach alten deutschen Gedichten und Poesien suchen könntest, vielleicht fändest du etwas, das merkwürdig und unbekannt."... Die Lust an der alten Dichtung der Deutschen ging von den romantischen Dichtern aus; durch sie wird Wilhelm Grimm angesteckt, und er führt erst den Bruder darauf.
 Aus der Romantik kamen die Brüder. Romantisch bestimmt war ihr erster Weg. Sie fingen mit Rezensionen an; die zweite Jacobs enthält diese Sätze: "Bodmer hat irgendwo gesagt, daß man die Sprache des Mittelalters wie eine tote betrachten und studieren müsse. In diesem Ausspruche liegt wenig Wahres, allenfalls nur in Beziehung auf einzelne Wörter, deren Gebrauch aufgehört hat. Im ganzen ist es unsere jetzt noch lebende Sprache, die wir ohne große Mühe verstehen, nur noch in der Kindheit, im Gegensatz zu der Ausgebildetheit der heutigen. Die Poesie bedarf, um sich auszusprechen, durchaus nicht einer ausgebildeten Sprache, und lebendig durchdrungen von ihrem großen Gegenstande, findet sie allzeit Worte. Und dieses mehr Angedeutete, das Unbeholfene, durch welches eine mächtige Empfindung bricht, sagt mehr als die durchdachtere Auswahl kunstreicher Worte. So verhält es sich mit dem Nibelungenlied, dessen Charakter die höchste Naivität ist..." Viel wichtige Sätze sind hier beschlossen. Die Sprache der alten deutschen Zeit war kindhaft, keusch, rein. Die Dichtung dieser kindhafteren Zeit war [190] Poesie, die durch die Sprache mit einer mächtigen Empfindung brach und deshalb mehr war als unsere heutige, die sich kunsthafter Mittel bedient. Damit tritt eine Scheidung auf, die für die Brüder bedeutend wurde: die Scheidung Natur- und Kunstpoesie. Sie ging im letzten auf Herder zurück und dessen Stimmen der Völker in Liedern, an die sich das Tun der Brüder lehnt. Wenn man die Worte recht fassen will, so braucht man nur daran zu denken, was man bis auf die letzten Jahre von der Entstehung des Volksliedes glaubte: wie alles Gute in der Natur, gehe auch das Volkslied, das Epos, aus der stillen Kraft des Ganzen leise hervor. Nicht hätten es wenige ausgezeichnete, überlegen begabte Menschen absichtlich hervorgebracht. Sondern: es dichtete das ganze Volk. Und diese Dichtung, Grimm nennt sie Epos, ist mehr als die des Einzeldichters. "In allen Literaturen folgt auf das alte Epos eine Poesie, die statt aus dem Gemüte des Ganzen aus dem des Einzelnen hervorquillt. Was die Natur nach ihrer Unbewußtheit rein und vollendet in sich gibt, dasselbe strebt nun die Kunst frei zu ersetzen. Allein unerreichbar steht ihren anfassenden Händen der Gipfel alter Herrlichkeit. Es ist überall, als ziehe sich eine große Einfachheit zurück und verschließe sich in dem Maße, worin der bildende Mensch sie aus der eigenen Kraft, durch sein Nachsinnen zu offenbaren strebt." Man wird nach allem diesem verstehen, warum die Brüder sich der Dichtung der alten deutschen Zeit zuwandten. Hier fanden sie das, wonach sie suchten, und wenn sie das Hildebrandslied herstellten oder wenn sie im "Armen Heinrich" des Hartmann von Aue das Gut des Volkes im späteren Liede des einzelnen fanden –, so griffen sie nur nach der alten "Sage". Aber was sie als Sage verstanden, damals verstanden, das war nichts anderes, als was die Romantik darunter verstand: die Heldensage der alten Epen: das Nibelungenlied, Dietrich und Ortnit, der Liederkreis um den großen Karl. "So wie es aber unmöglich ist", schrieb Jacob wieder, "die alte Sage auf dieselbe Art zu behandeln wie mit der neueren Geschichte verfahren werden muß (welche vielleicht mehr Wahrheit des Details enthält, wogegen in den Sagen bei allem Fragmentarischen eine hervorgreifende [191] Wahrheit in Auffassung des Totaleindrucks der Begebenheit herrscht), so ungereimt ist es, ein Epos erfinden zu wollen; denn jedes Epos muß sich selbst dichten, von keinem Dichter geschrieben werden." Da haben wir ihn wieder, den Satz, daß jedes Epos sich selbst dichten muß, und daß das Volk, nicht einer, es dichtet. Das Volk als Dichter. Das weist weiter und weist auf die Poesie zurück, die Herder den Deutschen gefunden hat und die von Arnim und Brentano, den Freunden der Grimm, gesucht worden ist, als sie Des Knaben Wunderhorn schufen. Wie nahe lag es, daß die Brüder nicht nur in der epischen hohen Zeit des Mittelalters zu finden versuchten, daß sie wie jene das Volk befragten. Das eigene Volk und fremde Völker. Sie griffen nach den eddischen Liedern, ihnen noch eine Art Volksliedsammlung; Jacob bringt spanische alte Romanzen, Wilhelm die dänischen Heldenlieder in deutsche Sprache, und wenig später versuchte sich Jacob an serbischen Liedern. In allem war es dasselbe Suchen. Aber – wie vorhin – ein Umweg des Suchens. Denn ihnen lag nicht so sehr am Herzen, das Dichten "des Volkes" zu begreifen, als das des eigenen, des deutschen Volkes. So schrieb der Ältere zum Ossian, jenen angeblichen Volksgesängen: "Den deutschen Denkmälern scheint zu begegnen, was auch so oft das Schicksal des deutschen Verdienstes war: Verkennung und Zurücksetzung vor dem Fremden mit der gleißenden Außenseite, mit dem gehaltloseren Innern. Ossians Lieder sind in einer Sprache gedichtet, welche von der unsrigen gänzlich abliegt, schildern Geschichten und Sitten, worin sich wenig oder nichts mit deutscher Geschichte und Sitte lebendig berührt, und schwimmen in einem Nebel, der unserer wahren vaterländischen Poesie, ja dem deutschen Wesen überhaupt, wo es sich natürlich geäußert [192] hat, jederzeit uneigen war." Und Wilhelm Grimm sprach es dann aus, wohin sie zielten: "Wie wir die Form einer zarten Pflanze noch aus dem Eindruck, den sie in dem harten Stein zurückgelassen, so müssen wir nicht selten, was bei uns verloren, in einer Abbildung erkennen, die bei einem fremden Volke davon entstand, und die, wenn sie auch nur geborgte Strahlen zurückwirft, doch den alten Glanz ahnen läßt." Nie aber waren sie dem so nah wie in der Sammlung der deutschen "Sagen". Alles, wonach sie ahnend strebten: die lautere Poesie einer glücklichen, von selbstischer Sucht dann zerstörten Zeit, die letzte Wahrheit, die Novalis in Märchen, Geschichten verborgen glaubte, ihr Deutschsein und Hoffen, traf hier zusammen. Sie trugen "Lokalsagen", wie sie damals die deutschen "Volkssagen" nannten, und Märchen, Volkslieder und altes Brauchtum zusammen. "Gib mir doch", schrieb 1809 Jacob Grimm an seinen Jugendfreund Paul Wiegand, "auf die Sitten, Gebräuche deiner Gerichtsuntergebenen acht; besonders examinier alle Spitzbuben über Diebs- und Räuberlieder, über abergläubische Dinge, Sprüche genau und vollständig aus. Fischer, Köhler und
Die Kinder- und Hausmärchen sind langsam gewachsen. Manches kam aus der Kinderzeit; schon zeitig erzählte Gretchen Wild den Brüdern das "Marienkind". Reichere Quellen erschlossen sich später; aus ihnen ragen die Namen "Viehmännin", das war die Zwehrener Märchenfrau, die "alte Marie" (Müller) in Kassel, die Namen der Haxthausen und Droste hervor. Als Arnim 1812 nach Kassel kam, trieb er die Brüder zum Drucken an. Wilhelm erzählte es viel später: "Im Zimmer auf und ab gehend las er die einzelnen Blätter, während ein zahmer Kanarienvogel, in zierlicher Bewegung mit den Flügeln sich im Gleichgewicht haltend, auf seinem Kopfe saß, in dessen vollen Locken es ihm sehr behaglich zu sein schien." Weihnachten 1812 erschien der erste, Januar 1815 der zweite Band. Es war, als brächen in heißen Tagen zwei frische Quellen im Walde hervor. Ein wahrer Schatzberg war aufgetan –, ein Schatzberg, aus dem das deutsche Volk und alle Völker der Nachbarschaft seit hundertunddreißig Jahren nehmen, ohne daß er sich vermindert hat: Sneewittchen, Der Fischer un syne Fru, Der treue Johannes, Hänsel und Gretel, Rapunzel, Jorinde und Joringel, Das tapfere Schneiderlein, Hans im Glück – der selige Zauber des Märchenlandes atmet um diese wenigen Namen. Und keiner der Namen ist tot und leer. Wir alle, der hinterste Wälderbauer und die im Schatten der Schlote wohnen, der Fischer an der preußischen Nehrung und die in Bozen deutsch singen und träumen, der Fürstensohn und das ärmste Kind im Kellerwinkel wie der Gelehrte, der Eisendreher und Straßenbahner [193] wissen um diese Gestalten Bescheid. Was wissen die meisten, die ich nannte, von der Ottilie der "Wahlverwandtschaften", von Schillers "Jungfrau", Brentanos Märchen? Alles verlosch oder ward nicht lebendig; die Märchen aber waren und bleiben. Ein Buch der Deutschen – neben der Bibel und dem Kalender allein das dritte – wurde in diesen zwei Bänden geschaffen. Hätten sie nichts als das getan, ihr Name wäre uns lieb und traut. Aber um dieser zwei Bände willen lebt auch ihr Name im Mund jedes Kindes, treuer und fester als andere in Erz.
Ich habe vorhin ihr Wesen beschrieben. Hier wird es deutlich – zum andern Male. Wilhelm war es, der diesen Märchen ihre vertrauliche Sprache gegeben, die Sprache Luthers und seine eigene: bildhaft, altvaterisch und lebendig. Nicht weniges ihres ewigen Lebens haben die Märchen der Sprache zu danken, die deutsch zuinnerst ist, wie die Märchen die Züge des deutschen Wesens treffen. Jacob verwarf im letzten die Formung. Er wünschte die Märchen treu wiedergegeben. Sie waren ihm eine gelehrte Quelle. Aber daß dies sein Fordern dem Bruder, der unter seinem Einflusse stand, das allzu verlockende Bosseln hemmte, war gut und gab den Märchen zuletzt ihr treu-untreues, schönes Gesicht. Im Hintergrunde blieben die Sagen – diesmal nicht mehr die Heldensagen von Siegfried und von Dietrich von Bern, sondern die wunderhaften Geschichten, die nicht wie die Märchen des Volkes Dichtung, sondern des Volkes Historie geben. Die Brüder erkannten dies Wesentliche, wußten es aber noch nicht zu fassen; sie ahnten es nur in einem Zuge: die Sage haftet am Ort und an Personen. Sie spricht von Barbarossa, vom Tell, nicht nur von einem "starken Hans", der überall zu Hause sein könnte. Hier ist dasselbe wie in den Märchen. Ich glaube sogar, daß die zwei Bände die zwei der Märchen noch übertreffen. "Sie haben", schrieb Jacob 1815 an August von Haxthausen, "auch ihr Schönes. Die Märchen gleichen den Blumen, diese Volkssagen frischen Kräutern und Sträuchen, oft von eigentümlichem Geruch und Hauche." Ich sagte, die Sagen seien nichts Minderes; aber es ist ihr Unglück gewesen, daß sie nicht zu den Lesern fanden, zu denen sie hätten finden müssen. Die Brüder begriffen, daß die Märchen den Kindern gehörten, und legten sie drum in einer Mutter hegende Hände. In denen lebten sie auf und gediehen, so wie die Lieder des Wunderhorns bei Müttern und liebenden Menschen gediehen. Die Sagen, in denen "Glaube" und "Heimat" und "bäurisches Denken" runter wird, hätten dem einfachen Volk gehört und neben dessen Kalender gehört, neben die "Volksbücher" und die Bibel. Das aber hat die "Aufklärung" der Pfarrer und Schullehrer nicht dulden wollen – und hat so bewirkt, daß unser Volk ein Buch und einen Schatzhort verlor, wie ihm kein zweiter geboten wurde.
 Man kann die folgenden zwanzig Jahre die hohe Zeit der Brüder nennen. Zwar Wilhelm baut weiter, was er bereits im ersten Jahrzehnt der Arbeit begonnen, sein Werk über die "deutsche Heldensage". Nur drang er tiefer, nachhaltiger [194] ein. Doch Jacob Grimm reckt sich jetzt auf. Er hat den Geschmack an Fouqué verloren, bekennt er 1816 dem Jugendfreunde. Und die Romantik blieb hinter ihm. Scherer hat einmal vermuten wollen, und wie mir scheint, mit einigem Recht, daß Schlegels Kritik den Wandel schuf. Der hatte die epische Theorie, die Ehrerbietung vor Kinderreimen und Ammenmärchen der Brüder verspottet, die Etymologien Jacobs verlacht. Genaue grammatische Kenntnis sei not, wie die historische Wertung der Texte. Eine historische Grammatik hatte auch Wilhelm von Humboldt gefordert. Der Brandpfeil, den August Wilhelm Schlegel gegen den älteren geschleudert hatte, war tief und schmerzend haften geblieben. Langsam begriff der junge Stürmer, wie sehr berechtigt die Forderung war, die der Erfahrenere da erhob. Und diese Forderung traf auf Saiten, welche seit langem schon in ihm schwangen. Er hatte für die Wandlung der Laute, von der er in seiner Grammatik handelte, eine rein sinnliche Empfindung gehabt. Er haßte alle Schulmeisterei, die in der Sprache sich breitmachen wollte, die lächerliche Fremdwörterjagd, wie die Puristen, die nichts vermögen, als ihre verkümmerte Rede, ihr Maß zum Maßstab der deutschen Sprache zu machen. Ihm war die Sprache in allen Formen etwas Gewachsenes und "Organisches", ein lebendes Reis des Stammes "Volk". Der dänische Forscher Rask hat gelehrt: "Eine Sprachlehre sollte nicht sowohl befehlen, wie man die Worte bilden müsse, sondern vielmehr beschreiben, wie sie gebildet und verändert zu werden pflegen." Und Jacob fügte zu: "Jede Individualität soll heiliggehalten werden, auch in der Sprache; es ist zu wünschen, daß auch der kleinste, verachtetste Dialekt nur sich selbst und seiner Natur überlassen bleibe und keine Gewaltsamkeit erdulde." Und wieder: "Der Geist aber, welcher gewaltet hat, wird auch ins Künftige fühlen, wieviel des Fremden bleiben könne oder dürfe und wo die Zeit erscheine, da das noch Anstößige am Besten abgelegt wird" – also der Geist der Sprache entscheidet, nicht wir! – "wenn wir nur selbst Herz und Sinn, was die Hauptsumme ist, unserm Vaterland getreu bewahren." Noch klingt hier die romantische Lehre von dem Sich-selbst-Bilden der Sprache nach, so wie das Epos sich selber dichtet; die Lehre auch, nach der die Sprache ein Wesen, ein Organisches sei. Aus alledem erwuchs das Buch, das 1819 erschien: Deutsche Grammatik, eine Geschichte, nicht eine Schulmeisterei der Sprache. Ein Bild von ihrem Werden und Sein, nicht ein vertrockneter Regelkram. Es stieg in die ältesten Zeiten hinauf; stellt Zeugnis zu Zeugnis, – in Savignys Geist, jeweils aus einer Summe von Fällen die großen Gesetze des Werdens ablesend. Ein ungeheures, gewaltiges Werk! Und doch in ihm ein Erdenrest, dem Philologen "zu tragen peinlich". Man hat ihm die Rechnung aufgemacht: "Große Wortreihen und Gedankengruppen sind übergangen. Die allgemeinen Richtungslinien sind nicht immer sicher, scharf und deutlich genug gezogen. Die grammatischen Kategorien, nicht von vornherein hinlänglich durchdacht, gehen ineinander über. Sorgfältig wird nur einiges ausgeführt, manches bloß begonnen [195] und angedeutet, vieles gar nicht in Angriff genommen. Was sich ihm zumeist in den Vordergrund schob, sein Hauptinteresse auf sich und von anderen Dingen abzog, war das Poetische und das Altertümliche. Er versenkt sich in die Anschauungen und Worte, in welche die kunstlose Phantasie der ältesten Germanen ihre einfache Welt gefaßt hat. Er schließt eine Zeit vor uns auf, in welcher Krieg und Schlachten, Sieg und Ruhm die einzigen Vorstellungen waren, an denen eine Menschenseele sich erhob und erbaute. Der unaufhaltsame Kämpfer und Rufer in der Schlacht, der streitende, siegende Held war das Ideal des germanischen Mannes. Die Walküre, auch sie streitbar und kampfesmutig, aber von dem wundersamen Glanze rätselvoller Zauberweisheit umflossen, war das Ideal des germanischen Weibes. Und die germanischen Lebensideale durchdrangen die germanische Poesie... Kurz, Jacob Grimm entfaltet die Weltanschauung der germanischen Urzeit. Niemand war vor Jacob Grimm, der in solcher Weise den Lebensinhalt einer ganzen Epoche zum Gegenstande der Grammatik gemacht hat." Was ist hier geschehen? Eine Dichtung. Die Dichtung vom germanischen Volke. Kein Schulmeister ist am Werke gewesen, sondern allein der liebende Sucher. Wir haben vorhin die beiden Brüder als Philologen und Dichter geschieden. Aber was Wilhelm gedichtet hat, das ist nichts anderes, als was die Dichtung an anderen Stellen auch vor sich brachte. Er gab dem Stoff eine schöne Form. Daß er der Sprache gewaltiger war als viele mit ihm und neben ihm, mag ihn vor anderen charakterisieren. Auch, daß er nur formte, nicht Neues schuf. Hier aber stand ein "Dichter" auf und dichtete in einem neuen Stoffe. Was ist sein Gedicht? Die alte Zeit. Aber noch mehr: er greift ins Dunkel und bringt aus ihm Gesetze hervor. Gesetze, die dauernde Geltung verlangen. Er dichtet einen Sinn dieser Welt und ihrer Erscheinung in der Sprache. Und eine Wahrheit, die immer ist. Es kommt auf diese Wahrheit an. Vor ihrem Anspruch zerflattern Worte, die "klassisch" oder "romantisch" besagen und Dichterschulen bezeichnen wollen: "Es gibt keinen rechten Unterschied zwischen antiker und romantischer Poesie. Die Geschichte der Malerei, Poesie und Sprache lehret viele Abwege vermeiden, denn sie zeigt uns, daß jederzeit die Wahrheit denen erschienen ist, welche auf die Spur der Natur getreten sind." Dichten ist mehr, als gefällige Formen um ein beliebiges Thema weben. Dichten baut Stufen ins Dunkel der Welt. Und hier war einer, der Stufen baute. Er hat die schönen Formen verschmäht; innere Keuschheit hielt ihn zurück; es war die Keuschheit des sauberen Mannes, der sich nicht klüger als andere dünkte. Er wollte nur weisen, nicht überreden, weil es ihn lächerlich, kindisch dünkte, zu einer Erkenntnis zu überreden, die sich die Menschen gewinnen können, wenn sie sie sich gewinnen wollen. Ein Philologe? Ich glaube es doch. Aber der wahrhafte Philologe; nicht jenes Zerrbild, das die Jahre um 1910 von ihm wiesen, das uns in jungen Jahren erschien, den Wörtern ihre Seele zerstörend, grammatische Formen zu Tode hetzend. [196] Im Jahre 1828 läßt Jacob die Deutschen Rechtsaltertümer in einem starken Bande erscheinen. Ein Buch, in welchem das deutsche Recht von seiner sinnlichen Seite erscheint. Wieder war es der alte Traum, der ihn wie in der Grammatik leitete: "Im Altertum war alles sinnlicher entfaltet, in der neuen Zeit drängt sich alles geistiger zusammen. Es schreitet das Recht von symbolischen Formen zu seiner abstrakteren Fassung fort" –, wie die Sprache, von der er schrieb: "Die alte Sprache ist leiblich, sinnlich, voll Unschuld; die neue arbeitet darauf hin, geistiger, abgezogener zu werden. Man kann die innere Stärke der alten Sprache mit dem scharfen Gesicht, Gehör, Geruch der Wilden, ja unserer Hirten und Jäger, die einfach in der Natur leben, vergleichen. Dafür werden die Verstandesbegriffe der neuen Sprache zunehmend klarer und deutlicher." Die Quellen, aus denen Jacob Grimm das neue Buch zu schöpfen begann, gleichen den Quellen der Grammatik. Wie diese aus allen Dialekten und den lebendigen Mundarten wächst, so stehen die deutschen Rechtsaltertümer vorzüglich aus unsern Weistümern auf. Das sind die Niederschriften der Rechte, welche den altdeutschen Landschaften eignen. "Diese Rechtweisungen durch den Mund des Landvolks", sagt Jacobs Vorrede, "machen eine höchst eigentümliche Erscheinung in unserer alten Verfassung, wie sie sich bei keinem andern Volk wiederholt, und sind ein herrliches Zeugnis der freien und edlen Art unseres eingeborenen Rechts. Neu, beweglich und sich stets verjüngend in ihrer äußeren Gestalt, enthalten sie lauter hergekommene alte Rechtsgebräuche und darunter solche, die längst keine Anwendung mehr litten, die aber vom gemeinen Mann gläubig und in ehrfurchtsvoller Scheu vernommen wurden. Sie können durch die lange Fortpflanzung entstellt und vergröbert sein, unecht und falsch sind sie nie. Ihre Übereinstimmung untereinander und mit einzelnen Zügen alter, ferner Gesetze muß jedem Beobachter auffallen und weist allein schon in ein hohes Altertum zurück." Und: "Die Weistümer des deutschen Rechts sind ihrem Wesen und Gehalt nach völlig vergleichbar der gemeinen Volkssprache und den Volksliedern." – Das ist es: vergleichbar der Volkssprache und den Volksliedern! Und gibt den Schlüssel für Grimms Tun. Sprache und Recht; daneben tritt als Drittes und Lockendstes: der Glaube. So schrieb er 1835 die Deutsche Mythologie Dahlmann zu: "Aus Vergleichung der alten und unverschmähten jüngeren Quellen habe ich in andern Büchern darzutun gestrebt, daß unsere Voreltern, bis in das Heidentum hinauf, keine wilde, regellose Sprache redeten, die sich schon in frühster Zeit zur Poesie hergegeben hatte; daß sie nicht in verworrener, ungebändigter Horde lebten, vielmehr eines althergebrachten sinnvollen Rechts in freiem Bunde, kräftig blühender Sitten pflagen. Mit denselben und keinen andern Mitteln wollte ich jetzt auch zeigen, daß ihre Herzen des Glaubens an Gott und Götter voll waren, daß heitere und großartige, wenngleich unvollkommene Vorstellungen von höheren Wesen, Siegesfreude und Todesverachtung ihr Leben beseligten und aufrichteten, daß ihrer [197] Natur und Anlage fernstand jenes dumpf brütende Niederfallen vor Götzen oder Klötzen, das man, in ungereimtem Ausdruck, Fetischismus genannt hat. Diese Beweisführung fühlt durch meine vorhergegangenen Arbeiten sich erleichtert und gestärkt; das dritte folgt hier innerlich notwendig aus dem ersten und zweiten: ein Volk, zur Zeit wo seine Sprache, sein Recht gesund dastehen und unversiegten Zusammenhang mit einem höheren Altertum ankündigen, kann nicht ohne Religion gewesen sein." Leuchtend steht so sein Ziel vor uns, immer und immer das gleiche Ziel: des alten Volkes Herrlichkeit. Es hat der Anmaßung nicht bedurft, mit welcher die "Vorgeschichte" sich brüstet, das Wort "Barbaren" gelöscht zu haben. Er hatte es längst vor ihr getan. Sein Weg ist diesmal strenger gebunden als jemals vorher; denn ärger als andere schien dieser von Gefahren umlauert. Das Mythologisieren war Mode. Nur strengste Zucht vermochte zu dienen und leichtsinniges Tun als wertlos zu ächten. Er schuf seine Mythologie aus der Quelle, die er als erster und reinlich gefaßt: den sprachlichen Zeugnissen älterer Zeit. Erst wenn ihm diese Genüge taten, zog er herbei, was nahe lag: den Nachklang jener verlorenen Zeit in Volkes Sagen, Märchen und Bräuchen. Wir sehen, wie stark er sich selber zwang; was lag ihm näher, der Rechtsaltertümer aus Weistümern fand, und dessen Grammatik aus allen germanischen Mundarten lieh, die Götterlehre der alten Germanen zuvörderst auf Sagen und Sitten zu gründen, wie seine Nachfolger es getan? Er sah die Gefahr, die nahe lag, und wich ihr schweigsam, besonnen aus. Wir haben noch heute an seinem Buch wenig zu tadeln. Am ehesten wohl, daß er der nordischen Mythologie zu hohe Bedeutung für unsere verlieh. Das hat bis heute auch die Phantasten mit manchem Scheinbild genarrt und betrogen. Aber was hat das in Wahrheit zu sagen, nachdem zum ersten Male der Schatz, der lange verborgen lag, wieder schien? Noch heute leuchtet er, blank und neu, und wird noch lange und freundlich glänzen, dem deutschen Menschen zu einem Trost – und rühmlichem Zeugnis vergangener Zeit. Drei Bücher – von Glaube, Sprache und Recht, jedes allein ein großes Werk, aber zusammen mehr als drei Bücher. Das Herz eines Volkes ist bloßgelegt und ihm gewiesen: das alles bist du! Und eine stolze Mahnung wird laut: Volk, du, mein Volk, sei deiner wert!

Es war ein böser und harter Schnitt, der in das Leben der Brüder geschah. Jacob ward aus Hannover verbannt und mußte es binnen zwölf Stunden räumen; Wilhelm blieb zwar, doch ohne Amt. Sie klagten. Der Rechtsweg ward unterbunden. Die deutschen Regierungen waren sich einig, keinen der "Sieben" zu berufen. Was nützte es ihnen, daß Göttingen siechte, daß niemand den Ruf auf ihre Stühle annehmen mochte, ihren Platz ersetzte? Man sammelt für sie; das deutsche Volk erhielt die Wissenschaft gegen die Fürsten – bis Friedrich Wilhelm IV. endlich die beiden Brüder, halb verlegen, als Mitglieder der Akademie berief. Aber schon vorher war eingetreten, was ihrem Leben die neue Richtung und seine letzte Aufgabe gab. Karl Reimer, ein mutiger, kluger Verleger, schlug 1838 den beiden vor, ein deutsches Wörterbuch zu verfassen. Ein deutscher Bürger gab ihnen wieder, was ihnen die Fürsten weigern wollten: die Arbeit für die Ehre der Deutschen. Jacob schrieb damals an Karl Lachmann, den kritischen gelehrten Freund; der Plan eines deutschen Wörterbuches habe sie anfangs sehr bedrückt. Vieles von alten Plänen fiele nun hin. Aber "wir haben den ernsten Willen und Lust dazu gefaßt. Dabei wollen wir bleiben und uns die Welt so viel nur als möglich weiter gar nicht anfechten lassen. Das Wörterbuch kann uns Stütze und Unabhängigkeit gewähren. Und kommt die Arbeit in Gang und Gelingen, so entsage ich jeder noch so ehrenvollen Anstellung und widme dem Werke alle meine Kräfte". Man hat die beiden niedergeschlagen; sie langen, am Boden noch, nach der [199] Arbeit, die ihres Volkes Namen erhöht. Wer deutsch ist, wird nicht von den Fürsten und deren willkürlichen Sätzen bestimmt; sein Deutschtum bestimmt der Deutsche sich selbst.
Ein ungeheures Werk wird begonnen, welches im Umfang nur Jacob erahnt. Das Wörterbuch soll den Vorrat von Wörtern des deutschen Volkes der vierhundert Jahre – seitdem die heutige Sprache gilt – in alphabetischer Folge verzeichnen. Nicht nur die Wörter, die augenblicklich dem Durchschnittsmenschen geläufig sind, auch seltenere und ausgestorbene. Und es soll weiter die Worte nachweisen, von jedem nachweisen, wo man es finde, welche Schriftsteller und wo sie es brauchen. Und es soll endlich die Wörter deuten. Als Jacob Grimm sein Jawort gab, wußte er, daß er alle Pläne auf eigene Werke begraben mußte, und wußte, daß er das neue Buch, das er sich auflud, nie fertig schriebe. Das war der Anfang. Aber ein zweites haben wir dabei noch zu bemerken. Es ist ein Werk der Gebrüder Grimm. Wir lenken damit noch einmal zurück auf das Verhältnis der beiden Brüder. Immer hat Wilhelm sich untergeordnet, ist Jacob der beiden Führer gewesen. Das änderte sich, als 1825 Wilhelm die Frau nach Hause führte; ein Zeichen, daß der ältere Bruder an Vaters Stelle getreten war. Nun aber dorrte auch Wilhelms Schaffen; er ward ein Herausgeber alter Texte, die Ehe schien ihn ganz zu erfüllen; ein bürgerliches, geruhiges Leben will ihm genügen. Da reißen die Schritte Dahlmanns und Jacobs ihn fort und in ein Unruh-Sein. Plötzlich begann ein neues Tun. Es fing mit kleinen Bemerkungen an, zu Freidanks Grabmal. Zu Silvester – und schritt zu größeren Arbeiten fort. Zur "Sage vom Ursprung der Christusbilder", die noch einmal den alten Träumen romantischer Dichtung entsprossen ist. Der Dichter in ihm war schlafen gegangen; es blieb – die Sehnsucht nach dessen Wegen. Er hatte zu lange der Wissenschaft und ihren Methoden den Zoll gezahlt; nun wurde sie zum Herrn über ihn. Und danach kam das Wörterbuch. Man braucht von ihm und seiner Qual nichts mehr zu sagen; ein Brief an Dahlmann, den Jacob 1858 geschrieben hat, spricht alles aus: "Sie ermahnen mich liebevoll und dringend zu eifrigerer Fortarbeit. Hirzels Briefe tropfen schon jahrelang auf denselben Fleck, zwar mit feinster Schonung, doch so, daß, wie wenn Frauen schreiben, dasselbe Anliegen immer darin enthalten ist, und auch, falls ich sie nicht läse, doch wüßte, was darin steht. Stellen wir uns das Bild des Wörterbuchs einmal lebhaft vor. Ich habe in Zeit von drei Jahren für die Buchstaben ABC geliefert 2464 enggedruckte Spalten, welche in meinem Manuskript 4516 Quartseiten ausmachten. Hier will alles, jeder Buchstabe eigenhändig geschrieben sein, und fremde Hilfe ist unzulässig. Wilhelm wird in den drei darauffolgenden Jahren das D, obwohl er dem Plan entgegen zu sehr ausführt, in 750 Spalten darstellen. Die Buchstaben ABCD erreichen noch nicht ein Viertel des Ganzen. Es bleiben also, mild angeschlagen, noch gegen 13 000 gedruckte Spalten oder nach Weise meines Manuskripts [200] 25 000 Seiten zu schreiben... Ich dachte, als Wilhelm in die Reihe trat, daß ich nun etwas aufatmen und an andere Arbeiten gehn könnte, die sich unterdessen getürmt hatten. Sobald Hirzel sah, daß Wilhelm langsamer schreitet und das Werk zurückblieb, begann er von mir zu begehren, ich solle, ohne das Ende von D abzuwarten, mit E beginnen. Buchhändlerisch war dies nicht unbillig, verdarb mir aber meine Ferien und störte meine Ruhe, denn bei dem Gedanken, alsbald wieder vortreten zu müssen, wies ich auch weit aussehende neue Arbeiten zurück. Daß wir beide zugleich Wörterbuch arbeiten, hat auch äußerlich manches gegen sich. Die Menge von Büchern, die dabei gebraucht werden, mußten bald hier, bald dort weggenommen werden. Da wir nicht in einer Stube sitzen, würde ein beständiges Laufen und Holen entspringen. Ich weiß nicht, ob Sie sich unsere Hauseinrichtung deutlich vorstellen. Fast alle Bücher sind an den Wänden meiner Stube aufgestellt und Wilhelm hat die größte Neigung, sie in seine Stube zu holen, wo er sie auf Tische legt, daß man sie schwer wieder findet. Trägt er sie aber an die alte Stelle, so ist ein unendliches Türaufundzuschlagen, das uns beiden lästig ist." – Ein alter, verknurrter Junggeselle und Eigenbrötler scheint hier zu sprechen. "Aber", fuhr er dann fort, "dies ist nur ein äußeres Hindernis, das aus dem Zusammenarbeiten hervorgeht; die inneren sind viel schwerer. Sie wissen es, daß wir beide von Kindesbeinen an brüderlich zusammenleben und einer ungestörten Gemeinschaft pflegen. Alles, was Wilhelm arbeitet, geschieht mit Sorgfalt und Treue, allein er geht langsam zu Werke und tut seiner Natur keine Gewalt an. Ich habe mir oft im Herzen vorgeworfen, daß er durch mich eigentlich in grammatische Dinge getrieben worden ist, die seiner inneren Neigung fernliegen; er hätte sein Talent, ja alles, worin er mir überlegen ist, besser auf anderen Feldern bewährt. Diese Wörterbucharbeit verursacht ihm zwar auch Freude, doch noch mehr Pein und Not..." Hier wird das Letzte, Menschliche deutlich. Wilhelm ist vergewaltigt worden. Der Bruder hatte ihn in Dinge gestoßen, die seinem Wesen entgegen waren, und zwang ihn nun ans Wörterbuch. Das Joch, für Jacob schon schwer zu tragen, drückte doppelt marternd auf Wilhelms Schulter. Und lastete auf ihm bis an das Grab. Am 16. Dezember 1859 legte sich Wilhelm zur Ruhe nieder. Die Last fiel zurück auf Jacobs Schulter, der nun das Zwiefache tragen mußte. Er schrieb an Weigand: "Sie dürfen mit Zufriedenheit auf die bedeutende Arbeit (Ihres Wörterbuches) blicken und mit der Sicherheit, sie zu vollenden, während in mir das schwere Gefühl lastet, daß ich nicht zu Ende bringen werde; wie fast alles, was ich unternommen habe, Stückwerk geblieben ist. Mein Alter läßt mich erfahren, daß ich zwar noch mich ausbreiten kann in Laub und Äste, aber vielleicht keine Frucht mehr aus dem Stamm treibe." Und wenig später: "Ich fürchte, die allerersten Hefte des Werks haben, von der Neuheit gereizt, manche gelesen; die [201] Fortsetzungen muten sie sich nicht zu, sondern legen sie beiseite zu gelegentlichem Aufschlagen. Es ist aber traurig, für ein nicht lesendes Publikum zu schreiben; das beste, was mir in einzelnen Artikeln gelingen kann, wird vielleicht zufällig in fünfzig oder hundert Jahren wahrgenommen." Ja, dieses Buch fraß ihn fast auf. Wieder an Weigand lesen wir: "Wie lange hätte ich schon geschrieben und immer wieder gedankt, wüßte ich nicht, daß Sie sich ganz in meine Lage denken und vollkommen einsehen, wie schwer mir das Briefschreiben fällt. Zwar schreibe ich viel den ganzen Tag fort am Wörterbuch und mag mich nicht darin unterbrechen..." Ein mühseliger Riese, so schleppt er die Last seinen nie endenden Weg hinaus. Und darf nicht erliegen. Erliegt auch nicht. Sondern wird stärker und immer stärker. Er wächst jetzt über sich hinaus. Am 26. Januar 1860 hält er die "Rede über das Alter". Da heißt es: "Einem freigesinnten alten Manne wird nur die Religion für die wahre gelten, welche mit Fortschaffung aller Wegsperre den endlosen Geheimnissen Gottes und der Natur immer näherzurücken gestattet, ohne in den Wahn zu fallen, daß eine solche beseligende Näherung jemals vollständiger Abschluß werden könne, da wir dann aufhören würden, Menschen zu sein." Hier reckt sich einer vollends empor. Einer, der in die Geheimnisse langt, mit welchen die Gottheit den Menschen umgibt, und dessen Religion es ist, daß das Geheimnis ergründet sein soll. So haben die Männer Newton, Leibniz und andere mehr hinaufgelangt. Es war ihr Beruf, hinaufzulangen. Zu ihnen gesellt sich der greise Mann. Ein kleiner Anfang – in Rausch und Wahn. Tapsende Schritte, zu denen der Bruder in raschem Gelüst den älteren drängt. Danach ein Leben in steter Mühe; ein siebzigjähriges Arbeitsleben, doch köstlich, wie der Psalmist schon weiß. Ein zähes, nie unterbrochenes Ringen – und Wachsen in Arbeit. Und Höherwachsen. Der Bruder blieb am Wege zurück. Es hatte ihn zu Grunde gerichtet, mußte ihn wohl zu Grunde richten. Ein Tun, wie hier es begonnen wurde, forderte Opfer. Auch das Opfer: sich selbst an die Arbeit zu versklaven, sich selbst aufzugeben. Auch das Opfer: das schwerste Gesetz erkennen zu müssen, wie man die kleineren einst erkannte. Niemals hat einer sein Menschen-Sein und dessen Schwäche klarer gesehen und dennoch dem Würger sich heitrer gestellt als dieser einsame, greisende Mann: "So lange uns die Sonne leuchtet, ist Zeit des Wirkens, bis unsre Tage ausgelebt und wie einzelne Tropfen vom Dach niedergefallen sind. Wir treten auf die Erde und schreiten über den Grund hin, bis wir in den mütterlichen Schoß zurücksinken." Am 20. September 1863 legte er sich zur Ruhe nieder.
 Es ziemt, eine letzte Frage zu stellen. Was hat das Leben der Brüder Grimm uns heute zu sagen? Weswegen rufen wir sie neu auf? Die Antwort ist nicht einfach zu geben, denn manches an ihnen lockt zur Besinnung. Etwa das eine: sie waren [202] Bürger. Das Bürgertum des letzten Jahrhunderts in seinen Leistungen, seiner Bedeutung wird an den beiden sichtbar und hell. "Der größte deutsche Mann, der unsere Glaubensfreiheit bewirkte, Luther, war aus geringem Stande, und so ist es in allen folgenden Jahrhunderten. Wir werden immer sehen, daß die Mehrzahl der erweckten großen Geister dem Bürgerstande angehört." Sie zeigen, vor allem Jacob Grimm, das Idealbild des deutschen Gelehrten, der sich und seine Seele hingibt, um aller Gründe Grund zu erkennen, und den kein Scheinbild betrügen kann. Denn das, den Geheimnissen näher zu rücken, das ist sein Glaube. Gottes Geheimnissen näherrücken –, das Wort weist auf ein weiteres hin. Sie spüren den Geheimnissen nach. Auch dem Geheimnis der Poesie. Die Jünglinge tappen ahnend danach, die Männer streben bewußt, zu ergreifen, was Glaube, Recht und Sprache lehren, als Äußerungen des Volkes lehren, – im Volke ruht das Geheimnis verborgen. Wenn die Romantiker packen wollten, was in den Liedern des Volkes lag, geschah das aus ästhetischen Gründen. Hier suchen zwei mehr als schöne Lieder und schöne oder tiefsinnige Mären, bei denen man sich viel denken konnte – hier suchen zwei die Seele des Volkes. Und schreiten wir noch einmal weiter: in ihrem Alter teilen sie aus, was sie an Schätzen mühsam erwarben; das Wörterbuch sollte ein Volksbuch werden, aus dem der Hausvater Weib und Kindern unter der Lampe vorlesen würde. Ihr letztes Arbeiten galt dem Volke. Das ist es, das ist ihr Wesentliches. Sie haben vor allem das Volk geliebt. Und was sie taten, geschah für dieses. Auch dann, wenn sie auf Wegen schritten, auf denen ihnen kein Fachgelehrter, geschweige der einfache Mann folgen konnte. Auch dann geschah es für dieses Volk. Und für die Ehre des deutschen Namens. Der Aufsatz, mit dem wir oben begannen, enthält an seinem Schluß die Worte: "Alle unsere bestrebungen sind der erforschung unserer älteren sprache, dichtkunst und rechtsverfassung entweder unmittelbar gewidmet oder beziehen sich doch mittelbar darauf. mögen diese studien überhaupt manchem unergiebig geschienen haben und noch scheinen; uns sind sie jederzeit vorgekommen als eine würdige, ernste aufgabe, die sich bestimmt und fest auf unser gemeinsames Vaterland bezieht und die liebe zu ihm nährt."
 | |||||||||||