
Nordwestdeutschland - Georg Hoeltje
Geest, Heide und Moor
Der Mittellandkanal zeichnet von der nordwestlichen Spitze des Teutoburger
Waldes aus nach Osten an den Punkten Minden, Hannover, Braunschweig und
Oebisfelde vorbei einen Strich in das Kartenbild der nordwestdeutschen
Landschaft, der höchst anschaulich das Aufhören des Mittelgebirges
und den Beginn des Tieflandes unterstreicht.
Das Tiefland, aufgeschüttet von den Gletschern der Eiszeit, ist weniger
fruchtbar als der Nordrand des Mittelgebirges, über dem wie ein Schleier
der Lößstaub liegt. Die Lößgrenze verstärkt die
Scheide zwischen beiden Landschaftsräumen noch einmal; und wie von
selbst sinkt jenseits dieser Linie die Bevölkerungsdichte auf 60, unter 60, ja
auf 30 und ganz im Inneren des Tieflandes auf unter 30 pro Quadratkilometer.
Die Fläche, die ein Bauer braucht, um existieren zu können, wird auf
diesem Boden immer größer. Die Ernteerträge sind niedrig;
und dazu ist oft ein großer Teil des Bodens Ödland. Die
Kulturfläche schrumpft an den ungünstigsten Stellen bis auf ein
Zehntel des ganzen Besitzes zusammen.
Ödland sind Heide und Moor. Am Ende des 18. Jahrhunderts bedeckten sie
fast lückenlos die ganze Geest, das Tiefland zwischen der Elbe und der
holländischen Grenze, und griffen wie mit Fingern, soweit die eiszeitliche
Aufschüttung reicht, bis an die Küste, die sie bei Esens in
Ostfriesland beinahe und westlich von Cuxhaven tatsächlich erreichten.
Entgegengesetzt griff das Marschenland der Küste mit fruchtbarem
Schwemmboden entlang den großen Flüssen, Ems, Weser und Elbe
tief in die Geest hinein. Als unwirtliche und unfruchtbare Barriere lag das
Geestland damals zwischen dem dichtbesiedelten Rand des Mittelgebirges und
dem fruchtbaren Saum der Küste.
In den letzten hundert Jahren hat sich dieses Bild ein wenig verwischt.
Trockenlegung der Moore und Rodung der Heideflächen haben dem
Ackerbau und der Forstwirtschaft große Flächen erschlossen, Heide
und Moor sind zu Inseln geworden.
[147] Auf allen Seiten bricht
die Flut der Kultivierung Stücke ihrer alten Einsamkeit ab. Sie bestimmen
noch immer das Bild dieser Landschaft, aber nur an zwei, drei Stellen beherrschen
sie es noch wie früher: als Moor im Emsland und als Heide auf dem
Hümmling und dem Landrücken im Regierungsbezirk
Lüneburg zwischen Aller und Elbe, der heute noch den Namen
Lüneburger Heide führt.
Man würde sich eine völlig falsche Vorstellung vom norddeutschen
Tiefland machen, wollte man glauben, es sei flach. Dieser
Landrücken zwischen Aller und Elbe, den im Osten eine an der
Ilmenau entlang leicht gekrümmte Linie zwischen den Punkten Harburg,
Lüneburg, Uelzen und Gifhorn umschreibt und der nach Nordwesten hin
zwischen Bremen und Stade allmählich auf die 10
Meter-Höhenlinie heruntersinkt, erreicht im Wilseder Berg und den
Schwarzen Bergen bei Harburg Höhen von 169 und 155 Metern. Dabei
greifen Täler, deren Sohlen unter hundert Meter Höhe liegen, weit in
sein Inneres hinein.
Aber bei aller reichen Bewegung dieser Landschaft ist der Eindruck nicht etwa
bergig. Alle Umrißlinien sind flach gekrümmt. Man spürt im
Profil dieser Hügel den Schutt, aus dem sie aufgehäuft sind. Nicht
aus festem Stein haben Wasser und Kälte diese Formen genagt; eine vom
Wetter der Jahrtausende verwaschene Moränenlandschaft liegt
vor uns.
Wie Wellen schieben sich die weichen Wölbungen bis zum Horizont
hintereinander. Oft tritt weißer Sand an die Oberfläche, Dünen
treibt der Wind an manchen Stellen vor sich her.
Was hier leben will, muß anspruchslos und zäh sein; die Heide, die
ihre Blätter vor dem austrocknenden Wind zu nadelartigen Gebilden
zusammenkrümmt, die Birke, die am Saum der langen sandigen
Straßen steht, der Ginster, der mit seinen gelben Blüten als erster im
Mai den düster schweigenden Frühling der Heide unterbricht, und
der Wacholder, "der zäheste unter den Nadelhölzern unserer Heimat
und vielleicht der zäheste Baum unseres Kontinents" (Koelsch), der so
unendlich langsam wächst, daß er hunderte von Jahren zu seinem
Leben braucht. Manchen, der heute noch sein blaugrünes Stachelfell wie
ein bepelzter alter Kobold in der Sonne glitzern läßt, haben vielleicht
schon die Musketen der Dänen im Dreißigjährigen Kriege
gestreift; und es ist nicht unmöglich, daß mittelalterliche Lanzen
seine Nadeln berührt haben und die Hufe eines Pferdes, das Heinrich den
Löwen von Braunschweig gegen Bardowiek getragen hat.
Es ist, als ob in dieser Luft und diesem Raum nur Fuß fassen könnte,
was langsam wächst. Seit die Welt das schnelle Wachstumstempo der
Geschichte angeschlagen hat, ist die Heide immer mehr verlassen worden. Aber in
jener Zeit, die wir die Vorgeschichte nennen, als noch nicht aus
begrifflichen Staatenwesen, sondern aus Stamm und Familie wie aus dunklen
Quellen alle Bewegung sich sickernd ergoß und in unendlich langsamem
Kreislauf wieder in diesen Schoß zurückfloß, in jener
unbewußten, wenig künstlichen Zeit war die Heide das Land, in dem
die Menschen nordischer Rasse die riesigen Steingräber errichteten, die
heute noch bei Fallingbostel und an manchem anderen Ort eine dunkle Ahnung
erwecken von der tiefen Verwandtschaft dieser vorzeitlich gewaltigen und
stum- [148] men Geschöpfe
mit der trägen, eintönigen und unendlichen Hügellandschaft,
die sie getragen hat.
Die ungeformten Bausteine dieser Hünengräber, die großen
Findlingsblöcke lagen in den Moränen bereit, aus deren Sand der
Wind oder die suchende Hand des Jägers auch die erste Waffe, den
Feuersteinkeil, wühlte.
In diesen Gräbern sind keine Götterbilder gefunden worden, weder in
menschlicher noch in tierischer Gestalt, wohl aber Töpfe und Schalen mit
spröde geometrischen Rißornamenten. Ihr nüchterner Ernst
hebt sich auffallend ab von dem anmutigen, gestaltreichen Formenspiel einer
südlicheren Gruppe steinzeitlicher Gefäße, der sogenannten
Bandkeramik, die in Deutschland von der Donau bis zum Harz reicht und deren
Töpfereien mit phantasievollen, oft sogar farbigen
Spiral- und Schleifenformen verziert sind, die ebenso lustig wie
oberflächlich über die konstruktiven Einteilungen des
Gefäßkörpers hinweghuschen.
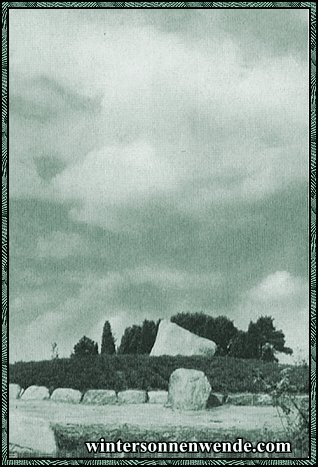
[132]
Lüneburger Heide.
Ruhestätte Hermann Löns'.
|
Diese beiden Gruppen trennt wieder der Mittelgebirgsrand etwa auf der
Höhe Hannover - Braunschweig. Die ersten ernsten und
kargen Gefäße finden sich nördlich dieser Linie und
ausnahmslos beherrschen sie dann die Heide im Norden der Aller.
Es ist ein ernstes und karges Land. Und von den Pflanzen, die zur Eiszeit hier ihr
Leben fristeten, haben einige ihren Standort bis heute nicht verlassen. Die
arktische oder subarktische Zwergbirke findet man in Deutschland einzig in der
Lüneburger Heide.
Es sind genügsame Tiere, die hier ihr Fortkommen finden. Vielleicht schon
Genosse des Steinzeitmenschen zieht die Heidschnucke heute noch
über die gleichen Hügel und zerkaut das zähe Kraut,
trägt drei Pfund grober Wolle im Jahr und
20 - 25 Pfund Fleisch im Herbst, wenn sie fett ist. In einfachen
giebeligen Ställen verbringt die Herde die Nacht.
Der erste Schafstall wird nicht anders ausgesehen haben als die, die heute noch
stehen: Ein Fundament aus Findlingsblöcken, zwei Längsreihen
hölzerner Ständer, das lange Satteldach tief heruntergezogen, so
daß es oft den Erdboden berührt oder nur eine niedrige Wand stehen
läßt. Mit Heideplaggen bedeckt oder, wo Roggen gebaut wird, mit
Stroh, war es Stall und wurde zum Haus, in dessen mächtige giebelseitige
Einfahrt die Erntewagen fahren konnten, während das Vieh im schmalen
Raum zwischen Ständer und Außenwand seinen Platz hatte.
Der Mensch richtete sich am hinteren Ende der großen Halle seinen
Schlaf- und Herdraum her. Hier wuchsen später dann Kammern und Stuben
und schließlich auch abgetrennte
Küchen- und Vorratsräume - aber ursprünglich ging das
alles: Wohnen, Kochen, Schlafen und Essen im gleichen Raume vor sich, in dem
das Vieh mit den Ketten klirrte und stampfte. Und heute noch findet man hier und
da in einem alten Bauernhaus eine Diele, an deren Ende der Kessel über
dem offenen Herdfeuer hängt.
Wo Schnucken sind, sind auch Bienen. Die Schnucke hält den
Wald durch ihren Weidegang nieder. Wo kein Wald wächst, breitet die
zähe Heide sich aus, die Weide der Bienen. Der Imker mit Pfeife und
Drahtkorb gehört wie der Schäfer zum Bilde der Heide.

[135]
Bienenzucht im Papenburger Moor (Emsland).
|
[149] Aber beide, Schnucken
und Bienen sind in stetem Rückgang begriffen. Die ökonomische
Denkart unserer Tage - ein Symptom der wachsenden Schnelligkeit, der
Schnelligkeit des Geldumlaufs - hat an die Stelle der Heide den Wald und
zwar den wirtschaftlich gepflegten Forst gesetzt.
Im gleichen Jahrhundert, in dem die Heide literarisch und malerisch von Annette
von Droste-Hülshoff und dem Hamburger Maler Morgenstern, von
Liliencron und Löns entdeckt und dem Bewußtsein der Menschen
nahegebracht worden ist, hat sie in der Forstwirtschaft ihren schärfsten
Feind gefunden. Seit 1768 die erste Kiefer gepflanzt worden ist, hat ein
immer mehr um sich greifender nützlicher Wald schon etwa 33 Prozent
des Bodens erobert. Die Heide nimmt heute nur noch etwa ein Viertel der
Gesamtfläche ein, und es gibt keinen Punkt mehr, der weiter als drei
Kilometer vom nächsten Walde entfernt wäre.
Die Schafzucht hat von 1873 - 1928 im Regierungsbezirk Lüneburg einen
Rückgang um 93 Prozent ihrer Tiere zu verzeichnen.

[132]
Lüneburger Heide. Totengrund bei Wilsede.

[133]
BdM. auf Fahrt.
|
Der Heide und ihrer alten Welt werden jetzt schon Reservate bereitet. Das
bekannteste ist der Naturschutzpark um den Wilseder Berg mit der phantastischen
Wacholder-Szenerie des Totengrundes.
Die wirtschaftliche Geschäftigkeit, die Wald und Schweinezucht auf
Kosten von Heide, Bienen und Schafen vorwärts trägt, stammt von
außen. Sie stammt von dorther, wohin beim Beginn der geschichtlichen Zeit
Leben und Wirken aus dem Inneren der Heide fortgeströmt waren.
Das geschichtliche Leben hat sich immer nur an den Rändern der Heide
abgespielt. Die Städte, die in ihrem Bereich einen alten Namen oder heute
noch einen gewissen Ruf ihr eigen nennen, liegen am Rande: Lüneburg,
Uelzen, Celle und Verden, mit Einwohnerzahlen über 10 000 und
sogar 20 000. Dort sind auch die berühmten Stätten
kirchlichen Gemeinschaftslebens zu finden, die mittelalterlichen
Damenklöster, in denen vom 13. bis zum 16. Jahrhundert jene
einzigartigen Schätze von Bildteppichen entstanden, die wir heute in
Lüne bei Lüneburg und Wienhausen bei Celle bewundern. Im
Inneren der Heide sind Fallingbostel, Soltau, Walsrode und Hermannsburg heute
nur Sammelpunkte des Fremdenverkehrs und haben sich als Städte nie von
dem umgebenden Lande gelöst.
Schräg an dem einen der drei Heideränder fließt die Elbe
vorbei. Wo sie ihn zum ersten Mal berührt, quert spätestens seit
karolingischer Zeit ein wichtiger Übergang den Strom. Bei Artlenburg ist
Karl der
Große um 800 über die Elbe gegangen, gegenüber von
Artlenburg ist noch der Rest einer karolingischen Befestigung zu erkennen, und
dort beginnt auch der Limes Saxoniae, der über Mölln nach
Kiel führt und Holstein gegen die Slawen abgrenzte.
Als einer der drei Handelsplätze zwischen Slawen und Germanen richtete
Karl der Große den Ort Bardowiek ein, etwas abseits der Elbe, an
der Ilmenau. Der Name erhält die Erinnerung an die Langobarden, die hier
einmal saßen. Heute eine dörfliche Siedlung, hatte sich der Platz im
frühen Mittelalter zum mächtigsten Kaufmannsort zwischen Weser
und Elbe entwickelt, als Heinrich der Löwe ihn 1189 zerstörte
zugunsten seines Lüneburg, das nun wieder etwas weiter
landeinwärts angelegt worden war.
[150] Hier hatte der Markgraf
der Ottonen, Hermann Billung, seine Burg auf dem Kalkberg, einem der wenigen
durch die eiszeitliche Decke ragenden Teile des Grundgebirges. Die
wirtschaftliche Bedeutung einer mächtigen Solequelle, die heute noch etwa
25 000 Kubikmeter Sole im Jahre spendet, kam hinzu und ließ am
Fuße der Burg eine Bürgersiedlung entstehen, die zu einer der
mächtigsten Hansastädte heranwuchs, schon im 14. Jahrhundert eine
direkte Schiffsverbindung nach Lübeck durch eigenen Kanal
(Vorläufer des heutigen Elbe-Trave-Kanals) sich schaffen konnte und mit
drei gewaltigen Backsteinkirchen und zahllosen gut erhaltenen
Straßenfluchten alter Bürgerhäuser ein prachtvolles Beispiel
einer Handelsstadt des Mittelalters darstellt.
Als Handelsstadt ist sie ein Randgebilde der Heide. Ihre Kraft kommt von der
Elbe und dem Elbübergang, dessen Stelle so eindeutig vorgezeichnet ist,
daß heute wieder eine Eisenbahnbrücke, die einzige auf einer Breite
von etwa 100 Kilometern, hier bei Lauenburg den Fluß
überschreitet.
Ganz ebenso ein Randgebilde ist Uelzen und zwar im
militärischen Sinne. Die Slawen, die nach dem Abzug der Elbgermanen, zu
denen die Langobarden gehörten, von Osten her in die freigewordenen
Gebiete einströmten und um 600 die Elbe überschritten, wurden,
nachdem die zeitweilig von Karl d. Gr. zur Grenze gemachte Elbe nach
seinem Tode wieder aufgegeben worden war, schließlich auf der
Ilmenau-Linie zum Stehen gebracht.
Das ist die Tat der Ottonen und ihrer Markgrafen, der Billunger, gewesen. Und
unter den Burgen, die dieser Widerstandslinie ihre Stärke verliehen,
Bienenbüttel, Bevensen, Bodenteich und Gifhorn, ist Uelzen eine der
wichtigsten gewesen und hat sich dank der fruchtbaren Umgebung, die im
Uelzener Becken den Anbau von Weizen und Zuckerrüben und eine
für die Heide auffällige Bevölkerungsdichte von 60 Menschen
auf dem Quadratkilometer ermöglicht, eine sichere landstädtisch
ruhige Existenz bis in unsere Tage bewahrt.
Das Land östlich von jener Linie, zwischen Ilmenau und Elbe, in dem die
Slawen sich so lange haben halten können, heißt heute noch das
hannoversche Wendland und weist in Ortsnamen wie Lüchow, Gartow,
Wustrow, in der verbreiteten Dorfform des Rundlings und im Körperbautyp
der Bevölkerung den Einfluß slawischer Elemente deutlich auf.
Am südlichen Rande der Heide liegt Celle. Um 1290 neben einem
älteren Dorf planmäßig angelegt, erlebt es seinen großen
Aufschwung im 14. Jahrhundert, als die welfischen Herzöge ihre
Residenzstadt Lüneburg, wo die Städter 1371 die Burg auf dem
Kalkberg zerstören, verlassen und die kleine Allerstadt zur Residenz
erheben. Heute noch schwebt um die einfachen Häuserzeilen mit ihren
bäuerlich breiten Fachwerkgiebeln ein Hauch von höfischer Kultur,
als deren Mittelpunkt das Renaissanceschloß erscheint und deren
späte Ausstrahlungen sich in manchem Bau des 18. Jahrhunderts und des
Klassizismus zeigen.
Diese Celler Linie kommt schließlich in Hannover zur Regierung. Celle
blickt nach Süden, und jedenfalls ist es als Stadt und Residenz nur am Rand
der Heide zu denken. Ganz ebenso wie im Westen Verden als Stadt und
ehe- [151] maliges Bistum den
Rand der stillen Heide und ihren Austritt ins fruchtbare Flußland der Weser
markiert.
Der Ort, nicht weit entfernt vom Zusammenfluß von Aller und Weser,
besitzt eine natürliche Wichtigkeit. Die
Aller-Schiffahrt, heute ohne Bedeutung, war im Mittelalter eine der wichtigsten
Verbindungen zwischen Braunschweig und Bremen. Nicht zufällig wird
das schauerliche Strafgericht der Sachsenkriege gerade hier vollstreckt worden
sein. Der Domturm von Verden steht wie ein Signal vor der westlichen Spitze der
Heide. Aber die Heide liegt schon im Rücken der Stadt, und die breite und
lichte Halle des Domes blickt nach Westfalen weseraufwärts.
Vom Domturm geht der Blick über weite grüne Wiesen.
Dreißig Kilometer stromab liegt Bremen. Weserdampfer und
Schleppzüge fahren auf Minden zu. D-Züge verbinden Bremen und
Hannover. Zwischen der Heide im Osten und ländlicher Einsamkeit im
Westen greift an der Tieflandweser entlang von der See her ein schmaler
verkehrsreicher Korridor nach Süden und gabelt sich bei Nienburg, um das
Steinhuder Meer zu umgehen, das mit Moor und Heide am nördlichen
Ufer sich dicht an den großen Verkehrsweg des Mittelgebirgesrandes, an die
Köln - Berliner Strecke und den Mittellandkanal
heranschiebt.
Eine größere Moorfläche hat in der Geschichte stets die
Kräfte konzentriert, nämlich auf die Stellen, wo sie umgangen
werden konnte und wo man andererseits diese Moorpässe sperren konnte.
Um das Steinhuder Meer drängen sich heute noch
Schaumburg-Lippe und die Provinzen Hannover und Westfalen.
Eine ganz entsprechende Situation ist im Westen der Tieflandweser um den
Dümmer entstanden. Sein flaches Becken, durch das die Hunte
fließt, ist, wie das Steinhuder Meer von den Rehburger Bergen auf einer
Seite, gleich auf zwei Seiten: im Südosten von den Stemmerbergen und im
Nordwesten von den Dammerbergen flankiert. Diese, bis zu 180 und 145 Meter
Höhe aus einer durchschnittlich 50 Meter hohen Umgebung sich erhebend,
haben im Zusammenhang mit den anschließenden Moorflächen hier
eine Art natürliches Sperrfort geschaffen, dessen sich im Mittelalter alle
benachbarten Territorien zu bemächtigen trachteten.
Aus dem unentschiedenen Kampf gingen schließlich hervor: Oldenburg, das
von Norden her die Dammerberge besetzt hält, das Bistum Minden (heute
die Provinz Westfalen) mit den Stemmerbergen, und zwischen ihnen von
Südwesten und Nordosten her das Bistum Osnabrück und die
Grafschaft Diepholz den Dümmer erreichend. Da diese schließlich an
Hannover fielen, fädelt sich heute die Provinz Hannover durch den
Dümmer-Paß zwischen Oldenburg und Westfalen wie durch ein
Nadelöhr.
Welche Bedeutung diese Naturfestung auch im Zusammenhang mit dem
Mittelgebirgsrand hat, zeigt sich darin, daß ein Forscher wie Theodor
Mommsen den Ort der Varusschlacht in dem schmalen Durchgang zwischen den
Dümmer-Mooren und dem Wiehengebirge im Süden gesucht hat.
Die Moorbrücken, die Mommsen mit in seine Beweisführung
hereinzog, kilometerlange Bohlwege in den Mooren an der Hunte, scheinen
allerdings nicht römischen, sondern ger- [152] manischen Ursprungs
und überhaupt wohl nicht zu militärischen Zwecken hergestellt
gewesen zu sein.
Noch einmal ragt im nordwestdeutschen Flachland ein Stück des alten
verschütteten Gebirges durch die eiszeitliche Decke: wie eine Klippe erhebt
sich der Sandstein des Burgberges von Bentheim jenseits der Ems aus
der moorigen, waldigen flachen Umgebung. Ruisdael hat ihn oft gemalt.
Niederländisch war lange Zeit hier Kirchen- und Schulsprache. Aber
trotzdem gehört der Fels, und nicht nur er selbst, heute zu Deutschland.
Denn an den ausgezeichneten Punkt hat sich natürlich eine Dynastie von
Territorialherren geheftet. Durch Heirat immer enger verknüpft mit
innerdeutschen Herrschaften, Steinfurt im Münsterlande, Tecklenburg am
Teutoburger Wald und Rheda an der oberen Ems, greift die ehemalige Grafschaft
Bentheim heute entlang dem Laufe der Vechte weit in niederländisches
Gebiet und überschreitet jene natürliche Grenze, die links der Ems
durch die von Norden nach Süden verlaufende Linie des Bourtanger Moors
vorgezeichnet ist.
Das Geestland zwischen Weser und Ems ist kultivierter als zwischen Weser und
Elbe. Zwar dehnen sich zwischen Weser und Hunte, zwischen Nienburg und
Diepholz noch breite Moore, aber die Heide ist fast völlig verdrängt.
Wald in kleinen Fetzen, nicht in so breiten Flächen wie zwischen Aller und
Elbe, und vor allem Wiesen und Felder sind an ihre Stelle getreten.
Schweinezucht, die sich um Hoya verdichtet, läßt hier eine
fast westfälische Fleischverarbeitung entstehen.
Gewerbe und Industrie, Handel und Verkehr treten in den Berufen der
Bevölkerung ganz zurück. Die kleinen Städte sind nur vom
Lande her zu verstehen. Man kann am Sonntag über die Straßen
fahren, ohne anderen Fuhrwerken als Pferdewagen und Fahrrädern
schwarzgekleideter Kirchgänger zu begegnen. Der bunte Ausflugsverkehr
größerer Städte fehlt völlig.
Ein karthographischer Überblick über die wissenschaftlichen
Büchereien Niedersachsens weist zwischen Holland und Weser, zwischen
Osnabrück und Oldenburg einen restlos leeren Fleck auf. Alle moderne
Wirtschaftlichkeit und Aktivität hebt nicht das Stigma der
Abgeschlossenheit und Formlosigkeit auf, das der Schuttboden dieser Landschaft
und die Grenzenlosigkeit ihrer Horizonte allen Äußerungen des
Lebens langsam aufgeprägt hat.
Wie geringfügig der Unterschied zwischen der geschichtslosen Heide im
Osten und dieser westlichen Welt im Grunde ist, kann ein Blick vom
Hümmling lehren. Bis zum Horizont dehnen sich im Norden graue und
gelbbraune, baum-, haus- und weglose Moore. Ein Urstromtal der Eiszeit zog hier
vorbei, ein anderes im Westen, in seinem Bett die Ems, und ein drittes im
Süden, wo jetzt die Hase fließt.
Zwischen ihnen erhebt sich der sandige Rücken des
Hümmlings bis zu 72 Meter Höhe. Eintönige
Heideflächen wechseln mit jungen Kiefernforsten, die
Bevölkerungsdichte stand 1925 auf 26 Einwohnern pro Quadratkilometer,
weist aber in der rein katholischen Gegend einen sehr hohen
Geburtenüberschuß von über 12 Prozent (in den Jahren
1925-1933) auf.
[153-160=Fotos] [161] Dieses ganze Geestgebiet bis zur Hunte, an der die Grenze zwischen katholischer und evangelischer Geestbevölkerung liegt,
gehörte bis zur Säkularisierung zum Bistum Münster. Bei
Sögel steht noch ein Jagdschloß des Kurfürsten Clemens
August, Clemenswerth, um 1740 von seinem Münstertaner Hofarchitekten
Joh. Konr. Schlaun errichtet. Aber dieses Rokoko-Kleinod liegt im Kranze seiner
zierlichen Pavillons, die ihre Namen nach den geistlichen Besitzungen des Herren,
Paderborn, Osnabrück, Köln, Hildesheim, Münster
führen, seltsam verschlossen und fast verwunschen in dem armen und
kargen Land.
Der Kreis Hümmling weist als einziges größeres Gebiet in
Nordwestdeutschland einen allgemeinen Anbau von Buchweizen auf,
jener mehligen Knöterichpflanze, deren bucheckerartigen Früchte
dem Menschen als Grütze, deren Blätter dem Vieh als Futter und
deren rötlich-weiße Blüten den Bienen als Weide dienen, und
die, was das wichtigste ist, auch auf moorigem und sandigem Boden gut
gedeiht.
Dabei ist dieses arme Land wie die Lüneburger Heide ein altes, uraltes
vorgeschichtliches Land. Reste der ältesten germanischen Siedlungsformen,
das echte Haufendorf, dessen Höfe locker und unregelmäßig in
Eichenkämpen zerstreut lagen, will man im Grundriß seiner
Ortschaften wieder entdeckt haben.
Wäre solche Zähigkeit des Festhaltens, solche Langsamkeit des
Wandels ein Wunder in einem Lande, in dem noch vor 50 Jahren die uralte
"Heidewirtschaft" des ewigen Roggenbaus üblich war? In einem Land, in
dessen Mooreinsamkeit im Saterland, gleich nördlich vom
Hümmling, noch in unseren Tagen Menschen eine Sprache sprechen, die
sonst auf dem Festland innerhalb der deutschen Grenzen ausgestorben ist, das
Friesische?
Der Moorgürtel am Nordrand der Geest hat strenger noch als die
unwirtliche Heide absperrend gewirkt. Wenige Korridore führen von der
Küste zum Mittelgebirge. Einer von diesen folgt der Ems.
Kein Eindruck kann dies Wissen stärker vermitteln, als ein Weg am Abend
vom Hümmling herunter zur Ems. Mit der Kleinbahn von Sögel nach
Lathen. Weite Strecken Ödland, schweigende Forsten, weidende
Schafherden, stille Dörfer im Licht der untergehenden Sonne. Und dann im
Dunkel das Tal. Unruhige Geschäftigkeit der Bahnstation. So klein sie ist,
Eilzüge halten hier. Signale glühen. Autobusse queren die Gleise.
Und unter den Eisenbrücken der Ems ziehen mit grünen und roten
Laternen die Schleppdampfer rauschend ihre Spur, Kähne voll Erz,
Kähne voll Kohle, Kähne voll Eisen und voll Getreide von Emden
zum Ruhrgebiet, von Dortmund zur Nordsee führend. Meppen und Lingen
heißen die nächsten Stationen landeinwärts, kleine
Städte, aber alle am Fluß oder am Kanal und an der Bahn, alle am
schmalen Band des Verkehrs, das die schweigende Welt von Heide und Moor
rasch durchschneidet.
Ein schmales Band - und jenseits dehnt sich schon wieder das Moor, das
Bourtanger, das unser Emsland von der holländischen Provinz
Westfriesland trennt. Dort in dem Zipfel Land, den die Zuider See von den
südlichen Niederlanden abschnürt, hat sich friesische Mundart und
Tracht besonders erhalten.
[162] Westfriedland
gehört ursprünglich zu Ostfriesland. Beide haben ihr Schwergewicht
in der Marsch. Und gegen beide wird die von Sachsen bewohnte Geest abgeriegelt
durch den Moorgürtel, der längs der Ems mit dem Bourtanger Moor
beginnt und bei Papenburg rechtwinklig nach Osten umknickt, die Ems
überschreitet und nördlich vom Hümmling bis herüber
zur Hunte (bei Oldenburg) sich ausdehnt.
Aber Ostfriesland ist nicht nur Marschland, wenn auch sein Schwergewicht in der
Marsch ruht. Die Marschen sind nur ein um einen breiten Geestsporn gelegtes
Band. Und dieser Geestsporn ist auf seinem Rücken ebenfalls mit Mooren
bedeckt. Und ebenso trägt die andere Geestzunge, die zwischen Weser und
Elbe bis nach Duhnen bei Cuxhaven reicht, Moorbedeckung, besonders
nordwestlich der Linie
Bremen - Stade in den Tälern von Hamme und Oste. Dort
liegt im Teufelsmoor das Dorf Worpswede.
Von Worpswede geht die literarische und vor allem die malerische
Entdeckung der Moorlandschaft aus, in deren Geschichte die Namen Mackensen
und Modersohn dieselbe Bedeutung haben, wie Liliencron und Löns
für die Heide. Es ist merkwürdig, daß diese beiden
Entdeckungen gewissermaßen nur die Kehrseite des endgültigen
Todesurteils für das Entdeckte sind. Die gleiche Zeit um die
Jahrhundertwende, die den jungen Malern die Augen öffnet für die
stillen Schönheiten schwarzer Kanäle, silberner Birken und brauner
Torfkähne, hält auch schon die gewaltigen Maschinen bereit, die den
im Torf der Moore enthaltenen Heizwert im großen und restlos gewinnen
und ausbeuten sollen.
Noch ist die Generation nicht gestorben, für die jene ersten Bilder des
Teufelsmoores eine neue Welt bedeuteten, da stehen schon Kraftwerke im Moor.
Wiesmoor in Ostfriesland verbraucht jedes Jahr 100 000 Tonnen
Torf. 700 000 Menschen erhalten elektrisches Licht aus seinen Dynamos. In
seinen Treibhäusern werden Tomaten, Gurken und Spargel gezogen. Wenn
der Brennstoffverbrauch gleich bleibt, wird es noch zwei Jahrhunderte dauern, bis
die dort vorhandenen 12 000 Hektar abgetorft sind. Aber sie werden einmal
abgetorft sein. Das Schicksal des Moores ist heute schon entschieden: es wird
verschwinden.
Es ist noch gar nicht lange her, daß der Mensch den Kampf gegen das Moor
systematisch begonnen hat. Papenburg und Großefehn in
Ostfriesland sind die ältesten Moorkolonien in Deutschland. Sie stammen
aus den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts. Und es ist merkwürdig
zu sehen, wie dieses sonderbare Element den Menschen, der damals noch weit
vom konsequenten Rationalismus des letzten Jahrhunderts entfernt war, schon zu
Anlagen zwang, die das Denken unserer Zeit vorweg zu nehmen scheinen.
Eine Siedlung, die aussieht wie ein leibgewordener Fertigungsvorgang: ein
Entwässerungsgraben, schnurgerade vom festen Land ins Moor
hineingetrieben ist gleichzeitig Kanal, transportiert Baumaterialien hinein und
Torf heraus; im gleichen Tempo mit ihm wachsen rechts und links die
Kolonistenstellen, Häuser in Reih und Glied, die jeweils jüngsten
immer am unfertigsten und behelfsmäßigsten, die älteren schon
solider. Ein Bild, wie wir es aus den zusehends [163] wachsenden
Straßen unserer Großstädte gewohnt sind, damals entstanden
aus dem Zwang der harten, nur mit höchster Anspannung aller
gemeinsamen Intelligenz und Disziplin zu bewältigenden Arbeit.

[136]
Alter Moorkanal bei Papenburg (Emsland).
|
Papenburg ist das Musterbeispiel einer solchen Siedlung. Dreihundert Jahre alt,
dehnt es sich heute immer längs dem Kanal über 10 Kilometer weit.
Die Backstein-Fahrwege rechts und links bleiben sich gleich von einem bis zum
anderen Ende, aber die Häuser ändern sich. Am Anfang nahe der
Ems Fabriken: ein Metallhüttenwerk, eine Maschinenfabrik, eine
Schiffswerft, eine Glashütte und vor allem Torffabriken, deren Torfmull
und Torfstreu zu Schiff verschickt wird. 3 343 Schiffe mit über
100 000 Tonnen Ladung in einem Jahre (1929) im Papenburger Hafen!
10 000 Einwohner brauchen Kirche, Rathaus,
Schulen - die Häuser haben alle den gleichen Typ, eine für
Kolonisten verkleinerte Nachbildung des friesischen Bauernhauses. Mehrere
Stunden kann man zu Fuß immer geradeaus durch diese merkwürdige
Backsteinstadt wandern. Dann werden die Reihen der Häuser auf einmal
lockerer; unbebaute Plätze werden sichtbar oder kleine Katen. Das Moor
tritt dichter heran an die Straße. Wir sind draußen, sind am Ende der
Stadt, am vorläufigen Ende; denn im nächsten Jahr ist sie ja schon
weiter gewachsen.

[134]
Papenburg (Ems). Der Ort erstreckt sich 7 Kilometer lang zu beiden Seiten des Kanals.
|
Jetzt hat sie es schon nicht mehr weit bis zum Sandrand des Hümmling.
Aber wenn sie ihn erreicht haben wird, ist es nicht aus; dann wird es in die Breite
weitergehen. Schon jetzt zweigen Querkanäle von dem Hauptkanal an
vielen Stellen ab und kurz vor seinem Ende kreuzt ihn seit zwei Jahren der
Küstenkanal, der seit 1927 im Bau und 1935 vollendet worden ist und die
Ems mit der Unterweser verbindet. Er folgt dem Urstromtal und mündet bei
Oldenburg in die Hunte. Von ihm aus wird die Erschließung der Moore
weitergetrieben.
Seit 1750 sind auch die Moore zwischen Bremen und Stade in Kultur. Etwa 40
Dörfer sind in den hundert Jahren, in denen die hannoversche Regierung
die Arbeiten leitete, neu angelegt. In unserer Zeit wird schließlich auch der
Arbeitsdienst für diese Aufgaben eingesetzt, so vor allem im Bourtanger
Moor.
Und man kann es beinahe errechnen, wann der letzte wuchernde Fleck Torfmoos
erstickt sein, wann die verborgene Insel des Saterlandes aufgebrochen sein wird
und aller Sumpf zwischen den Rändern heidiger Hügel und den
fetten Wiesen der Marsch in gut entwässertes, rationell gedüngtes
und bebautes Land verwandelt sein wird, auf dem in neuen
regelmäßigen Häusern viele neue Menschen leben und sich
ernähren werden.
Aber vielleicht ist dieses Zukunftsbild, dessen Konturen sich in Papenburg und
vielen anderen Moorkolonien heute schon abzeichnen, gar nicht so sehr dem Bilde
fremd, das diese Landschaft heute noch bietet. Jedenfalls, was ihr
Verhältnis zum Menschen angeht. "Wir sind gewohnt mit Gestalten zu
rechnen - und diese Landschaft hat keine Gestalt." (Rilke.)
Dieselben Menschen, die in ihrer großen schlichten Vorzeit keine
Gestaltenwelt in der Kunst kannten und keine Gestaltenwelt in der Religion,
dieselben Menschen sind es, die heute mit eiserner Nüchternheit, mit einer
hartnäckigen Geradlinig- [164] keit, die diese
entsetzlich gestaltlose Landschaft in ihnen hatte heranwachsen lassen,
Kanäle und Straßen nach der Schnur ziehen und an ihnen siedeln.
Es sind dieselben Menschen, die jahrhundertelang, eine ganze reiche Geschichte
lang wie ohne eigenen Willen dahin zu leben schienen und die in der
aufrüttelnden Geschäftigkeit unserer Tage auf einmal beginnen,
einen fast mathematischen Willen dieser Landschaft aufzuzwingen, in der sie
bisher sich zu verlieren schienen.
"Wir sind gewohnt aus Bewegungen auf Willensakte zu
schließen - aber diese Landschaft bewegt sich nicht, sie scheint ohne
eigenen Willen."
|