
[62]
Oldenburg
Diedrich Steilen
Tagaus, tagein rollen die Wogen des Meeres an die Küste, tagaus, tagein
rennen sie gegen das Land, tagaus, tagein mahnt des Meeres Rauschen den
Menschen, wohl auf seiner Hut zu sein. Seit Jahrhunderten schon ringt der
Oldenburger mit der See und ward ihrer doch niemals völlig Herr. Es ist ein
unaufhörlicher Kampf, in dem es kein Erlahmen geben darf.
Küstenanwohner heißt, allzeit Streiter für die heimatliche
Scholle sein. Die Wacht am Meere nahm alle Kräfte des Oldenburger
Landes so sehr in Anspruch, daß es sich um die Vorgänge im Reiche
wenig oder gar nicht kümmern konnte. Da es zudem im ruhigen
Nordwestwinkel Deutschlands weder von feindlichen Kriegsscharen
überrannt, noch von mißgünstigen
Nachbarn - von kleinen Plänkeleien
abgesehen - mit Krieg überzogen wurde, konnte es sich
ungestört den eigenen Lebensfragen widmen. Oldenburg war niemals wie
die Pfalz oder Schlesien Schauplatz blutiger Schlachten, noch suchten seine
Herrscher, wie Braunschweigs Fürsten, Kriegsruhm, sondern gingen ganz
auf in der Fürsorge für das eigene Land; sie fühlten sich als
Väter des Landes. So blieben alle Kräfte der Heimat erhalten und
wirkten sich in Werken des Friedens aus. Oldenburg betrieb unermüdlich
und unentwegt eine innere Kolonisation und beschränkte diese keineswegs
auf den alten Stammbesitz, sondern zog, sooft neue Gebiete hinzukamen, diese
alsbald in die treue Fürsorge ein. Dadurch aber schweißte es um sein
Gebiet einen Reif, der den Staat fester als Eisen und Stahl zusammenfügte.
Indem eine weise Staatskunst so die Landeswohlfahrt als höchstes Ziel
hinstellte und diesem selbst mit aller Kraft zustrebte, überbrückte sie
innerhalb der Bevölkerung alle Gegensätze. Protestanten und
Katholiken fühlen sich durch den Staat ebenso innig verbunden wie der
wohlhabende Marschbauer mit dem minderbemittelten Geestbauer und dem
ärmsten Moorkolonisten. Dabei verleugnet weder der
Münsterländer noch der Butjadinger seine Eigenart; jeder bekennt
sich mit einem gewissen Stolz zu seinen Wesenszügen und denkt keinen
Augenblick daran, sie fahren zu lassen. Und doch kommt es jedem aus
Herzensgrund, wenn er spricht: Ich bin Oldenburger und will es bleiben!
Zur Zeit der Hanse gab es an Oldenburgs Küste noch keinen
größeren Hafen. In den deutschen Handel schaltete sich Oldenburg
viel später ein, erst vor etwa hundert Jahren, als die ersten Fabriken im
Lande entstanden. Oldenburgs Lage am Meere wurde bedeutsam, als Deutschland
im 19. Jahrhundert in die Reihe der Seemächte eintrat. Als es damals galt,
zur Lösung deutscher Aufgaben beizutragen, zögerte Oldenburg
nicht einen Augenblick. Zweimal leistete das Land der werdenden deutschen
Kriegsflotte vaterländische Dienste. Bereitwillig bot es 1848 der deutschen
Bundesflotte, die Admiral Brommy befehltigte, in Brake einen Heimathafen. Als
der erste Flottentraum [63] verflogen war, und
Preußen dann wenige Jahre später daran ging, eine eigene
Kriegsflotte zu schaffen, konnte es solche Pläne nur durch Oldenburgs
Entgegenkommen verwirklichen. Der preußische Staat grenzte damals noch
nicht an die Nordsee, mußte sich also zur Anlage eines Hafens nach
fremdem Gebiete umsehen. Oldenburg erkannte sogleich die deutsche Sendung
Preußens und trat, sobald es darum angegangen wurde, am Jadebusen soviel
Land ab, als für einen Hafen nebst Stadt erforderlich war. Durch das
schnelle Aufblühen Wilhelmshavens wurden die drei angrenzenden
oldenburgischen Dörfer Bant, Heppens und Neuende mit emporgerissen:
aus ihnen erwuchs die Stadt Rüstringen, die heute 50 000 Einwohner
zählt und unbeschadet der politischen Grenze mit Wilhelmshaven eine
große wirtschaftliche Einheit bildet.
Seine Lage an der Weser wußte Oldenburg geschickt zu nutzen, indem es
durch den Elsflether Zoll, des es mit Zustimmung des Reiches von 1624 bis 1820
erheben durfte, von dem Gewinne des auf Bremen gehenden Handels zehrte. Die
Zollgefälle setzten den Landesherrn in die Lage, überall in seinem
Staate die bessernde Hand anlegen zu können. Der vorzügliche
Zustand der Oldenburger See- und Flußdeiche ward in jener Zeit eingeleitet.
Der Bremer Handel gab der Oldenburger Flotte lange Zeit den Nährboden.
In welchem Umfange das der Fall war, beleuchtet blitzartig die Tatsache,
daß zu Beginn des 19. Jahrhunderts die europäischen Fahrten
für den Bremer Handel fast ausschließlich von Elsflether und Braker
Segelschiffen bestritten wurden. Die weitere [64] Folge war ein
blühender Schiffbau, sowohl an der Weser als auch auf dem Ammerlande.
Das Holz lieferten die heimischen Wälder. Auch mancher Walfänger
entstand auf den Werften an der Weser und ermöglichte es Oldenburg, sich
an den Fahrten in die Arktis zu beteiligen. Als sich aber im 19. Jahrhundert die
Wirtschaft umschichtete, änderte sich das Bild schnell. Bremerhaven,
welches 1827 begründet wurde, entzog den Häfen zu Elsfleth und
Brake bald einen großen Teil ihres Verkehrs. Der Übergang zu immer
größeren Fahrzeugen und zum Eisenschiffbau versetzte den alten
Oldenburger Werften den Todesstoß, und das Dampfschiff
verdrängte den Segler. Zählte die Oldenburger Handelsflotte 1893
noch 83 stolze Dreimaster, so war 1910 kein einziges Schiff mehr davon
vorhanden. Die um jene Zeit begründete
Oldenburgisch-Portugiesische Dampfschiffahrts-Gesellschaft aber sah sich bald
gezwungen, um bestehen zu können, ihren Sitz nach Hamburg zu
verlegen. Daß sie weiterhin die Oldenburger Flagge führt, ist nur ein
magerer Trost für das Land. Heute hat lediglich der Kleinschiffbau und die
Flußfischerei am Oldenburger Ufer der Niederweser eine Heimstätte.
Da blüht auf kleinen und kleinsten Werften der Bootsbau in solchem
Umfange, daß wir an der ganzen Nordsee kein Gegenbeispiel aufzeigen
können. Vor allem werden Rettungsboote für die Großwerften
der Weser und Elbe, aber auch Brandungsboote für die afrikanische
Küste geliefert. Dem eigentlichen Kleinschiffbau, der sich auf
Heringslogger, Schleppkähne, Küstenfahrzeuge erstreckt, dienen die
Werften zu Elsfleth, Hammelwarden, Brake und Nordenham.
Die Verhältnisse längs der Niederweser wurden durch die
Weser-Korrektion, die Bremen um 1890 betrieb, völlig umgestaltet.
Damals wurde der alte Hafen Elsfleth vom offenen Strom abgedrängt;
dennoch sind seine Beziehungen zur See keineswegs erloschen. Die
Navigationsschule besteht nun schon über hundert Jahre, und die
Schulschiffe sind in Elsfleth beheimatet. Der Deutsche Schulschiffverein, dessen
Gründer und Förderer der letzte Großherzog, Friedrich August,
war, will der deutschen Handelsmarine einen tüchtigen, auf Segelschiffen
geschulten Nachwuchs an Offizieren zuführen. Brake gewann durch die
Korrektion; die größten Frachtdampfer können den am offenen
Flusse gelegenen Hafen erreichen. Die Stadt entwickelte sich zu einem
bedeutenden Umschlag für Getreide, der sich auf die Schweinezucht im
eigenen Lande stützt. In guten Jahren liefern die oldenburgischen
Schweinemästereien 700 000 fette Tiere. Erhebliche
Getreidemengen werden natürlich auch den binnenländischen
Märkten zugeführt; aber für den Absatz bedeutet es einen
fühlbaren Nachteil, daß der Versand ausschließlich mit der
Bahn erfolgen muß. Der Küstenkanal, der das Binnenland auf dem
Wasserwege erschließen soll, harrt noch immer der Vollendung. Geradezu
sprunghaft entwickelte sich Nordenham, welches etwa Bremerhaven
gegenüberliegt. Von Nordenham, welches ungefähr mit
Wilhelmshaven gleichaltrig ist, sprach man wohl hoffnungsfroh als von
"Oldenburgs Zukunftsecke" und wollte damit zum Ausdruck bringen, daß
es dem Lande an dieser Stelle gelingen müsse, an dem industriellen
Aufschwung Deutschlands teilzunehmen. Lange Zeit war Nordenham Stapelplatz
für Petroleum und Getreide, vorübergehend auch Liegeplatz der
großen Lloyddampfer. Vor dem Weltkriege siedelten sich hier dann eine
Reihe industrieller Werke an: die Seekabelwerke, die Zinkhütte, die
Hochseefischerei Nordsee, eine Werft, eine Superphosphatfabrik und andere
Betriebe.
[65] Die Bewohner des
Küstenlandes führen einen ständigen Kampf mit dem
Meergott und werden dadurch gestählt. Für den Oldenburger trifft
das ganz besonders zu. Er hat wie kaum ein anderer mit den Fluten gerungen und
gestritten. Das Meer, erfüllt von Laune und Tücke, ist kein
friedlicher Nachbar. Einst baute es mühselig den Boden auf, der heute als
Küste seine Ufer säumt. Dann aber zerstörte es wie ein
frechtrotziges Kind oft wieder, was es selbst schuf. Der Mensch ward zum
Schützer des Meergeschenkes, als er den güldenen Reif des Deiches
um das Land legte, welches den Fluten entstieg.
Nur eine Spanne lassen sich die Naturkräfte bändigen, um sich
sodann der Fesseln zu entledigen und mit um so größerer Kraft
vorzustoßen. Jetzt deckt das Meer im Norden Oldenburgs weite
Flächen ehemaligen Landes. Wo einst inmitten blumiger Wiesen
Dörfer und Höfe lagen, singen heute die Wogen ihr uraltes Lied. Im
Jadebusen feiert der Meergott seinen größten Triumph über
schwache Menschenkraft. Zwar glückte ihm der Einbruch nicht mit einem
Schlage. Lange genug tastete er umher, als er große Wellen gleich
Vorposten übers Land schickte, bis er es dann entschlossen durch eine
gewaltige Sturmflut an sich riß. Mit der Julianenflut des Jahres 1164
unternahm er den ersten großen Vorstoß; die Clemensflut setzte 1334
die Zerstörung fort. Ihr folgte 1362 die Marcellusflut. Und als die
Antoniflut 1511 verebbte, war der Jadebusen vollendet. Bis an die hohe Geest von
Dangast rauscht seitdem das Meer über alten Kulturboden, von dem bei
niedrigem Wasser überschlickte Pflugfurchen und die Stümpfe
verschlungener Wälder zeugen.

[63]
Vergehende Insel im Jadebusen.
|
Noch manch andere Schreckensnacht hinterließ ihre Spuren in Kolken und
Braken. In langer Reihe begleiten sie den Deich und erzählen von
gewaltigen Brüchen, die weite Strecken Landes verwüsteten und den
Menschen zu immer neuen Kämpfen mit den Elementen zwangen. Lange
mußte er sich quälen, bis es ihm gelang, die Bruchstellen wieder zu
schließen, und nach unsäglichen Mühen glückte es ihm
hier und da, den Deich vorzuschieben und dadurch altes Land
zurückzugewinnen. Noch heute steht der Mensch im Außendeiche,
um durch Dämme und Grüppen weiteres Land aus dem Meere zu
heben. Nur innerhalb des Jadebusens kam die Landgewinnung zum Stillstand,
weil hier durch weiteres Vorschieben der Deiche Ebbe und Flut behindert
würden, das Fahrwasser der Jade offenzuhalten. Darauf kann aber im
Hinblick auf den Kriegshafen Wilhelmshaven nicht verzichtet werden. Den
großen Verlust an Millionenwerten, die in den dortigen Anlagen stecken,
gleicht der Zuwachs an Land nicht im entferntesten aus. Deshalb mußten
neuerlich Pläne, wie sie hier bei der Suche nach Arbeitsbeschaffung mit
einem Seitenblicke auf die Zuider-See auftauchten, zum Scheitern verurteilt
werden.
Sobald die Oldenburger Grafen um 1520 die Marschen zwischen Weser und Jade
in ihren Besitz gebracht hatten, trugen sie Sorge, die Stromspaltungen im
Mündungsgebiete der Weser zu schließen und den inselhaften
Charakter dieser Marschlandschaft auszutilgen. Es gelang durch die
unablässige Arbeit eines halben Jahrhunderts. Heute säumen hohe,
feste Deiche das ganze Land. Der Schutzwall ist so stark, daß nach
menschlichem Ermessen auch die stärksten Fluten daran zerschellen
müssen. Unter staatlicher Aufsicht stehen 247,9 km Deich, die
insgesamt 117 100 ha Land schützen. Auf 1 m Deich
entfallen demnach 0,473 ha Land oder 1 ha muß für 2,11 m
Deich aufkommen. In den Deich- und Sielabgaben trägt der
Küsten- und Marschbewohner ständig eine beträchtliche
Last.

[67]
Fischer in Wesermünde. Beim Schollenfang.
|
[66] Das Meer
nimmt - das Meer gibt. In den letzten 150 Jahren bauten die Fluten in der
Wesermündung eine Insel von 1750 ha Fläche auf, die
Luneplate. Sie reicht bis an die Stadt Wesermünde, gehört aber zum
größten Teile zu Oldenburg und wurde vor wenigen Jahren landfest
gemacht. Da wächst weiter im äußersten Winkel zwischen
Jade und Weser seit etlichen Jahrzehnten eine neue Insel aus dem Meere, die alte
Mellum. Vorläufig besteht dort nur ein Vogelschutzgebiet, das im Sommer
von einem Vogelwart betreut wird. Geologen und Naturforschern wird dort die
seltene Gelegenheit, das Entstehen eines Eilandes zu studieren.
Von den ostfriesischen Inseln gehört Wangeroog zu Oldenburg; es ist ein
bekanntes, gern aufgesuchtes Seebad. Als Seegrenze gegen Ostfriesland gilt die
goldene Linie, etwa die Verlängerung der Harlemündung. Unter dem
Druck der Westwinde macht Spiekeroog jetzt Miene, auf oldenburgisches
Hoheitsgebiet zu wandern.
Auf engem Raum, nur etwa 60 km breit, von der Weser bis fast zur Ems,
120 km lang, von den Ausläufern des Wiehengebirges bis zur
Nordsee, vereint Oldenburg miteinander die weite ebene Marsch, das dunkle
geheimnisvolle Moor und die wellige Geest. Jede Landschaft behauptet ihren
eigenen Ausdruck, so daß das Gesamtbild mannigfaltig und
abwechslungsreich wird.
Bis zu den Häusern Bremens erstreckt sich der fruchtbare
Marschgürtel, der den wertvollsten Teil des Landes ausmacht. Er
füllt den Ostrand an der Weser und den Norden am Meere. Wie das Meer,
flach und eben, ist es auch die Marsch, die sich im Laufe langer Zeiten aus seinen
Ablagerungen aufbaute. Keine Anhöhe, kein Hügel unterbricht die
Weite der Ebene, es sei denn, daß Menschen in mühsamer Arbeit
eine Wurt schufen, um dort sicher vor den Fluten des Wassers zu wohnen. Soweit
das Auge reicht dehnen sich die grünen Weiden, nur durchschnitten von
den feinen Wasseradern der schnurgeraden Gräben, im Frühling mit
den leuchtenden Farben der Blumen übersät, im Sommer belebt von
einer großen Zahl schwarz-weißer Rinder und edler Pferde. Im
Winter, wenn das Wasser in der Gräben zu dickem Eis erstarrt ist, und
Rauhreif auf dem Lande liegt, hallen die weiten Flächen wieder von dem
Geschrei der Klootschießer und den anfeuernden Rufen der Zuschauer. Hin
und her fliegt die Kugel, bis ein Gegner, in die Enge getrieben, sich als besiegt
bekennen muß. Jedes Kind kennt die guten Klootschießer im
Lande.
In der Marsch brachte es der Mensch, sobald er nur den Boden zu meistern
verstand, zu Wohlstand; nur die sumpfigen Randstreifen bereiteten ihm
zunächst unbezwingbare Hindernisse und lagen darum unbenutzt. Erst als
die Meister der Entwässerungskunst, die Holländer, zu Beginn des
12. Jahrhunderts in die Bremer Gegend kamen, gaben sie durch ihr Beispiel die
Möglichkeit, auch diese Gebiete zu besiedeln. In jener Zeit wurde die
Moorseite des Stedingerlandes in lange, schmale Streifen aufgeteilt, die von der
Marsch übers Moor bis an die Geest reichten.
Der Wohlstand in der Marsch weckte früh den Neid und die Gier der
Nachbarn. Nach dem reichen Stedingen griff der bremische Erzbischof durch den
Raubzug des Jahres 1234. Eine erdrückende Übermacht von Rittern
und Abenteurern mordete die freien Bauern dahin. Fremde Söldner
überschwemmten das Land. Aber nur eine kurze Spanne Zeit wurden sie
des unberechtigen Besitzes froh, dann verließen sie das Land, und
Söhne [67] der alten
Bauerngeschlechter setzten die Arbeit an der Väter Scholle fort. Auf dem
Schlachtfelde hält ein schlichter Obelisk das Gedächtnis der Helden
wach, die für Freiheit, Ehre und Besitz kämpften und erlagen. Nach
den Marschen an der Wesermündung streckte der Oldenburger Graf 1514
seine Hand; nur mit Hilfe fremder Söldner glückte es ihm, die
freiheitsliebenden Bauern unter seine Macht zu
zwingen. - Die Herrschaft Jever, welche im wesentlichen die Marsch
westlich des Jadebusen umfaßt, fiel 1575 durch Erbgang an das Haus
Oldenburg und schloß den Ring an der Küste. Jever, die Stadt der
Kunst, Sage und Geschichte! Der hochragende Schloßturm mit der
zwiebelförmigen
Kuppel - Jevers Wahrzeichen - beherrscht das Stadtbild.
Der hohe Stand der Oldenburger Viehzucht gründet sich vornehmlich auf
die alten Marschen, während in den jüngeren Marschen und auf den
Groden Ackerbau getrieben wird.
Das Oldenburger Pferd genießt Weltruf. "Das edelste Produkt unserer
heimatlichen Flur ist seit Jahrhunderten das Pferd, unserer Landwirtschaft Stolz
und Freude", hieß es in der Adresse, mit der Oldenburger Bauern dem
Altreichskanzler 1895 anläßlich seines 80. Geburtstages zwei edle
Zuchtstuten nebst Füllen überbrachten. Bis ins 16. Jahrhundert reicht
die Neigung Oldenburger Fürsten für alle edlen Pferde zurück,
und Graf Anton Günther vermochte während des
dreißigjährigen Krieges seinen [68] Wünschen
mehrfach dadurch Nachdruck und Erfolg zu verleihen, daß er Fürsten
und Feldherren Rassepferde schenkte. In jener Zeit setzte bereits eine
zielbewußte Zuchtpflege ein; zudem erließ der Staat früh
Vorschriften und stellte die Pferdezucht auf eine gesetzliche Grundlage.
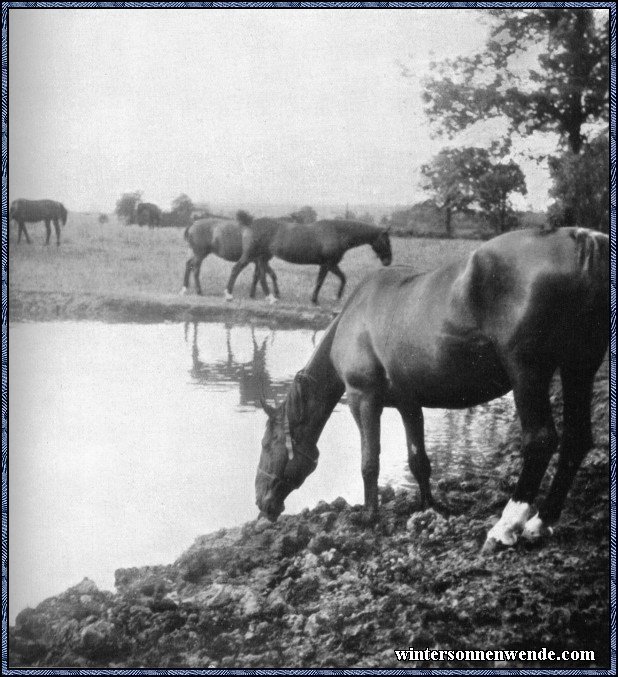
[73]
Oldenburgische Zuchtpferde auf der Weide.
|
Lange Zeit glaubte man, die Marsch sei unerschöpflich reich. Heute
weiß man, daß solche Ansicht irrig ist. Die Fruchtbarkeit der Marsch
beruht im wesentlichen auf dem Kalkgehalt des Bodens. Im Außendeich,
wo die Flut das Land überspült, verjüngt sie ständig die
Kraft des Landes. Seitdem aber Deiche die Marschen säumen, wurde der
Kalkgehalt nicht ergänzt, wohl aber zehrten die Pflanzen von ihm, und der
Regen wusch ihn in die Tiefe. So kommt es, daß die oberen Schichten mehr
oder weniger entkalkt sind, während die tieferen noch Kalk enthalten.
Durch Wühlen oder Kuhlen werden deshalb vielfach die unteren Schichten
an die Oberfläche gebracht und die oberen in die Tiefe gestürzt.
Zum Hausbau schenkt die Marsch dem Menschen nur das Allernotwendigste. Wo
der Baugrund zu feucht war oder Überschwemmungen zu befürchten
waren, wurden Hügel, Wurten, wie der Volksmund sagt, aufgeworfen. Ein
ganzer Landstrich, das alte Oldenburger Besitztum Land Wührden auf dem
rechten Weserufer, erhielt von diesen Wurten seinen Namen. Das Haus selbst ist
wie die Landschaft und die Menschen einfach, groß und klar im Aufbau.
Aus knorrigen Eichen wurden Fachwerk und Balkenlage gefügt,
wenigstens in den älteren Gebäuden. Die Wände werden mit
Ziegelsteinen, welche aus Ton gebrannt sind, ausgefüllt. Die Kunst des
Ziegelbrennens stammt aus Holland und wurde in Deutschland durch die Huder
Mönche bekannt. Die Ruinen des ehemaligen Klosters beweisen, in
welchem Grade sie ihr Können zu meistern verstanden. Die leuchtend rote
Farbe des Ziegels1 verleiht dem Hause ein frohes
Ansehen, besonders wenn er auch noch als Dachbelag gewählt wurde.
Häufig genug wird das Dach aus Reit gemacht, jenen schlanken Halmen,
die überall wachsen, wo sich Wasser zeigt. Das mächtige Dach,
durch nichts in seiner klaren Gestalt unterbrochen, läßt den
mannshohen Unterbau nahezu verschwinden. Im Schutze der Bäume
scheint es fast aus der Erde zu wachsen. Im Küstengebiete herrscht heute
das Friesenhaus; östlich des Jadebusens gab es vor 1795 noch kein
Friesenhaus. Seitdem aber dringt es immer weiter vor und wird auch schon auf der
Geest heimisch. Während der Bauer im Sachsenhause seine Ernte
mühsam auf den Balken bringen muß, lagert sie im Friesenhause auf
dem Boden. Dieser wirtschaftliche Vorteil und der geringe Holzbedarf für
den Aufbau lassen ihm immer mehr neue Freunde gewinnen.
Für seine Kirchen verwandte der Marschbauer gerne den rheinischen Tuff
oder den Wesersandstein und griff erst später zum Backsteinbau. Die
Kirchen in den Marschen waren lange Zeit die einzigen Steinbauten und gleichen
kleinen Festungen. Hinter ihre starken Mauern flüchteten die Bewohner mit
ihrer wertvollsten Habe, wenn Seeräuber an das Ufer stiegen oder Feinde
ins Land eindrangen. Darum sind auch die Kirchtürme so massig, ja fast
klotzig. Jahrhunderte überdauerten diese Gebäude und waren den
Anschlägen der Eindringlinge ebensosehr ausgesetzt wie den Angriffen der
Elemente; aber [69] sooft der Bau zu wanken
drohte, wurde er durch Eisenanker wieder zusammengehalten. Die
Außenwände scheinen oft damit übersät.
Zwischen Marsch und Geest schieben sich die Moore, vor allem auf der Grenze
nach Ostfriesland hin; längs der Flüsse und Bäche dehnen sich
große Flachmoorgebiete. Daß ihre Entwässerung erst unter
holländisch-friesischem Einfluß geschah, hörten wir schon;
vorher waren sie dem Menschen unzugänglich. Sie lieferten den
Anwohnern in der Marsch als notwendigen Brennstoff den Torf, da bei der
Waldarmut des Landes das vorhandene Holz zum Bauen verwendet werden
mußte. Auch heute werden die Oldenburger Moore in weitem Umfange
durch Torfstich genutzt. Ansehnliche Mengen verlassen das Land als Torfmull
nach den kanarischen Inseln, um dort zum Verpacken der Früchte zu dienen.
Der Erlös aus dem Oldenburger Torfmull reicht hin, um die gesamte
Bananeneinfuhr Deutschlands zu bezahlen.
Die Hochmoore waren lange Zeit allein auf mühsam hergestellten
Bohlwegen an wenigen Stellen zu begehen. Schaudernd nur wagte sich der
Mensch in die Nähe der Moore; im Sausen des Windes glaubte der einsame
Wanderer die lockenden Worte böser Geister zu vernehmen und die
Jammerrufe ruheloser Seelen zu hören. Um die Mitternachtsstunde, wenn
verführerische Irrlichter hin- und herhuschen, wenn die Riesenhalme des
Schilfes aufgeregt raschelten und flüsterten, wenn Blasen aus der
schwarzen Tiefe stiegen und das Wollgras aufgeregt nickte, klangen aus den
unergründlichen Wasserlachen die Glocken versunkener Dörfer.
[70] Neuzeitliche
Arbeitsweisen, vor allem Maschinen und Kunstdünger, wandelten das Bild.
Der schon erwähnte Küstenkanal erschließt große
Hochmoorgebiete. Heute geht dort der Pflug, weidet dort das Rind, und die
Erträge, die das Land jetzt liefert, stehen hinter denen der Marsch kaum
zurück.

Die Mitte und den Süden des Landes erfüllt die Geest, der
älteste Boden. Hier liegen noch ausgedehnte Heideflächen, die weder
durch die Forstwirtschaft noch durch andere Kulturen erfaßt wurden. Die
Oldenburger Geest, vor allem die Gegend von Wildeshausen und Ahlhorn
trägt so viele Spuren vor- und frühgeschichtlicher Besiedlung wie
kaum ein anderer Landstrich Nordwestdeutschlands. Da liegt südlich
Wildeshausen das Pestruper Gräberfeld; über 300
Hügelgräber aus der Eisenzeit umfaßt es noch heute. Um es in
seinem Bestande zu sichern, wurde das 36 ha große Feld schon 1908
vom Staate erworben. Die bekanntesten und größten
Hünengräber treffen wir auf der Ahlhorner Heide, die Visbecker
Braut, den Bräutigam sowie den durch prächtige Eichen
geschmückten Heidenopfertisch. Wir stehen hier vor Steinsetzungen von
gewaltigem Ausmaße, die uns immer wieder mit Ehrfurcht erfüllen
müssen gegenüber einem Geschlechte, das hier vor Jahrtausenden
lebte und in diesen Malen zu uns spricht.
Der natürliche Mittelpunkt der Geest liegt in der Stadt Oldenburg selbst. Ihr
Namen, der sich später auf das ganze Land übertrug, bedeutet soviel
wie: alte Burg. Als Brückenort hatte die Siedlung von altersher einige
Bedeutung; hier kreuzte der Handelsweg von Holland zur Weser, die Hunte, hier
zweigte die friesische Straße auf Jever ab, und durch die Osenberge
führte eine alte Heerstraße nach dem Süden. Die
späteren Bahnlinien folgten im wesentlichen jenen alten Straßen. Die
Stadt Oldenburg hatte zu keiner Zeit einen nennenswerten Handel aufzuweisen,
wenn auch die Hunte bis Oldenburg schiffbar ist, und der Schiffsliegeplatz am
Stau zu Zeiten ein recht malerisches Bild zeigt. Lediglich als Residenz und
Landeshauptstadt durch den Sitz der Behörden konnte Oldenburg vor den
anderen Städten des Landes einen großen Vorrang gewinnen. Die
Zahl der Einwohner beziffert sich gegenwärtig auf 55 000. Die Stadt
macht auf den Fremden einen vornehmen und gewinnenden Eindruck. "Die Stadt
der Rosen" nennt sie sich selbst und kehrt dadurch ihr Wesen als Blumenstadt
heraus. Als Alterssitz erfreut sie sich im ganzen Lande größter
Beliebtheit. Vor allem aber gipfelt das ganze kulturelle Leben des Landes in der
Hauptstadt.
Fast vor den Toren der Landeshauptstadt beginnt das Ammerland; der Name
bedeutet soviel wie niedriges, wässeriges Land. Das Zwischenahner Meer,
zwar nicht der größte, aber weitaus der schönste norddeutsche
Binnensee, erinnert durch die Wälder an seinen Ufern an Ostpreußens
Landseen. Die Geschichte und Kultur des Ammerlandes findet in dem
Zwischenahner Freilichtmuseum, dem bedeutendsten und vollkommensten
Niederdeutschlands, einen lebenswahren Spiegel.

[69]
Ammerländer Bauernhaus.
(Freilichtmuseum Bad Zwischenahn.)
|
Aus der Wesermarsch steigt die Delmenhorster Geest auf, auf der von weither die
Stadt Delmenhorst mit ihren Türmen und Schornsteinen sichtbar ist. Die
letzten vierzig Jahre wandelten die vorhin stille Landschaft in einen lebhaften
Industrieort. Schon lange bestanden hier Korkschneidereien; auf ihre
Abfälle gründete sich dann eine umfangreiche Linoleumfabrikation.
Sanft gewellt zieht sich die Geest hin. In den Boden schnitten [71] Bäche ihren Lauf.
Wiesen wechseln mit Feldern; kleine Waldstücke zaubern immer wieder
neue Bilder. Der Hasbruch krönt den Rand der Geest, während im
Süden das Huntetal zwischen Huntlosen und Wildeshausen
Schönheiten birgt, wie man sie hier kaum erwartet. Wildeshausen mit
seinem alten gotischen Rathause und der mächtigen Alexanderkirche darf
sich rühmen, eines der ältesten deutschen Schützenfeste zu
feiern.
Den südlichen Teil des Landes mit den Städten Cloppenburg, Vechta
und Löningen nennt man das Münsterland, weil es mit Teilen des
Hümmlings früher zum Niederstift Münster gehörte. Es
kam erst nach 1800 als Entschädigung für den ausfallenden
Elsflether Zoll an Oldenburg; aber die Beziehungen nach Münster, zumeist
kultureller Art, sind auch heute noch nicht ganz erloschen. Mehr als anderswo
stellt das Münsterland eine durch den Menschen geschaffene
Kulturlandschaft dar. Durch nie erlahmenden Fleiß und mühevolle
Arbeit wandelte der Münsterländer seine vielfach karge Scholle in
ertragreichen Boden. Auf den Höfen sitzen knorrige Bauerngeschlechter,
die ihre Ahnenreihe durch Jahrhunderte zurückverfolgen können.
Gleich dem Ammerlande besitzt das Münsterland eine alte, hohe Kultur,
die in einer reichen Volkskunst einen klaren Niederschlag fand. Aus einer
völlig falschen Beurteilung des Münsterlandes heraus
kümmerte man sich lange Zeit nicht um diese Dinge. Es blieb dem
Cloppenburger Heimatmuseum, einer ebenso eigenartigen wie glücklichen
Verbindung von Museum und Schule, vorbehalten, durch seine erst in den letzten
zehn Jahren geschaffene Sammlung klar herauszustellen, daß das
Münsterland wohl von den Nachbarn im Ammerlande, in Holland und im
Artlande beeinflußt wurde, aber in seiner Volkskunst dennoch eigenen
Wege ging und sie zu einer seither nicht geahnten Höhe entwickelte. Das
Münsterländer Bauernhaus, ein Typ des niedersächsischen,
zeichnet sich [72] nicht nur durch reiches
Fachwerk aus, sondern weist als Zierat vielfach die schönsten Schnitzereien
auf.

[71]
Die Große Eiche bei Hasbruch.
|
Der Staat Oldenburg - in den Zahlen sind die beiden Streubesitze Birkenfeld und
Eutin einbegriffen - deckt 6400 qkm Fläche, davon sind
668 qkm mit Wald bestanden, was etwa 10,4% entspricht. Marsch und
Moor tragen keinen Wald, so bleibt als Hort der Wälder allein die hohe
Geest. Seit langem sind die großen Eichen des Hasbruchs auf der
Delmenhorster Geest berühmt. Altehrwürdige Bäume sind's,
die zum Teil noch in die Tage Karls des Großen zurückreichen.
Bäume im Alter von über tausend Jahren, die nun in ihrem
Greisenalter, obschon sie Spuren des Verfalls tragen, noch mit allen Fasern am
Leben hängen.
Der Neuenburger Urwald in der Gegend von Varel reicht nicht an die
Größe des Hasbruchs heran, aber an Schönheit und
Stimmungsgehalt übertrifft er ihn. Solche Märchenschönheit
voll köstlicher Pracht und tiefem Zauber, wie sie uns hier begegnet,
läßt uns den deutschen Wald liebgewinnen. Vor Jahrzehnten glaubte
man, sowohl im Neuenburger Urwalde wie im Hasbruch, besonders schöne
und alte Teilstücke des Waldes als Ausschlußgebiete von jedem
forstmännischen Eingriff freihalten zu sollen, damit das natürliche
Bild des Waldes nicht getrübt werde. Aber schon heute sieht man,
daß man von trügerischen Voraussetzungen ausging. Sich selbst
überlassen, wandelt sich der Wald und stirbt. Die Buche, begünstigt
durch das gegenwärtige Klima, verbreitet sich rasch, verdrängt, da
sie die stärkere ist, die Eiche und unterdrückt sie. Der alte
Eichen-Hudewald, das Bild, welches uns lieb und erhaltenswert erscheint,
läßt sich dauernd nur sichern, wenn des Menschen ordnende Hand
nicht fehlt.

Heute merkt man es nicht mehr, daß durch das nördliche Oldenburg
etwa über Varel nach Brake einst die Stammesgrenze zwischen Friesen und
Sachsen lief. Lediglich die friesische Wede, d. i. Friesenwald im
nördlichen Oldenburg, erinnert noch daran. Das einzigste Gebiet
Oldenburgs, in dem heute noch friesisch gesprochen wird, ist das Saterland an der
Leda. Allerdings waren die ersten Siedler hier Sachsen, die Friesen kamen erst
später und gewannen die Oberhand. Heute ist das Saterland neben Friesland
die einzigste Stätte, wo sich das Friesische als Umgangssprache gehalten
hat, wenn auch der Kreis derer, die noch am Friesischen hängen, von Jahr
zu Jahr kleiner wird. Dagegen erwachte nach dem Kriege unter den Friesen im
ganzen Küstenstreifen das Stammesbewußtsein in beachtlichem
Umfange. Trennt die Westfriesen auch die politische Grenze von den
Ost- und Nordfriesen, stammeskundliche Belange pflegen sie dennoch gemeinsam
mit den Friesen im Reiche, und es darf hier vermerkt werden, daß der
zweite Friesentag im Oldenburger Lande, und zwar im alten Jever, stattfand. Aber
die Beteiligung an diesen Tagen geht wohl mehr von einer literarisch oder
künstlerisch interessierten Oberschicht als von breiten Volkskreisen aus,
und es darf bezweifelt werden, daß sich heute im Zeichen des Verkehrs
noch Volksgrenzen schärfer wieder hervorheben lassen.
Oldenburg ist das Land der selbständigen Bauern. Große Güter
sind so gut wie unbekannt. Auf den Großgrundbesitz (über
100 ha) entfallen nur 1,5% des Landes. Der Einzelhof herrscht vor. Der
Oldenburger geht ganz auf in seiner Arbeit. Mag sein, daß er es sich eine
[73] Weile überlegt, ob
er diese oder jene Arbeit angreifen soll, faßt er aber an, so läßt
er nicht mehr los. Dem Breiten und Behäbigen in seinem ganzen Auftreten
entspricht seine plattdeutsche Umgangssprache, in ihren traulichen Klang legt er
sein ganzes Fühlen und Denken, seine Seele. Über alles liebt er seine
Heimat, es ist ihm heiligstes Bekenntnis, wenn er in seinem Nationalliede
singt:
Wer deinem Herde naht, fühlt augenblicklich,
Daß er hier heimisch ist, er preiset sich so glücklich;
Führt ihn sein Wanderstab auch alle Länder durch,
Du bleibst sein liebstes Land, mein Oldenburg!
|