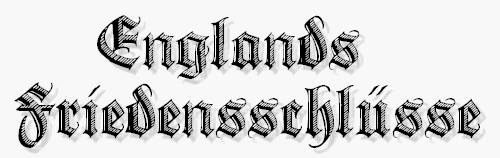 Wolfgang Michael, Professor der Geschichte an der Universität Freiburg i. B.
Verlagsbuchhandlung Dr. Walther Rothschild, [2] Vorwort Die folgenden Ausführungen geben in erweiterter Form einen Vortrag wieder, den ich zuerst am 19. Juni 1918 in Freiburg gehalten habe. Sie waren niedergeschrieben und gedruckt, bevor das deutsche Angebot eines Waffenstillstandes an den Präsidenten Wilson erging. Durch die sich überstürzenden Ereignisse der letzten Wochen mögen sie in einigen ihrer Anspielungen auf die Gegenwart überholt erscheinen. Und doch glaube ich, sie der Öffentlichkeit unterbreiten zu sollen. Denn wenn das historische Bild, das sie geben, richtig gezeichnet ist, so kann seine Betrachtung auch für die kommenden Ereignisse von Nutzen sein. England und wir! Es gilt, das Staatsschiff mit fester Hand hindurchzuführen durch die Gefahren der Stunde und die Zukunft des Vaterlandes sicherzustellen, so wie einst Preußens größter König es in schwerer Lage vollbracht hat. Seiner Taten und seiner Worte möge man heute eingedenk sein. "Ich halte mich an zwei Prinzipien", schrieb Friedrich der Große 1761, "das eine ist die Ehre und das andere das Wohl des Staates, dessen Schicksal der Himmel in meine Hand gelegt hat."
Den 14. Oktober 1918.

Die so gestellte Aufgabe ist sehr verschieden von derjenigen, die kürzlich ein anderer Schriftsteller (Joh. Haller) zu lösen unternahm, indem er Bismarcks Friedensschlüsse behandelte. Da war von dem grossen deutschen Staatsmann die Rede und von drei dicht aufeinander folgenden Friedensschlüssen. Wir haben es dagegen mit dem Staat England zu tun und mit dem Wechsel der Ereignisse in allen Jahrhunderten der neueren Geschichte. Dort sollte ein grosses Vorbild für unser eigenes Handeln aufgestellt, den Deutschen gezeigt werden, "wie ein Sieger richtig Frieden schliessen soll". Hier wird zu warnen sein vor den gefährlichen Talenten, die unser Gegner bei seinen früheren Friedensschlüssen bewiesen hat. Videant consules! Ich kann mich auch nicht allein auf die Friedensschlüsse beschränken. Sie sind nur ein Teil der Politik, nur ein Ergebnis der Kriegführung. Ein Friedensschluss stellt in seinem Inhalt die logische Konsequenz des Kriegsverlaufs dar, d. h. wenn es seine Richtigkeit damit hat, wenn die Staats- [4] leitung es versteht, aus der durch den Krieg geschaffenen Lage das herauszuholen, die Lage so zu benutzen, wie sie ist. Das kann die Staatsleitung nicht immer. Man kennt Blüchers zorniges Wort nach der Schlacht bei Waterloo, dass die Federn der Diplomaten nicht wieder verderben möchten, was das Volk mit so grossen Anstrengungen errungen! Wo das wirklich der Fall ist, wird das Kriegsergebnis gewissermassen gefälscht. Der eine kämpfende Teil, derjenige, der die grössere Sachlichkeit und Festigkeit und die bessere Diplomatie besitzt, kommt besser davon, als derjenige, der weniger sachlich, weniger fest ist und der die schwächeren Diplomaten sein eigen nennt. Englands Friedensschlüsse behandeln, heisst also eine Antwort auf die Frage versuchen, wieviel die englische Staatsleitung – ich will jetzt nicht mehr von Diplomatie sprechen, denn diese ist doch nur ein untergeordneter Organismus – wieviel also die englische Staatsleitung aus ihren jeweiligen militärischen Erfolgen zu machen verstanden hat. Und wenn wir dann die einzelnen Friedensschlüsse in ihrer zeitlichen Folge haben Revue passieren lassen, so können wir weiter fragen, ob nun charakteristische Züge in der Art, wie England Frieden zu schliessen pflegt, zu erkennen seien, und wieweit etwa Lehren daraus zu ziehen wären für unseren eigenen Staat, der doch über kurz oder lang vor der Aufgabe stehen wird, mit diesem England in Friedensverhandlungen einzutreten.
 Von mittelalterlichen Kriegen will ich nicht reden und auch nicht von den Friedensschlüssen dieser Zeit. Die Verhältnisse, die Anschauungen sind von den unseren noch allzu verschieden. Der grösste von England im Mittelalter geführte, der sogenannte hundertjährige Krieg gegen Frankreich, endete auch ohne Friedensschluss. In langen, periodenweise geführten und unterbrochenen Kämpfen war ein grosser Teil von Frankreich erobert worden und wieder verloren gegangen. An der endgiltigen Vertreibung der Engländer vom [5] französischen Boden hat das erwachende nationale Empfinden der Franzosen, verkörpert in der Heldenfigur der Jungfrau von Orleans, entscheidenden Anteil gehabt. Freilich ward dieses Empfinden noch nicht in allen Provinzen des Reiches geteilt. In Guienne, zumal in Bordeaux, lebte die Anhänglichkeit an das Inselreich sogar noch fort, als die Engländer schon vertrieben waren, wobei auch wirtschaftliche Interessen, der Absatz der südfranzösischen Weine in England, mitwirkten. Wie dem auch sei, England hatte das Spiel verloren. Der Kampf erlosch 1453 mit der Einnahme von Bordeaux. Von all ihren Eroberungen waren nur noch Calais und die Kanalinseln in den Händen der Engländer geblieben. Immerhin erfolgte kein Friedensschluss. Die Engländer gaben – ein Bild englischer Zähigkeit – den Anspruch auf das Ganze nicht auf, und ihr Herrscher fuhr fort, sich zum Verdrusse der Franzosen noch Jahrhunderte lang König von Frankreich zu nennen. Im Beginn der neueren Geschichte war Englands Macht gering. Es war nicht in der Lage, entscheidend einzuwirken auf die Geschicke der Völker. In den grossen Machtkämpfen zwischen Karl V. und Franz I. vernimmt man beiläufig, dass England bald auf der einen, bald auf der anderen Seite gestanden, nicht aber dass es mit seinem Gewichte den Sieg der einen oder der andern Seite entschieden habe. Das Zünglein an der Wage ist es nicht gewesen. Zwar gibt es eine Anekdote, die eben dies symbolisch zum Ausdruck bringen will. Sie knüpft an die berühmte Zusammenkunft von 1520 an, welche Heinrich VIII. von England mit seinem königlichen Bruder von Frankreich bei Guines, unweit Calais, auf dem damals noch englischen Fleckchen Erde südlich des Kanals, gehabt hat. Sie behauptet, an dem reichgeschmückten Palaste, den der englische König bewohnte, oder auch an dem Prunkzelte, in dem die Begegnung der Herrscher stattfand, sei zwischen den Figuren zweier Kämpen diejenige eines Bogenschützen zu erblicken gewesen, mit der Unter- [6] schrift: Cui adhaereo praeest (wem ich mich anschliesse, der gewinnt). Das sei nämlich der Wahlspruch Englands und er besage nichts anderes als was von Alters her die englische Politik mit Vorliebe getan habe. Denn England habe es geliebt, in internationalen Streitigkeiten durch seine Parteinahme den Sieg auf die Seite zu lenken, wo es ihn um seines eigenen Vorteils willen zu sehen wünschte. In Wahrheit geht es aber mit diesem angeblichen Wahlspruch Englands und mit der ganzen Erzählung von dem Bogenschützen wie mit so manchem andern historisch gewordenen Sprüchlein: Sieht man genauer zu, so verflüchtigt sich die Überlieferung und hält vor der Kritik nicht stand. In diesem Falle glaube ich nun, dass die kleine Geschichte erst im 17. Jahrhundert, und zwar in Frankreich, entstanden ist, ein Treppenwitz der Weltgeschichte, und nicht einmal ein gut erfundener.1 Sie passt nämlich in das frühe 16. Jahrhundert nicht hinein; für das spätere aber, von dem wir gleich hören werden, besagt sie zu wenig, denn da wurde Englands Anteil an den Weltgeschicken schon viel grösser. Aber wie war es um die Mitte des Jahrhunderts? Da haben wir das Ereignis des Krieges, den Maria die Katholische im Bunde mit Philipp II. von Spanien gegen Frankreich führt. Spanien war siegreich, England aber verlor Calais, seinen letzten festländischen Besitz an die Franzosen. Spanien war stark, England aber militärisch und politisch gleich schwach. Als es zum Frieden kam, so sagt ein moderner englischer Historiker, da hoffte England auf die Brosamen vom Tische Philipps II. Doch es erhielt nichts. Maria hat den Frieden nicht erlebt, aber die Niederlage hatte sie tief empfunden. "Wenn ich gestorben bin", waren ihre Worte, "so werdet ihr den Namen Calais in meinem Herzen eingegraben finden". Elisabeth, die Nachfolgerin, konnte das Verlorene nicht zurückgewinnen. So hat denn der 1559 geschlossene Friede von Cateau-Cambrésis zwar die Macht Spaniens erhöht, England aber hatte den Verlust von Calais zu beklagen. [7] Doch bald kamen andere Zeiten. England tritt in die erste Reihe der Kämpfenden, als die grosse weltbewegende Frage der Reformation oder Gegenreformation die Geister und die Staaten scheidet. Wie Spanien unter Philipp II. der Vorkämpfer des Katholizismus, so wird England unter Elisabeth zum Verteidiger des gesamten, mit Vernichtung bedrohten Protestantismus. Aus dem in der Welt noch so wenig bedeutenden Staat der ersten Tudors ist ein von starker politischer Energie getragenes Gemeinwesen geworden, ein auf allen Gebieten der materiellen, der geistigen Kultur, der Machtentwicklung aufstrebendes Volk, noch klein an Zahl – 2 bis 2½ Millionen Menschen – aber aus seinen alten Kreisen hinausdrängend in die Welt, um nun, 100 Jahre nach Columbus und Vasco de Gama, auch seinen Anteil zu fordern bei der Teilung der Erde, von der es bis dahin durch Spanier und Portugiesen ausgeschlossen gewesen. Denn auch um die Durchbrechung dieser Monopolstellung, um die Fahrt nach Ost- und Westindien, wird zwischen England und Spanien gekämpft. Es geht um die Güter des Glaubens, es geht um Schiffahrt und Handel und um die Gründung von Kolonien. Den Höhepunkt des Kampfes bildet die Armadaschlacht von 1588. Mit einem Schlage ist für England alles erreicht. Die furchtbare Offensive der Gegenreformation ist abgeschlagen, der Protestantismus ist gerettet, die Bahn ist frei für das Hinausströmen des Engländertums in die Welt. Freilich hat der Kampf mit wiederholtem spanischen Angriff und englischen Gegenstössen an die iberische Küste noch fortgedauert, er hat sich verbreitert und über die Ozeane ausgedehnt, und da England den Freiheitskampf der Holländer unterstützte, so ward er auch zu einer Episode in dem grossen Schauspiel des Abfalls der Niederlande vom spanischen Joch. Über die Lebenszeit Philipps ebenso wie Elisabeths schleppte er sich fort in die Regierungen ihrer Nachfolger hinein. [8] So ist erst 1604, unter Jakob I, der Friede mit Spanien geschlossen worden. Was konnte er bringen? Über die religiöse Frage brauchte er schon nichts mehr zu enthalten: Die war durch den Krieg selbst entschieden. Die Erwürgung des gesamten Protestantismus war misslungen. England aber hat seinerseits an eine religiöse Offensive gegen die katholische Welt als solche nicht gedacht. Die Konfessionen mussten einander ertragen, der eine Staat konnte dem andern die seine nicht aufzwingen und strebte nur noch darnach, Herr im eigenen Hause zu bleiben, d. h. die religiöse Einheit innerhalb seiner Grenzen herzustellen und zu behaupten. So besagte der Friede von 1604 über die Frage der Religionen fast nichts. Und auch die andere Streitfrage, den Handel nach Ost- und Westindien betreffend, ward in der Friedensurkunde gar nicht erwähnt. Mit guter Absicht, denn nun hoffte jeder Teil seinen Zweck im Frieden besser als im Kriege erreichen zu können. Spanien war entschlossen, den Engländern diesen Handel zu verwehren, England war ebenso entschlossen, ihn zu erzwingen. Der Vorteil war aber auf der Seite Englands. Die englisch-ostindische Kompagnie und die nach dem Westen Segelnden rüsteten ihre Expeditionen aus, die Schiffe mit Waren gefüllt und mit Kanonen besetzt und die Mannschaften bereit zum Kampfe mit jeglichem Widersacher, Spaniern, Portugiesen, Holländern oder feindlichen Eingeborenen. Während Europa eine Annäherung der Höfe von London und Madrid erlebte, und gar eine enge dynastische Verbindung der Fürstenhäuser entstehen sah, schlugen im indischen Ozean und im Golf von Mexiko die beiderseitigen Geschwader aufeinander und errichtete England, aller Feindschaft zum Trotz, die Grundlagen seiner See- und Handelsgrösse. Der Weg dazu war ihm geebnet worden durch den Friedensschluss von 1604, nicht in dem, was er besagte, sondern in dem, was er verschwieg.
 [9] Nach der grossen Zeit Elisabeths ist unter den beiden ersten Stuarts ein merklicher Verfall der auswärtigen Macht Englands zu erkennen. Am deutlichsten zeigt sich dies in der Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Die grossen Mächte der Zeit sind: Österreich, Frankreich, Spanien, Holland, Schweden und noch die deutschen Protestanten. Nicht England. Es hat niemals entscheidend eingegriffen. Jakob I. lässt es zu, dass sein Schwiegersohn, der Pfälzer, sich in das böhmische Abenteuer stürzt, er lässt ihn auf englische Hilfe hoffen und lässt ihn dann im Stich. Später haben freilich auch englische Truppen in Deutschland gekämpft, England hat mit Spanien, mit Frankreich Krieg geführt, aber nirgends sieht man etwas von heroischen Anstrengungen. In der europäischen Geschichte haben diese Kriege denselben nebensächlichen Charakter, wie hundert Jahre früher die Teilnahme Heinrichs VIII. an dem gewaltigen Ringen zwischen Karl V. und Franz I. Karl I. von England ist bald ganz durch den Konflikt mit seinem eigenen Volke und dem Parlament in Anspruch genommen, und als er 1629 einmal den verwegenen Versuch unternimmt, ganz ohne Parlament auszukommen, da schliesst er rasch mit seinen Gegnern Frieden. Ein paar Friedensschlüsse, deren Betrachtung an dieser Stelle kaum lohnt. In der ferneren Geschichte des dreissigjährigen Krieges wird England kaum genannt, und als über die Karte Europas im westfälischen Frieden beschlossen wird, da hat England keine Stimme. Die englische Geschichte dieser Zeit hat nur von inneren Wirren zu erzählen, von der Revolution, vom Bürgerkriege, von der Hinrichtung des Königs. Ein hoher Schwung und eine mächtige Initiative ist erst wieder durch den Protektor Oliver Cromwell in Englands auswärtige Politik hineingetragen worden. Sein Name war weit im Auslande geachtet und gefürchtet, sein Einfluss machte sich in entfernten Winkeln Europas geltend. Der Schlüssel des Kontinents hängt an dem Gürtel Oliver Crom- [10] wells, sagt bewundernd ein Zeitgenosse. Etwas von seinem Geist ist an der Politik des Staates England haften geblieben. Er war der typischste Engländer aller Zeiten, sagt Rawson Gardiner. Ich halte diesen Ausdruck nicht für glücklich. Immerhin, wer ein Porträt Cromwells entwirft, wird manche Züge von allgemeiner englischer Gültigkeit zu zeichnen haben. Vieles von seinem Wesen ist seither dem Engländertum eingegraben, manches auch wohl in verzerrter Gestalt. Der hohe nationale Ehrgeiz der Engländer, der auf Erden keine Schranken anerkennt, ist ein Stück Cromwellschen Geistes. Das Typische an ihm – wenn man überhaupt den genialen Menschen als einen Typus gelten lassen darf – ist aber nicht seine Machtpolitik, sondern seine Frömmigkeit. Und was ist das für eine Frömmigkeit! Die göttlichen Offenbarungen sind ihm der Masstab aller Dinge. Seine Briefe sind Lobsprüche auf die Herrlichkeit Gottes, seine Reden lesen sich wie Predigten. "Wälze dich vor Gott, schreie auf zum Herrn", so ermahnt er seinen Sohn. In dem Schicksal seiner Schlachten erkennt er das unmittelbare Walten des Höchsten. "Nun möge Gott sich erheben und seine Feinde zerschmettern," ruft er bei Dunbar, als er fühlt, dass er den Siege in Händen hat. "Gott machte sie wie Stoppeln vor unseren Schwertern," so heisst es in seinen Berichten an die vorgesetzte Behörde. Hier wird mancher sagen, das sei nur façon de parler, puritanische Redeweise. Aber dann verkennt man die Kraft des Glaubens, die mächtige religiöse Grundstimmung. Nun führt ihn sein Schicksal auf den Gipfel der Macht, der Führer der parlamentarischen Armee wird zum Staatsoberhaupt, aus der Region des Bürgerkrieges wird er emporgehoben in die Sphäre der europäischen Machtkämpfe. Seine Religion, sein streitbarer Protestantismus wird eine Kraft in der Staatenwelt des Abendlandes. Cromwell hatte in seinen Mitstreitern im Bürgerkriege, in allen, die seinen politischen und religiösen Standpunkt teilten, das Volk Gottes erblickt und sie auch mit diesem Namen [11] genannt. Aber auch nur so hat er das biblische Wort vom auserwählten Volke für seine Zeit gebraucht. Er hat es noch nicht schlechthin, wie manche glauben, auf England im Gegensatz zu allen übrigen Völkern angewendet. Das taten nun aber die puritanischen Schriftsteller seiner Epoche. England, das einzige freie Volk der Erde, ist ihr Glaube, muss darum auch das von Gott erwählte sein. So meint es der Sänger des verlorenen Paradieses, wenn er sagt, dass Gott sich seinen Dienern enthüllt und, wie es seine Gewohnheit ist, "zuerst seinen Engländern."2 Diese Anschauung, die so wunderbar dem mächtigen Nationalstolz des Engländers entgegenkommt, ist seither oft und immer wieder verkündigt worden. Gewiss wird jede ihres Wertes bewusste Nation sich selbst einen hohen Rang, vielleicht den höchsten unter den Nationen zuzuschreiben geneigt sein. Frankreich ist längst "la grande nation" gewesen. Und dass Paris die Hauptstadt der Welt sei, haben ihm auch andere nachgesagt; selbst Goethe hat ihm den "herrlichen Namen" nicht vorenthalten. Und wir: haben wir nicht das edle Wort vom deutschen Wesen, an dem noch einmal die Welt genesen werde. Und kürzlich haben wir aus des Kaisers Munde den Ausspruch vernommen, er habe das Glück, an der Spitze des tüchtigsten Volkes der Erde zu stehen. Den Engländern aber ist es bitterer Ernst damit, dass sie das von Gott erwählte Volk seien in dem alten biblischen Sinne. Es wird für manche wie ein religiöses Dogma. Man wird bestärkt in der Frömmigkeit, sie mischt sich mit einem Gefühl der Dankbarkeit und man verkündigt sie gern vor aller Welt. Man hält seine Religion nicht still im Busen verschlossen, man ist nicht nur fromm, auch kirchlich. Und wie fühlt man sich nun vollends erhaben über die anderen Völker, die doch geringer sind, da sie jene Ausnahmestellung nicht besitzen. Und muss darum nicht England auch zur Herrschaft über die Welt berufen sein? Doch wir kehren zu Cromwell und seiner auswärtigen Politik zurück. Hier ist ein gewisser Zwiespalt zwischen den [12] Worten und den Taten nicht zu verkennen. Hörte man ihn reden, den Protektor, so kannte er kein höheres Ziel als die Verteidigung des Protestantismus, als die Aufgabe, "die evangelischen Potentaten, Fürsten und Republiken in guter, christlicher Einigkeit und Vertrauen beisammen zu halten". Mit dem Katholizismus gehe es zu Ende, so geben andere Cromwells Meinung wieder; darum sei jetzt die Zeit gekommen, "dem Papst zu Rom den Rest zu geben". So die Worte. Wie steht es aber mit den Taten? Der Protektor hat zwei auswärtige Kriege geführt. Das erste Mal ging es gegen Holland, d. h. gegen einen protestantischen Staat – offenbar ein Zuwiderhandeln gegen den eben mitgeteilten Grundsatz. Nun hat zwar nicht Cromwell, sondern schon vor ihm die republikanische Regierung diesen Krieg begonnen. Er hat ihn auch grundsätzlich missbilligt, aber ihn dennoch kraftvoll durchgeführt, bis der Zweck erreicht war. Englands Zweck in diesem Kriege war die Durchführung der Navigationsakte, jenes zu Gunsten der englischen Reederei erlassenen Gesetzes, das eine schwere Schädigung der holländischen Schiffahrt mit sich brachte. Der Friedensschluss von 1654, der den holländischen Krieg beendigte, erledigte die Hauptfrage in ähnlicher Weise wie es 1604 geschehen war. Die Navigationsakte wurde nicht erwähnt. Holland hatte sich stillschweigend gefügt, England seinen Zweck erreicht. Des Protektors zweiter Krieg ward gegen Spanien geführt. Diesen Krieg hatte er selbst beschlossen und ist mit vollem Herzen dabei gewesen. Er fühlt sich im Kampfe gegen das katholische Spanien als echter Nachfolger der Königin Elisabeth, er setzt in eindrucksvoller Rede dem Parlamente auseinander, dass es gegen den alten Feind, den natürlichen Feind Englands gehe, denn Feindschaft ist in ihn gesetzt durch Gott. "Ich will Feindschaft setzen zwischen deinen Samen und ihren Samen". Aber der Charakter des Kampfes ist dennoch nicht der eines Religionskrieges. Es ist vielmehr ein Stück praktischer, mit den Waffen durchgeführter Ex- [13] pansionspolitik, was Cromwell hier treibt. Die nützliche Verwendung der soeben auf eine bedeutende Höhe erhobenen Seemacht, die Jagd auf spanische Silberflotten, eine Expedition nach Westindien, die das spanische Kolonialreich in seinem Herzen treffen soll, aber nichts weiter als die Eroberung der damals noch für ziemlich wertlos gehaltenen Insel Jamaika erreicht, ferner ein englischer Seesieg in den westindischen Gewässern, ein im Bunde mit Frankreich geführter Feldzug in Flandern und die gemeinsame Eroberung von Dünkirchen, welches Ludwig XIV. den Engländern überlassen muss – das waren die Ereignisse und die dauernden Erfolge dieses Krieges. Jamaika und Dünkirchen blieben englischer Besitz. Blickt man auf die Kriege Cromwells zurück, so hat man die von ihm sonst so stark betonten religiösen Gesichtspunkte fast vergessen. Auch das eine mag noch erwähnt sein: während der Protektor mit dem katholischen Spanien Krieg führte, schloss er mit dem andern, nicht minder katholischen Staate der iberischen Halbinsel, einen folgenschweren Vertrag, jene Verbindung mit Portugal, welche dieses Königreich in eine seither schon Jahrhunderte währende Abhängigkeit von England gebracht hat. England nahm die portugiesischen Weine und gewann dafür den Absatz seiner Industrie in Portugal und den Zwischenhandel zwischen Portugal und seinen Kolonien. Von konfessioneller Befangenheit auf der Seite Cromwells kann bei diesem Staatsakte wahrhaftig niemand reden. Mit anderen Worten: Der Mensch Oliver Cromwell und auch der Protektor in seinem inneren Walten ist der fromme Puritaner. Der Staatslenker aber, der Kriege führt, Frieden und Verträge schliesst, ist klug bedacht auf den Vorteil seiner Untertanen. Handelsgrösse, Machterweiterung, kolonialer Besitz – das sind die Ziele, wir nehmen das Kommende voraus und sagen schon: die echt englischen Ziele, die Cromwell verfolgt. [14] Das wiederhergestellte Königtum der Stuarts hat zwar die innere Politik der republikanischen Zeit rasch genug abgetan und das Alte wiederbelebt. In seiner auswärtigen Politik aber wandelt es fort auf den Bahnen der vorangegangenen Epoche, wenn auch mit weniger Kraft und meist mit weniger Erfolg. Die beiden Kriege mit Holland, die Karl II. geführt hat, erscheinen nur wie die Vollendung des durch Cromwell Begonnenen. Der erste kommt 1667 zum Abschluss, nachdem England soeben eine tiefe Demütigung erfahren hat, da Admiral Ruyter mit der holländischen Flotte in der Themse erschienen ist, englische Kriegsschiffe daselbst verbrannt und die Hauptstadt hat zittern machen. "Zum ersten und zum letzten Mal," behauptet Macaulay kühn, "bekamen die Bürger von London den Donner feindlicher Kanonen zu hören". Bald darauf, im Juli 1667, wurde der Friede von Breda geschlossen. Es war freilich nicht ein starker Friede nach Cromwellscher Art, doch gab er England viel. Es durfte das holländische Gebiet in Nordamerika, das es (schon vor jeglicher Kriegserklärung) besetzt hatte, behalten. Neu Amsterdam ward unter dem Namen Neu York eine englische Stadt. Der dritte holländische Krieg (der zweite dieser Regierung) ward 1672–74 im Bunde mit Frankreich geführt. Noch einmal hat die holländische Kriegführung grosse Momente gehabt. Durch eine glückliche Seeschlacht an der Küste von Suffolk hat sie die Teilnahme Englands an den militärischen Operationen auf dem Festlande verhindert. Dieses Mal hat das dem Kriege abgeneigte englische Parlament den König zum Friedensschlusse gezwungen, nämlich zum Separatfrieden mit Holland, der England günstigere Bedingungen eintrug, als es sie an der Seite Frankreichs zu erwarten hatte. Frankreich kämpfte weiter. Es ist wohl der erste eklatante Fall der Preisgabe des Bundesgenossen von Seiten Englands. Als der englische Gesandte dem französischen Könige seine Entschuldigungen vorbrachte, erwiderte Ludwig XIV. gross- [15] mütig und mit der ihm eigenen Grazie: "Ich beklage nur Sie, anstatt mich über Sie zu beklagen". Fassen wir das gesamte Ergebnis der drei englisch-holländischen Kriege und der drei Friedensschlüsse ins Auge, so hatte England alle seine Ziele erreicht, die freie Förderung von Schiffahrt und Handel gegenüber der niederländischen Konkurrenz, die maritime Überlegenheit, die Verbesserung seiner Stellung in Amerika und, wie wir noch hinzufügen, auch in Indien. Nicht durch einen überwältigenden Sieg, der den Feind auf die Knie zwang, ist dies erreicht worden, sondern durch die Ausdauer, durch die Wiederholung des Kampfes, durch die Erschöpfung des mit seinen geringen Kräften auf seiner schmalen Basis ermattenden Gegners. Fortan ist die holländische Konkurrenz kein Hindernis mehr für den inneren Aufstieg Englands. Im Gegenteil: bald folgt nun Holland den Bahnen der grösseren Seemacht. Gemeinsam schreiten sie unter der Firma der Seemächte im ausgehenden 17. und im 18. Jahrhundert in der europäischen Politik einher, aber die Kenner wissen bald, wie das Verhältnis einzuschätzen sei. Es handelt sich um das führende England und das ihm willig folgende Holland. Ich möchte, um dieses Verhältnis zu umschreiben, einmal das in anderer Zeit und von anderen Staaten gebrauchte Bismarckische Wort so variieren: Holland suchte Schutz vor allen Stürmen, indem es sein wurmstichiges altes Orlogschiff an die schmucke und seefeste Fregatte von England koppelte. Blickt man auf die einzelnen Friedensschlüsse, so sehen sie noch ziemlich unschuldig aus. In ihrer Gesamtwirkung waren sie tötlich für die holländische Grossmachtstellung. England hatte der Welt eines der Beispiele seiner berühmten Zähigkeit geliefert.
 Auf der neugewonnenen Höhe der Macht vermag England nun auch einen neuen, stärkeren Gegner zu bestehen. Es folgt eine lange Reihe von Kriegen und Friedensschlüssen, die wir in diesem Zusammenhange als ein Ganzes zu betrach- [16] ten haben. Sie sind einheitlich in bezug auf die Gegnerschaft, die Ziele, den Charakter des Kampfes. Die Dauer desselben währt insgesamt 5/4 Jahrhunderte, genauer von 1688 bis 1815. Frankreich ist der neue Gegner, Handel und Schiffahrt, Seemacht und koloniale Ausdehnung sind die Ziele, jetzt wie früher. Aber ein neuer Zweck kommt hinzu: die Erhaltung des europäischen Gleichgewichts, ein Ausspielen der Kräfte gegen einander. Die starke Macht Frankreich, welche draussen in der Welt bekämpft wird, soll auch auf dem Festlande nicht das Übergewicht erhalten, gegen sie wendet sich England immer von neuem, von Ludwig XIV. bis auf Napoleon. England selbst, das noch menschenarme Land – es hat 1688 kaum 5½ Millionen, 1815 etwas über 10 Millionen Einwohner – kann freilich mit seinen Söldnertruppen den Heeren Frankreichs nicht grosse Armeen entgegenwerfen. Es fürchtet sich auch vor dem Anblick eigener grosser Armeen; denn sie könnten der Freiheit gefährlich werden. Darum operiert es gern mit fremden Armeen, mit gekauften oder gemieteten Soldaten, mit den Kräften grosser und mittlerer und kleiner Staaten, die bei ihren eigenen Interessen gepackt werden und gewiss auch ihren Vorteil dabei finden. Sie treten einzeln oder in Gruppen auf, und England schliesst immer wieder mit ihnen Bündnisse "pour contrebalancer la France". Und während also die Welt des Festlandes sich auslebt und vorwärts schreitet in Kämpfen und Gegensätzen, steht für England das Aussereuropäische meist im Vordergrunde. Es hält auf seine Seeherrschaft, es erweitert, es entwickelt seinen Kolonialbesitz, es beseitigt immer neue Hindernisse, es kämpft nach allen Seiten, gegen die Indianer von Nord-Amerika, gegen die eingeborenen Fürsten Indiens, gegen die Negerstämme in Afrika, vor allem immer wieder gegen den grossen europäischen Rivalen, gegen Frankreich. Ein 100jähriger Krieg, wie im Mittelalter, ist auch dieser, natürlich auch ebenso wie jener durch lange Friedensepochen und durch wechselnde politische Konstellationen, von denen wir noch mehr hören wer- [17] den, unterbrochen, aber doch einheitlich im Charakter und in den Zielen. Daran ändert es nichts, dass man nach den im Vordergrunde stehenden europäischen Fragen die einzelnen Kämpfe unter verschiedenen Namen zu benennen pflegt, als den Pfälzischen Krieg, den Spanischen Erbfolgekrieg, den österreichischen Erbfolgekrieg, den siebenjährigen Krieg, den Amerikanischen Freiheitskrieg, die Revolutionskriege und die Napoleonischen Kriege. Für England haben alle diese Ereignisse nur ein Antlitz. Es hat mit grossartiger Konsequenz seine Sache stets im Auge behalten und sie siegreich durchgeführt. Das letzte Ergebnis von 1815 ist derartig, dass ein neuerer Historiker (Ad. Wahl) seine Schilderung der Kämpfe von 1792 bis 1815 in die Worte ausklingen lassen kann, "dass aus dem gewaltigen Ringen, das in diesem Buche geschildert wurde, England als der vornehmste Sieger hervorgegangen ist." Doch nun zu den Friedensschlüssen. Sie spiegeln in dem, was sie bezwecken und oft, doch selten völlig, erreichen, den Geist der eben geschilderten Politik wieder. Auf dem Festlande arbeitet man für das berühmte europäische Gleichgewicht, ausserhalb Europas für den systematischen Ausbau der englischen Handels- und Kolonialmacht von Etappe zu Etappe. Auf den Inhalt kommt es uns nun aber weniger an als auf die Form – Wie schliesst England Frieden? Der erste Fall, von dem wir zu berichten haben, ist der Friede zu Rijswijk, 1697. England, dessen König Wilhelm III. zugleich Generalstatthalter der Niederlande war, hat den Krieg gemeinsam mit einer Gruppe von Verbündeten gegen Ludwig IV. geführt. Als der auf dem Schlosse zu Rijswijk tagende allgemeine Kongress das Friedensgeschäft nur langsam von der Stelle bringt, entschliesst sich der engliche König – es war sein persönlicher Gedanke – ein neues Verfahren einzuschlagen. Ausserhalb des Kongresses, bei dem kleinen Dorfe Hall, treffen zwei Vertrauensmänner der Könige von England und Frankreich zusammen, um Klarheit über die Lage zu schaffen. Der Kongress wird zur Nebensache, die [18] Haller Konferenzen werden mehrfach wiederholt, hinter den Hecken eines Obstgartens plaudernd, einigen sich die zwei Männer über alle entscheidenden Punkte und eines Tages ist man so weit, dass die Unterzeichnung erfolgen kann. Inzwischen sind die Verbündeten erst auf ihr dringendes Verlangen von dem Inhalt der Konferenzen in Kenntnis gesetzt worden. Sie sehen sich, da England und Holland mit Frankreich einig sind, nach ärgerlichen Auseinandersetzungen gezwungen, sich dem Friedenswerke anzuschliessen. Natürlich erhalten sie weniger günstige Bedingungen, als sie ihnen normaler Weise zu Teil geworden wären. Erst damals ist das zuvor im Frieden geraubte Strassburg dem deutschen Reiche auf Jahrhunderte verloren gegangen. Den Zeitgenossen aber galt England, das beim Friedensschlusse das Schicksal Europas in seiner Hand gehalten, als die Macht, die dem Siegeslauf Ludwigs XIV. Einhalt gebot. "Der König von Frankreich," sagte man, "hat den Lorbeerkranz, der sich nun zwanzig Jahre lang um sein Haupt geschlungen, abgenommen, um ihn König Wilhelm zu überreichen."3 Die eben geschilderte Praxis: man lässt die Bundesgenossen links liegen und sichert sich in besonderer Verhandlung mit dem Hauptgegner die wertvollsten Kriegsziele, die Bundesgenossen können dann beitreten, wenn es ihnen beliebt, erhalten aber die schlechteren Bedingungen – diese Praxis ist von England noch krasser 1713, nach dem spanischen Erbfolgekriege, geübt worden. Diese oft und gründlich untersuchten Vorgänge brauchen hier nur kurz charakterisiert zu werden. Abermals (in Utrecht) ein Friedenskongress, auf dem alle Kriegführenden vertreten sind. Abermals finden sich England und Frankreich ausserhalb der Diplomatenversammlung; und abermals werden die vertraulichen Besprechungen entscheidend. England hat sich alles ihm notwendig Erscheinende gesichert: in Europa das Gleichgewicht, jenseits wie diesseits des Ozeans die Erhaltung und Vermehrung der englischen Handelsgrösse. Der Hauptverbündete Karl VI. [19] hat das Nachsehen. Er will die ganze spanische Erbschaft, soll sich aber mit den europäischen Nebenlanden begnügen. Dieses Mal fügt er sich freilich nicht, er setzt allein den Krieg noch fort, er gewinnt wirklich noch ein Weniges hinzu, um sich in der Hauptsache doch endlich mit dem begnügen zu müssen, was ihm schon in Utrecht geboten worden. An den eben behandelten Utrechter Frieden knüpft sich aber für England noch eine andere Erinnerung. Seit einigen Jahrzehnten war die innere Politik durch den Gegensatz der beiden grossen Parteien der Tories und der Whigs bestimmt worden, die einander in fortwährendem Kampfe den Besitz der Macht streitig machten. Nun wurden zum ersten Mal auch die Fragen des Krieges und der auswärtigen Politik in diesen Kampf hineingezogen. Die Whigs erheben ihre Stimme für die Fortsetzung des Krieges, die Tories sind die Friedenspartei. Die Whigs fordern die weitere Demütigung Frankreichs, die Tories finden, dass man darin nun weit genug gegangen sei, dass die Fortsetzung des Kampfes nur dem Verbündeten Karl VI., d. h. der Macht Österreichs, zu gute kommen würde. Die Tories gewinnen über ihre Gegner den Sieg. Königin Anna, im Herzen stets auf ihrer Seite, entlässt ihre whiggistischen Minister, das Parlament wird aufgelöst und die Neuwahlen geben den Tories eine überwältigende Mehrheit im Unterhause. Nun sind sie die Herren der Lage, der begabteste aus ihren Reihen, Lord Bolingbroke, wird der Schöpfer des Friedens von Utrecht. Er ist es auch, dessen Name (St. John Bullinbroke, wie die Zeitgenossen ihn nannten) in der volkstümlichen Figur des handfesten John Bull zum Symbol aller echt nationalen englischen Politik geworden ist.4 Die Bedeutung des parlamentarischen Systems für die auswärtige Politik war aller Welt mit einem Male erschreckend klar geworden. Die fremden Staaten hatten die Mahnung erhalten, mit einem Bundesgenossen vorsichtig zu sein, dessen Treue auf dem schwankenden Grunde parlamentarischer Majoritäten beruhte. [20] Ohne Mühe lässt sich der auf den Utrechter Frieden folgende Zeitraum von drei Jahrzehnten als eine besondere Epoche aus der europäischen Politik des 18. Jahrhunderts herausschälen. Dem Interesse des grossen Publikums bietet diese Epoche nicht viel. Der normale Geschichtsleser pflegt, wenn er den spanischen Erbfolgekrieg erledigt hat, sich möglichst rasch den Taten Friedrichs des Grossen zuzuwenden. Uns aber bietet gerade der dazwischen liegende Zeitraum so viel des interessanten Stoffes, dass wir auch bei ihm etwas länger zu verweilen gedenken. Auch durch die Utrechter Verträge war der allgemeine Friede Europas noch nicht hergestellt. Kaiser Karl VI. hatte mit Frankreich, nicht aber mit Philipp V von Spanien seinen Frieden geschlossen. Und wie hätte das auch geschehen können, da er selbst auf die Krone des iberischen Reiches nicht verzichtete und fortfuhr, sich König von Spanien zu nennen? Der neue Angriff freilich erfolgte von der andern Seite. Durch spanische Expeditionen wurde zuerst die Insel Sardinien, dann Sizilien erobert. Der im spanischen Erbfolgekriege geführte Kampf loderte von neuem auf. Die europäischen Kabinette geraten in zornige Erregung über den Störenfried Spanien. England und Frankreich vergessen ihre dreissigjährige Feindschaft, sie schliessen untereinander und mit Österreich einen Vertrag, um Spanien zu züchtigen und unter ihr Gebot zu zwingen. Nach dem vorher Gesagten begreifen wir auch, wenn England es selbstverständlich fand, dass auch Holland von der Partie sein müsse. Das entsprach nicht nur der starken Abhängigkeit der holländischen Politik von der englischen. Es schien auch aus dem Grunde notwendig, und wurde mit aller Offenheit gefordert, damit nicht während des zu erwartenden Krieges die Holländer den wertvollen Handel mit Spanien ganz allein in die Hand bekämen. Der Bund der drei Mächte gab sich also und gibt sich auch in der Geschichtschreibung als die Quadrupel-Allianz, obwohl die vierte ihren Beitritt niemals vollzog, denn dieses Mal hat [21] das widerstrebende Holland den Engländern wirklich die Gefolgschaft versagt. Der Krieg der Mächte gegen Spanien aber entbrennt nun wirklich. Er ward von den Truppen Karls VI. auf Sizilien, von den Franzosen in Spanien, von den Engländern zur See geführt. Sie haben, noch ehe der Krieg erklärt war, der spanischen Flotte am Kap Passaro, in den Gewässern Siziliens eine vernichtende Niederlage beigebracht. Und auch die weitere Beteiligung der Engländer am Kampfe zeigt deutlich, dass sie in dem ganzen Streitfall eine gute Gelegenheit erblickten, die durch den tatkräftigen Minister Alberoni soeben neu begründete Seemacht Spaniens zu zerstören. Ein englischer Diplomat, welcher der in Spanien operierenden französischen Armee attachiert war, sorgte dafür, dass neben der militärischen Unterwerfung Spaniens, die Frankreich zu besorgen hatte, auch dasjenige, was England mehr am Herzen lag, nicht vergessen wurde. In die Hafenplätze der spanischen Nordküste, wo Vorbereitungen zum Neubau der Flotte getroffen waren, drangen die feindlichen Truppen ein und zerstörten an Schiffen und Schiffbaumaterialien alles, was sie fanden. "An der ganzen Küste bis nach Cadiz haben die Spanier kein einziges Fahrzeug mehr im Bau", schreibt der Engländer triumphierend, "und ich hoffe, die Verbrennung so vieler Schiffe in ihren Häfen wird ihnen die Lust benehmen, in Zukunft wieder so etwas zu versuchen, jedenfalls nicht mehr während dieses Krieges". Und ähnlich klingt ein anderes Mal das aus London herüberdringende Echo: "Bitte, teilen Sie uns doch alle Einzelheiten dieser Verluste der spanischen Marine mit, denn solche Nachrichten werden hier mit grosser Freude begrüsst".5 Doch wir sollen von dem Friedensschlusse reden, was dieses Mal nicht leicht ist. Zwar wurde der Zweck des Krieges erreicht: Alberoni ward gestürzt, Spanien unterwarf sich der Quadrupel-Allianz. Aber nun erst, als die grosse Abrechnung erfolgen sollte, begannen die Schwierigkeiten. Ein europäischer Kongress, in die alte Bischofstadt Cambrai berufen, [22] mühte sich vergeblich um die Herstellung des allgemeinen Friedens. Er löste sich auf, als zu allgemeiner Überraschung Spanien und Österreich, die beiden Hauptgegner, sich ausserhalb der Diplomatenversammlung gefunden und im Wiener Vertrage von 1725 Frieden und Bündnis geschlossen hatten. Sofort entstand die Aussicht auf einen neuen Krieg. Denn als Gegengewicht gegen die drohende Haltung des Wiener Verbündeten schlossen sich die Westmächte zum Bündnisse von Hannover von neuem zusammen. Jede Gruppe sucht neue Teilnehmer heranzuziehen. Europa ist in zwei feindliche Lager geteilt. Zögernd trifft man die Vorbereitungen zum Kampfe. Schon ist er hier und dort entbrannt, z. B. in der Form einer Belagerung Gibraltars durch die Spanier, als man es noch einmal mit einem Kongresse versucht, der 1728 in Soissons zusammentritt. Aber siehe da, er führt zu derselben Enttäuschung, wie die Versammlung von Cambrai. Denn nun gelingt es der englischen Diplomatie, die Wiener Verbündeten zu trennen. Spanien schliesst im November 1729 den Vertrag von Sevilla, der seinen italienischen Plänen besser Vorschub leistet, als alles, was ihm Österreich geboten hatte, während die spanischerseits zuvor gestellte Forderung der Rückgabe Gibraltars durch die einfache Nichterwähnung aus der Welt geschafft wird. Es sind damals freilich Stimmen in England laut geworden, welche erklärten, so sei der Besitz Gibraltars nicht genügend gesichert, er hätte im Vertrage genannt sein müssen. Dennoch hatte die Regierung diese Form genügend und angemessen gefunden. Und jenen Kritikern liess sie erwidern: "Wollt ihr etwa behaupten, Gibraltar sei nicht in unserem Besitze? Jeder in unserem Besitze befindliche Platz aber wird ja durch diesen Vertrag garantiert."6 Die Nichterwähnung Gibraltars war in der Tat vom englischen Standpunkt aus ebenso würdig und ausreichend, wie wir es als genügend und angemessen erachten würden, wenn in der Urkunde des [23] künftigen Friedens mit Frankreich der Name Elsass-Lothringen nicht genannt wird. Aber nicht nur diese Genugtuung hatte England. Der Vertrag von Sevilla gab ihm auch die Sicherstellung seines alten gewinnbringenden und bis dahin so oft gestörten Handelsverkehrs mit Spanien und seinen überseeischen Besitzungen. Frankreich und bald auch Holland schlossen sich dem Vertrage an. Der Kaiser war isoliert und von allen Seiten bedroht. Zwischen ihm und den Seemächten – England voran – war damals ein ernster Streitpunkt entstanden, dessen Schlichtung auf friedlichem Wege nicht leicht erschien. In Ostende, auf dem Boden der österreichischen Niederlande, hatte sich seit einiger Zeit unter dem Schutze des Kaisers, und mit von ihm verbrieften Rechten eine Handelsgesellschaft aufgetan, die einen hoffnungsvollen Anlauf genommen haue, um einen eigenen Handelsverkehr mit Ostindien zu unterhalten. Ein Unternehmen, das auch dem deutschen Hinterlande die Möglichkeit zu bieten schien, in den Weltverkehr einzudringen, Gewinn und Vorteil davonzutragen. Aber freilich konnte das nur geschehen in scharfer Konkurrenz mit den alten ostindischen Kompagnien in England, Holland und Frankreich. Zuerst hatten die Holländer sich beschwert, sodann war es die englische ostindische Kompagnie, die laute Klage erhob über die Verletzung ihres Monopols und die ein Einschreiten ihrer Regierung forderte. Hatte sich die Kompagnie von jeher gegen die Versuche anderer zu wehren gehabt, ihr Monopol zu durchbrechen, und hatte sie zuletzt der Konkurrenz einer andern Gesellschaft nur dadurch Herr zu werden vermocht, dass sie sich eine Verschmelzung mit jener gefallen liess, so war nun auf fremdem Boden eine Gründung entstanden, welche gefährlicher werden konnte als alle früheren Angriffe auf ihr Monopol. Die Westmächte leugneten kühn das Recht des Kaisers, einer solchen Gründung in seinen Niederlanden seinen Schutz zu gewähren. Karl VI. liess sich von der durch Ehre und Vorteil ihm gebotenen Hal- [24] tung nicht abbringen. So lag hier ein Konflikt vor, der wohl einen Kriegsgrund abgeben konnte. So lange Spanien an seiner Seite stand, hatte dieses sich ebenso redlich für das Recht der Kompagnie von Ostende eingesetzt, wie Karl VI. für die spanische Forderung Gibraltars. Nun aber war Spanien nicht nur auf die andere Seite übergetreten, sondern hatte im Vertrage von Sevilla geradezu die Verpflichtung übernommen, an der Seite seiner neuen Bundesgenossen einzutreten für die Unterdrückung der Kompagnie von Ostende. Was blieb Karl VI. übrig, als sich den Forderungen der mächtigen neuen Quadrupel-Allianz zu unterwerfen? Er begann zu rüsten, aber den Kampf konnte er nicht wagen. Vielmehr ward endlich im Wiener Frieden vom 1731 die Summe aller streitigen Punkte endgültig geschlichtet. Karl VI. war zufrieden, neue Garantien für sein teures Hausgesetz, die pragmatische Sanktion, d. h. für die Unteilbarkeit seiner Reiche und für die Thronfolge seiner vielgeliebten Tochter Maria Theresia, erhalten zu haben. Die Kompagnie von Ostende und die damit verknüpften Hoffnungen auf den allmählichen Eintritt Deutschlands – oder sollen wir gar sagen: Mitteleuropas? – in den bis dahin noch im Westen beschlossenen Kreis der grossen, am Welthandel beteiligten Nationen gab der Kaiser gelassen preis. Halten wir einen Augenblick inne, um uns noch einmal Rechenschaft darüber zu geben, was die englische Staatskunst in der Periode von 1713–1731, d. h. vom Utrechter bis zum Wiener Frieden, geleistet und gewonnen hatte, so ist darin ein grosser einheitlicher Zug, der zuletzt auch zum einheitlichen Erfolge führt, nicht zu verkennen. England steht hier als Handelnder zwar nicht allein, denn es hat Frankreich und gewöhnlich auch Holland hinter sich. Aber was wir erblicken, ist wesentlich englischer Geist, englische Politik und englischer Erfolg. Dabei sind die englischen Staatsmänner nicht immer die Herren der Situation gewesen, haben nicht immer in der politischen und noch viel weniger in der [25] militärischen Führung des Streites die Initiative besessen, aber sie haben sich über die schwierigen Lagen hinwegzuhelfen vermocht, und zuletzt wurden alle Fragen in ihrem Sinne entschieden. So gefährlich die Lage 1727 erschien, so geschickt waren die Lösungen 1729 und 1731. Indem Spanien aus der Verbindung mit dem Hause Österreich herausgelockt wird, ist Gibraltar und das englische Handelsinteresse gesichert, Spanien selbst aber, dessen Seemacht nicht mehr gefährlich werden kann, wird, wie wir noch ergänzend hinzufügen, durch die Festsetzung seiner Dynastie in Italien abgelenkt und befriedigt. Damit wird zugleich ein heilsames Gegengewicht gegen die hegemonische Stellung des Habsburgerstaates auf der Appeninnen-Halbinsel geschaffen. Nun muss auch Karl VI. weichen und die Kompagnie von Ostende wird geopfert. Das alles, Gibraltar und das Handelsinteresse, das ostindische Monopol und das europäische Gleichgewicht, waren die Früchte dieser Friedensschlüsse, das Ergebnis einer nur durch wenig Kriegslärm unterbrochenen politischen Arbeit. Und die beiden Vettern Charles und William Stanhope, der Schöpfer der Quadrupel-Allianz und der Unterzeichner des Vertrages von Sevilla, wurden die gefeiertsten Diplomaten ihrer Zeit. Die geschilderten Ereignisse aus der Zeit von 1713 bis 1731, d. h. vom Utrechter bis zum Wiener Frieden, und darüber hinaus bilden also auch insofern eine eigene Episode in der auswärtigen Politik des Inselreiches, als sie eine lange dauernde Aussöhnung, ja eine feste Allianz zwischen England und Frankreich darstellen. Wir denken natürlich sofort an die Analogie der entente cordiale unserer Tage und wir haben ein Recht zu diesem Vergleich. Heute ist Frankreich die Macht, die über dem Revanchegedanken alles andere vergass und die gegenüber England, seitdem zum letzten Mal vor 20 Jahren die Wege beider sich kreuzten, nachgab, um an ihm einen Halt zu finden für den Tag der Rache. Der sonst in allen Erdteilen fühlbare Gegensatz gegen die [26] erste Kolonialmacht wird zurückgedrängt, die politische Führung aber fällt dem Genossen jenseits des Kanals in die Hand. So ist es auch im 18. Jahrhundert gewesen: ein von früherer Höhe herabgestossenes, ein militärisch gedemütigtes Frankreich, das die Anlehnung an England sucht. Bei dem Herzog von Orleans kommt die Unsicherheit seiner Stellung als Regent hinzu, er fürchtet, von dem spanischen Bourbonen, der ein Enkel des Sonnenkönigs ist, aus seiner Herrscherstellung verdrängt zu werden. Und erst unter Fleury hat Frankreich allmählich wieder seine historische Position eingenommen und lenkt wieder ein in die Wege Ludwigs XIV. Für jene englisch-französische Episode aber bedeutet der Wiener Friede von 1731 den Höhepunkt, einen Abschluss, den England gemacht und bei dem sich plötzlich alles zum Vorteil Englands gewendet hat. Frankreich, Holland, Spanien sind seine Dienenden und sind nicht ohne Eifersucht;7 der Kaiser hat der Not gehorcht. So wird auch die stolze Genugtuung verständlich, welche Regierung und Volk in England empfanden. Der ältere Horace Walpole, der Bruder des Premierministers schrieb damals: "Kein Fürst stand jemals höher an Ruhm und Ehren vor allen Mächten des Auslandes durch die Festigkeit und Weisheit seines Tuns als Seine Majestät in jenen Tagen".8 Und in einer Flugschrift, die den vielsagenden Titel führt: "Die natürliche Wahrscheinlichkeit eines dauernden Friedens in Europa", wird nach einem rückblickenden Vergleich mit den Rijswijker und Utrechter Verträgen und nach einer Umschau über die Mächte des Weltteils, wie sie nun dastehen, die frohe Mär verkündet, dass zu keiner Zeit die Aussicht auf einen bleibenden Frieden sicherer gewesen sei als jetzt. "Wenn Menschenglück dauern kann, so sprechen mehr als je alle Umstände dafür, dass diese Seligkeit uns erhalten bleiben wird." Ein dem historisch Denkenden naiv klingendes Urteil, das aber für jene Zeit seine Berechtigung darin hatte, dass man soeben die letzten noch fortglimmenden Funken zum Erlöschen gebracht hatte und nun [27] das Aufflammen eines neuen Brandes wenigstens so lange für unwahrscheinlich halten durfte, wie die englisch-französische Freundschaft unversehrt blieb. Die Hauptsache für die Erhaltung des Friedens war und blieb übrigens die grundsätzliche Friedfertigkeit des leitenden Ministers Robert Walpole. Man kann unter den staatsmännischen Grossen der neueren englischen Geschichte zwei Typen unterscheiden, einen kriegerischen und einen friedlichen Typus. Walpole gehört der letzteren Gattung an. Er ist der berühmte Finanzkünstler, der Mann der Zahlen, der grosse Praktiker der parlamentarischen Debatte, der emsige Arbeiter an der inneren Ausgestaltung des wirtschaftlichen Lebens in allen seinen Zweigen, besonders in Industrie und Handel, in Schiffahrt und Kolonialpolitik. Der Reichtum der Nation steigt und die Hilfsquellen des Staates mit ihm. Darin liegt die historische Grösse dieses Ministers und sein Stolz. Quieta non movere ist sein Wahlspruch, er hütet den Frieden wie seinen Augapfel, wohl weniger aus Abscheu vor dem Kriege, denn jede Verweichlichung des Gemüts lag seiner Art fern, als weil der Krieg seine Kreise stört, weil er den Handel unterbricht, weil er die Finanzen erschüttert, die Staatsschuld, die grosse Sorge der Politiker des 18. Jahrhunderts, anschwellen lässt, anstatt sie zu vermindern. Die auswärtige Politik interessiert ihn garnicht, er überlässt sie den anderen Ministern, aber sie müssen sie in seinem Sinne führen. Englands Ansehen in der Welt, sein Einfluss im Norden und Süden Europas, das europäische Gleichgewicht, das alles weiss er wohl zu schätzen, aber der Friede darf nicht dadurch gefährdet sein. Da müssen die Leiter des Auswärtigen, die Staatssekretäre ihm folgen. Gibraltar und die Kompagnie von Ostende sind auch ihm wichtige Fragen, aber er verwirft gleichwohl die schneidige Staatskunst seines Schwagers Townshend, er macht ihm heftige Szenen, als dieser um jener Dinge willen auf einen Krieg loszusteuern scheint. Er weiss das Unheil noch zu verhüten und lässt von da an auch die [28] auswärtige Politik nicht mehr aus den Augen. Und dass Englands Absichten mit Gibraltar und Ostende auch ohne Krieg, nur durch einen starken Staatswillen und eine geschickte Diplomatie erreicht wurden, haben wir soeben gehört. So blieb es auch ferner noch. Die dreissiger Jahre des 18. Jahrhunderts brachten Europa den polnischen Thronfolgekrieg. Die Waffen Frankreichs und Österreichs schlugen wieder einmal in Italien und am Oberrhein aufeinander. Walpole aber verstand es, sein England aus dem Spiele zu halten. Und es war der Zusammenbruch seiner Politik, als er 1739 den Ausbruch eines Krieges mit Spanien, "den Krieg um Jenkins' Ohr", nicht hindern konnte und als – nach seinem Rücktritt – England in den europäischen Konflikt um die Erbfolge Maria Theresias hineingerissen wurde.
 Nun erst war der alte, 30 Jahre lang ruhende, englisch-französische Gegensatz wieder lebendig geworden. Von neuem kehren sich die Waffen Englands und seiner Verbündeten in Europa gegen das Haus Bourbon, bekämpfen einander englische und französische Kolonisten jenseits des atlantischen Ozeans und stossen die Flotten Englands und Frankreichs auf den Meeren zusammen. Der Krieg währt ohne volle Entscheidung bis zum Jahre 1748. Als die Verhandlungen begannen, war Frankreich in der angenehmen Lage, zwischen Bedingungen wählen zu können, die ihm von der Seite Österreichs und solchen, die ihm von England geboten wurden. England hatte mehr zu bieten und einigte sich mit Frankreich über Friedenspräliminarien, denen Maria Theresia enttäuscht und verbittert sich anschliessen muss. England und Frankreich geben ihre gegenseitigen Eroberungen heraus. Maria Theresia aber erhält zwar die allseitige Garantie der Pragmatischen Sanktion, muss aber dem Könige von Sardinien einen Streifen Landes von ihrem lombardischen Besitz, den spanischen Bourbonen das Herzogtum Parma überlassen, und, was sie am tiefsten schmerzt: Schle- [29] sien verbleibt noch einmal dem verhassten Preussenkönige. Als sie den englischen Gesandten wieder empfing – es war noch vor dem Abschluss des definitiven Friedens – da überschüttete ihn die leidenschaftliche Fürstin mit einer Flut von Vorwürfen. Hören wir nur, wie er selbst darüber berichtet: "Wenn Sie sofort Frieden haben wollen, schliessen Sie ihn – ich kann beitreten – kann für mich selbst unterhandeln – warum soll ich mich immer von den Verhandlungen über meine eigenen Angelegenheiten ausschliessen lassen – meine Feinde werden mir günstigere Bedingungen gewähren als meine Freunde – aber Ihr König von Sardinien muss alles haben, ohne dass man nur im geringsten an mich denkt oder nach mir fragt – da ist auch noch Ihr König von Preussen – doch zu viele alte Wunden werden durch dies alles aufgerissen und neue fühlbare Wunden geschlagen!"9 In der Thronrede Georgs II. aber lesen wir, er habe bei den Verhandlungen sich bemüht, für seine Verbündeten die günstigsten Bedingungen zu erlangen; auch sei er mit rückhaltloser Offenheit ihnen gegenüber verfahren. Das Gegenteil war die Wahrheit. Gleichviel, die Kaiserin-Königin konnte auch dem definitiven Frieden, der einige Monate später in Aachen geschlossen wurde, nicht fernbleiben. Als aber der englische Gesandte nach erfolgter Unterzeichnung sich um eine Audienz bei Maria Theresia bewarb, um ihr seine Glückwünsche auszusprechen, da liess sie ihn in höflicher Form bitten, davon abzusehen. Sie habe sich dahin ausgesprochen, wurde ihm mitgeteilt, dass Beileidsbezeugungen besser am Platze sein würden als Glückwünsche. Was Österreich zwei Mal, 1713 und 1748, von seinem englischen Bundesgenossen erfahren hatte, das erlebte Preussen am Ende des siebenjährigen Krieges. Es ist das berühmte Schulbeispiel für die Behandlung, welche Englands Verbündete von ihm zu erwarten haben. Friedrich der Grosse hat an der Seite Englands sechs Jahre lang heldenhaft gekämpft [30] und sich gegen die Übermacht seiner Feinde behauptet. "Des Königs Ruhm erfüllte die Welt," sagt der sonst über Friedrich so gehässig urteilende Macaulay. Auch die Sache Englands wird in diesem Kriege von einer grossen Persönlichkeit geführt, von dem älteren William Pitt, der die Staatsleitung mit Geist und Energie erfüllt, der unermüdlich Armeen aufstellt und Flotten entsendet, um den Feind niederzuzwingen. Der Feind ist Frankreich und das Ziel des Kampfes die Ausdehnung in Amerika und in Indien. Aber auch die Hilfe Preussens weiss Pitt zu schätzen. Durch Friedrichs militärische Taten werden die besten Kräfte Frankreichs in Europa festgehalten. Mit einem Teil der Hunderttausende, sagt Koser, die es Jahr für Jahr nach Deutschland sandte, hätte es Kanada behaupten können. "Amerika ist in Deutschland erobert worden," lautet Pitts berühmtes Wort im Parlament. Pitt hielt getreulich an dem Bunde fest. So lange er im Amte sei, hat er oft erklärt, werde England keinen Utrechter Frieden schliessen, es werde niemals, auch nicht in höchster Not, einen Bundesgenossen aus egoistischen Gründen im Stiche lassen. Ein Hauch persönlicher Freundschaft weht uns aus den Briefen entgegen, die die beiden Staatslenker einander schrieben. Pitt war ein ehrlicher Bewunderer des Preussenkönigs, den er mit Alexander von Mazedonien vergleicht, während Friedrich die alte Römertugend in dem Engländer verkörpert zu erblicken vermeinte. Er hielt ihn auch für den künftigen Friedensbringer. "Sie sind vielleicht der einzige Mensch in Europa", schrieb er 1760, im fünften Kriegsjahre, "dessen Weisheit die Stimmung zu schaffen vermag, um zu einem ruhmreichen Ende dieses für alle Teile gleich verderblichen Krieges zu gelangen." Dennoch sollte Pitt dieser Friedensbringer nicht werden. Es geschah etwas ähnliches wie am Ende des spanischen Erbfolgekrieges, nur dass dieses Mal den Ereignissen nicht eine tiefe volkstümliche Bewegung und nicht ein völliger Wechsel der Parteien im Parlamente voranging. Der Um- [31] schwung in der Haltung Englands ging von der obersten Stelle im Staate aus. Georg III., ein junger Mann von 22 Jahren kam zur Herrschaft, ebenso ehrgeizig wie unerfahren und durch keine Scheu gebunden gegenüber dem grossen Staatsmanne und seiner Kriegspolitik. Georg III. wollte ein persönliches Regiment errichten und wollte selbst der Friedensbringer sein. Sein Günstling und Berater Lord Bute war in der auswärtigen Politik ein Neuling, wie der König selbst. Aber diese beiden entschieden über die Politik des Staates. Frankreich, scheinbar zum Frieden geneigt, wartet nur auf den Beitritt Spaniens, um den Kampf mit neuer Kraft fortzusetzen. Pitt durchschaut das Spiel und erkennt auch, dass die Spanier die Entscheidung nur hinzögern, bis die von Amerika erwartete Silberflotte in den Hafen von Cadiz eingelaufen wäre. Pitt hält den Krieg mit Spanien nicht nur für unvermeidlich, sondern findet auch, dass derselbe sofort von englischer Seite begonnen werden sollte. Darüber kommt es zu erregten Auseinandersetzungen im Kabinett und zum Rücktritt Pitts. Der Krieg mit Spanien ward dennoch zur Tatsache und brachte den britischen Flotten und Landungsheeren neue Erfolge. Und dann kam der Friede. Ein Friede, wie ihn Pitt nach Inhalt und Form niemals geschlossen haben würde. In der Form ein Separatvertrag, den England ohne seinen Hauptverbündeten mit Frankreich und Spanien schloss. Hinsichtlich des Inhalts gab das siegreiche Grossbritannien zu allgemeinem Erstaunen weit mehr von seiner Beute freiwillig heraus, als es im Interesse eines dauernden Friedens notwendig erschien. Pitt würde einen weit grösseren Anteil für England gefordert und wahrscheinlich auch erreicht haben. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, dass auch so noch der Gewinn Englands gewaltig war, dass die Franzosen aus dem Festlande von Amerika völlig verdrängt und auch ihrer grossen Stellung in Indien verlustig gegangen waren. [32] Preussen blieb nach dem Abschluss der Präliminarien, ohne die gewohnten englischen Subsidien, sich selbst überlassen. Friedrich hatte erklärt, dass er den Engländern den Besitz ihrer Eroberungen redlich gönne, aber nicht er wolle bei dem Spiele "die Musik bezahlen". Nicht dem englischen Bündnisse, sondern seiner ausharrenden Tapferkeit und dem Thronwechsel in Russland hat Friedrich der Grosse es zu danken gehabt, dass er seinen Staat zuletzt ohne Gebietsverlust und mit hoher Steigerung seines Ansehens in der Welt aus der Not der sieben Jahre herauszuziehen vermochte. Friedrich der Grosse hat den Streich von 1762 nie vergessen. Er blieb bis an sein Lebensende der ingrimmig Enttäuschte, der von einem Bündnisse mit England nichts mehr hören wollte, "nach der abscheulichen, ja, ich kann wohl sagen, niederträchtigen Art", wie man ihn behandelt habe. So kehrt es in seinen Briefen immer wieder. "Kein Staat wird fortan die Freundschaft der Engländer suchen, jeder wird sich hüten, mit ihnen zu tun zu haben". Das Urteil ist hart, zumal im Munde eines Königs, der selbst in seiner Laufbahn zwei Sonderfrieden geschlossen hat. Aber er hat immer erklärt, dass ein Fürst dergleichen nur im Falle bitterer Notwendigkeit tun dürfe. Was ihn empörte, war, dass England inmitten kriegerischer Erfolge ihn fallen gelassen und keinen Finger mehr gerührt hatte, um auch seine Interessen zu schützen. Wir hören freilich, dass auch in England die Entrüstung über den Friedensschluss weit verbreitet war, aber der Zorn jener Leute, welche Lord Butes Wagen mit Steinen und Kot bewarfen, galt nicht der Preisgabe Friedrichs, sondern nur dem unrühmlichen Eifer einer Regierung, welche um des raschen Friedens willen einige wertvolle Stücke aus der gewonnenen Beute hatte fahren lassen. Und doch war, was Friedrich erlebte, nichts anderes als was vor ihm Frankreich 1674, Österreich zweimal im 18. Jahrhundert, 1713 und 1748, erfahren hatte. Einige Jahre [33] nach dem Ende des siebenjährigen Krieges haben König Friedrich und Kaiser Josef, die alten Gegner, ein paar feierliche Zusammenkünfte gehabt. Sie haben höflich und korrekt mit einander verkehrt; auf der Seite Josefs bemerkt man wohl jene Mischung von Bewunderung und Misstrauen, die ihn dem berühmten Preussenkönige gegenüber stets erfüllt hat. Aber in einem Punkte stimmen sie überein. Eines Tages kommt das Gespräch auf die Engländer und sogleich sind die beiden Fürsten darin einig, dass England ein unzuverlässiger Bundesgenosse sei. Josef weist auf den Aachener Frieden hin, Friedrich erinnert an den Ausgang des siebenjährigen Krieges. Das deutsche Volk hat sich das Urteil Friedrichs des Grossen zu eigen gemacht. Der Fall von 1762 hat seither als das klassische Beispiel dafür gegolten, dass England ein unzuverlässiger Bundesgenosse sei. "England", so sagt Bismarck in den Gedanken und Erinnerungen (1, 334), "hat im Laufe der neueren Geschichte jederzeit das Bedürfnis der Verbindung mit einer der kontinentalen Militärmächte gehabt und die Befriedigung desselben, je nach dem Standpunkt der englischen Interessen, bald in Wien, bald in Berlin gesucht, ohne, bei plötzlichem Übergang von einer Anlehnung an die andere, wie im siebenjährigen Kriege, scrupulöse Bedenken gegen den Vorwurf des Imstichlassens alter Freunde zu hegen". Man hat die Erklärung für diese Haltung bald in der insularen Lage gefunden, bald hat man gesagt, die englische Verfassung lasse Bündnisse von gesicherter Dauer nicht zu. Keine von beiden Erklärungen ist völlig genügend. Der tiefste Grund liegt wohl in der Staatsauffassung des Engländers. Auf diese werden wir noch zurückkommen und wollen hier nur noch kurz darüber reden, inwiefern etwa jenes Wort von der Verfassung das Richtige trifft. Die Fälle eines jähen Übergangs von der Kriegs- zur Friedenspolitik, eines plötzlichen, nicht durch militärische Ereignisse erzwungenen Umschwungs sind meistens durch einen Wechsel der herrschen- [34] den Gruppen herbeigeführt. Das Parlament, die Parteien, die öffentliche Meinung greifen korrigierend in die Leitung der Staatsgeschäfte ein und können das Programm derselben in das Gegenteil verkehren. Wenn das der Hergang ist – es ist nicht immer der Fall – so sieht ein jeder, dass man es mit einer Wirkung des parlamentarischen Systems zu tun hat. Der rasche Wechsel von Whig und Tory kann auch einen raschen Wechsel in der auswärtigen Politik herbeiführen. So hat das Ausland es im 18. Jahrhundert empfunden und wohl den englischen König beklagt, dass er nicht in der Lage sei, sich ebenso wie jeder andere Fürst für die von seinem Staate übernommenen Verpflichtungen einzusetzen. Was so empfunden wurde, gilt der historischen Betrachtung als der Gegensatz des parlamentarisch regierten zum absoluten Staat. Heute ist dieser Gegensatz verschwunden. Heute – vollends seit dem Sturze des Zarentums – darf der absolute Staat unter den Kulturnationen als ausgestorben gelten. Das parlamentarische System in seinen verschiedensten Abstufungen erfüllt die Welt. Dass es aber deshalb mit der Bundestreue moderner Staaten schlechthin so viel übler bestellt sei als etwa im 18. Jahrhundert, wird im Ernste wohl niemand behaupten wollen. Wenn Russland der Entente untreu wurde und seinen Frieden mit den Zentralmächten schloss, so war es nur durch die deutschen Waffen dazu gezwungen worden, d. h. es handelte in jener äussersten Notlage, die auch Friedrich als das höchste Gebot für den Staatslenker, über dem der Bundestreue stehend, gelten liess.
 Die Folge der Ereignisse führt uns zum Amerikanischen Unabhängigkeitskriege. Ein merkwürdiger Krieg! England hat ihn verloren. Sieht man das in seiner Landmacht so schwache England gegen jene entschlossenen Kolonialen streiten, sieht man ferner, wie im Laufe des langjährigen Krieges Frankreich, Spanien und Holland als Verbündete der [35] Amerikaner auftreten, England aber allein bleibt, so erwartet man wohl als das Endergebnis einen Friedensschluss, in dem ein tief gedemütigtes England sich allen Bedingungen seiner zahlreichen Gegner unterwirft. Dennoch ist das historische Bild des Friedens von Versailles ein wesentlich anderes. Dass die von England gebrachten Blutopfer trotz seines Misserfolges erträglich waren, ist die allgemeine Erscheinung aller englischen Kriege bis zum Beginn des gegenwärtigen. Dass sein Heer noch ein Söldnerheer war, versteht sich von selbst. Aber dieses Mal wurde auch die von England längst geübte Praxis der Soldatenlieferungsverträge mit kleinen deutschen Fürsten in ungewohnter Ausdehnung befolgt. Der Minister Lord North verteidigte die Massregel erfolgreich vor dem Parlament, denn er konnte auf die günstigen Abmachungen, auf die Billigkeit der gemieteten Truppen und auf den erwarteten militärischen Erfolg hinweisen. Und wenn die Redner der Opposition das Schmähliche solcher Verträge hervorhoben, so fiel dieser Vorwurf mehr auf das Haupt jener kleinen deutschen Despoten und konnte von einem englischen Parlamente mit aller Gelassenheit angehört werden. Genug, man konnte Jahre lang in Amerika Krieg führen, ohne dass der englische Volkskörper erschöpft war. Die andere Seite des Kampfes aber, der Krieg mit den europäischen Mächten, brachte Gewinne und Verluste, doch keine grossen Entscheidungen. Zur Erzielung eines glimpflichen Friedens trug endlich auch die von so manchem früheren Falle her uns nun schon wohlbekannte Geschicklichkeit der Engländer bei, zunächst mit einem der wichtigsten Gegner ins Reine zu kommen. Da sie die Unmöglichkeit erkannt hatten, die Kolonisten wieder unter die englische Herrschaft zu zwingen, so schlossen sie zuerst mit ihnen ab. Amerika ward frei und günstig gestellt. Dann erst erfolgte die Auseinandersetzung mit den übrigen Feinden, bei der es allerdings nicht ohne Opfer von englischer Seite abging. Um nur von Europa zu reden, so wurde das wichtige Minorka den Spaniern überlassen, Frank- [36] reich aber, das vornehmlich zur Herstellung seines im siebenjährigen Kriege verlorenen Prestige in den Kampf eingetreten war, wurde von der siebzig Jahre lang ihm auferlegten Verpflichtung befreit, in Dünkirchen keine Befestigungen zu unterhalten. Aber mit alledem, und selbst mit dem Verlust der wertvollsten Gruppe seiner Kolonien, blieb England in seiner Stellung und seinem Streben die erste See- und Handelsmacht. In seiner kolonialpolitischen Laufbahn hatte es freilich eine eindringliche Lehre empfangen, die es sich später gründlich zu nutze zu machen verstand. Aber es hat nicht etwa sein Herz an die Wiedereroberung des Verlorenen gehängt. Rachegedanken zwecklos fortzuspinnen, ist nicht englische Art. Der Verlust Amerikas, längst befürchtet, wurde hingenommen ohne Sentimentalität, ohne Revanchegedanken, ohne ein Elsass-Lothringen daraus zu machen. Bald genug erfuhr die Welt, dass England so stark und kampfbereit war wie zuvor. Ein Jahrzehnt nach dem Ablauf des amerikanischen Ringens nahm es den Kampf gegen die französische Revolution auf, der, mit der kurzen Unterbrechung durch den Frieden von Amiens, durch die Zeiten der Revolution, des Konsulats und des Kaiserreichs fortgesponnen wurde, immer mit dem Ziel der Niederwerfung Frankreichs und der Beseitigung der von ihm drohenden neuen Universalmonarchie. Der Kampf war erst zu Ende, als Napoleon Bonaparte, der Heros des neuen Frankreich, als Gefangener Englands auf St. Helena sass. "Es wird ein kurzer Krieg werden", hatte der jüngere Pitt, der leitende Minister, 1793 noch gemeint. Aber Edmund Burke, der berühmte Verfasser der Gedanken über die französische Revolution erwiderte ihm: "O nein, der Krieg wird lang und gefährlich werden, aber er ist nicht zu vermeiden". England ward im Laufe dieses grossen Kampfes zum Verbündeten jedes Gegners von Frankreich. Es kämpft mit seinen alten Mitteln, es gewinnt die Oberhand, zuletzt die Alleinherrschaft zur See, es sperrt die Strassen auf dem Meere, es vernichtet den Han- [37] del, es erbeutet den Kolonialbesitz des Feindes und seiner Vasallen. In den Landkrieg aber greift es ein mit massigem militärischem Aufwande und mit ungeheuren Subsidienzahlungen an alle Feinde Frankreichs. Daher besonders rührt die für jene Zeiten fabelhafte Summe von 800 Millionen £str., d. h. 16 Milliarden Mark, zu der am Ende des Kriegszeitalters die britische Staatsschuld angeschwollen war. Sicherlich wird dieser bis zu dem für Napoleon so bitteren Ende durchgeführte Krieg als ein klassisches Beispiel der ungeheuren Zähigkeit Englands anzuführen sein. Aber trotz aller jener Leistungen werden wir nicht den jedes Britenherz mit Stolz erfüllenden Gedanken für richtig halten, dass England es gewesen sei, das den Riesen Napoleon gefällt habe. Die Völker und die Staaten des Festlandes haben die Schlachten geschlagen, sie waren die Sieger im Befreiungskriege. Die beiden Friedensschlüsse aber, der erste und der zweite Pariser Friede wurden gemeinsam von England und seinen Verbündeten mit Frankreich geschlossen, doch Englands Mitwirkung hinterliess dabei seine deutlichen Spuren. Vornehmlich als sein Werk galt schon die erste Thronerhebung Ludwigs XVIII. Vollends die eilige Wiederherstellung des Bourbonen nach der Schlacht bei Belle Alliance wird man gewiss als eine wohlbedachte politische Tat Wellingtons zu würdigen haben, der damit die Friedensunterhändler in eine fertige Lage versetzte und es ihnen z. B. unmöglich machte, dem geschlagenen Frankreich mit seinem friedfertigen Könige an der Spitze die schon damals von den deutschen Patrioten geforderte Auslieferung von Elsass und Lothringen noch zuzumuten. So kam Frankreich allzu glimpflich davon. Unter den festländischen Staaten, wie sie nun hergestellt waren, schien zum Wohle Englands das vielgepriesene Gleichgewicht endlich in die Erscheinung getreten zu sein, als Bürge für einen dauernden Friedenszustand. England hatte zwar viel von seiner Beute herausgegeben, aber doch eine Reihe wertvoller Stücke behalten. Und was mehr war, es herrschte fortan [38] ohne Rivalen auf den Meeren. "Durch die unversöhnliche Rachsucht der Franzosen", sagt Treitschke, "wurden Preussen und Frankreich während eines Vierteljahrhunderts auf einer Stelle festgebannt, beide Staaten waren verhindert, ihre natürliche Interessengemeinschaft zu erkennen und der friedlichen Welteroberung, welche Englands Handelspolitik in der Stille einleitete, rechtzeitig entgegenzutreten". Da es nicht unsere Absicht ist, von kolonialen Kriegen und Friedensschlüssen zu reden, so bliebe aus der Geschichte des 19. Jahrhunderts nur noch ein kurzes Wort über den Krimkrieg und den Pariser Frieden von 1856 zu sagen. Wenn es einen Triumphator in diesem Krieg der Westmächte gegen Russland gab, so war es nicht England, sondern Napoleon III. Und so war er auch die entscheidende Persönlichkeit auf dem Pariser Kongresse. Die Bedingungen des Friedens, ungünstig für Russland, trugen dem besonderen englischen Interesse nur etwa in dem Punkte der Neutralisierung des Schwarzen Meeres Rechnung. "Wir nehmen den Frieden an ohne Enthusiasmus, aber auch ohne Opposition," sagte Lord Derby. Wenn wir zum Schlusse auch noch den Burenkrieg hier zur Sprache bringen, so geschieht es in der Erwägung, dass er in seiner Ausdehnung wie in seiner politischen Bedeutung aus dem Rahmen blosser kolonialer Kämpfe, wie England sie in neueren Jahrhunderten so zahlreich geführt hat, weit heraustritt. Man hatte es nicht mit Kaffernhäuptlingen oder afrikanischen Derwischen zu tun, sondern mit ein paar Staatswesen, die von einer nach Abstammung rein europäischen Bevölkerung besetzt und beherrscht waren, gleichartig derjenigen der benachbarten Kapkolonie, aus der sie auch durch Abwanderung ausgeschieden war. Das britische Imperium sucht diese gleichartigen Elemente jenseits seiner Grenzen sich einzuverleiben, es kann mit seiner Expansionstendenz nicht Halt machen vor diesen Bauernstaaten, und das umso weniger, seitdem dieselben durch ihre Minenindustrie, durch die einströmende internationale, besonders englische Bevöl- [39] kerung, durch ihre geschäftlichen Beziehungen jenen bäuerlichen Charakter nicht mehr rein erhalten haben. Einige Jahrzehnte hatte das Schauspiel der friedlichen und feindlichen Durchdringung schon gewährt, der Burenkrieg ist nur der letzte Akt der Tragödie. Auch ist das Ziel der Einverleibung keineswegs immer fest und bestimmt von England verfolgt worden. Auch hier macht der schon berührte Wechsel der beiden Richtungen englischer Politik sich geltend, der nach aussen schwächeren und der starken, der liberalen und der konservativen, der Politik Gladstones und derjenigen Salisburys. Jene kommt zum Ausdruck in der Konvention von 1881, in der Freilassung der Burenstaaten, in dem Zufriedensein mit blosser Suzeränität, diese in den Forderungen für die "Uitlanders", in der Kriegs- und Annexionspolitik Chamberlains, in dem Programm von Cecil Rhodes, der die Karte Südafrikas einheitlich rot gefärbt zu sehen verlangt. An diesem Programm hält England fest, trotz aller Wechselfälle des Krieges. Auf die Besetzung der Hauptstädte folgt sofort die Annexion. Da die im Felde geschlagenen Buren auch durch den Guerillakrieg ihr Schicksal nicht zu wenden vermögen, so finden sie sich zur Unterhandlung ein. Dieselbe nimmt einen charakteristischen Verlauf. Die Vertreter des Burenvolkes suchen einen Teil ihrer Unabhängigkeit zu retten, England verlangt die völlige Aufgabe derselben. "Sr. Majestät Regierung", so schrieb der Kriegsminister an Lord Kitchener, "kann keine Vorschläge in Erwägung ziehen, welche basieren auf der Fortdauer der Unabhängigkeit der früheren Republiken, welche in aller Form der englischen Krone annektiert sind". Den Buren wurde ein Friedensentwurf vorgelegt, der ohne weitere Verhandlung angenommen oder abgelehnt werden musste. Die Vertreter der Buren entschliessen sich zur Annahme auf Grund der Erwägung, dass die von den englischen Militärbehörden befolgte Kriegspolitik zur völligen Verwüstung des Grund und Bodens beider Republiken führen müsse, dass die Wegführung der ge- [40] fangenen Familien in die Konzentrationslager in kurzer Zeit zum Tode von 20 000 Menschen geführt habe und die Aussicht bestehe, "dass bei Fortsetzung des Krieges unser ganzes Geschlecht auf diese Weise aussterben würde". Jener Friedensentwurf aber legte in seinem ersten Artikel den Buren die Verpflichtung auf, Eduard VII. als ihren gesetzlichen Herrn anzuerkennen. Und da die weiteren Artikel den Buren dafür die Unterstützung der englischen Regierung beim Wiederaufbau ihrer Farmen in Aussicht stellten, so entschlossen sie sich zur Annahme, und jene Stimmen, welche sich entweder für die Fortsetzung des Kampfes oder für die bedingungslose Unterwerfung, als einen rühmlicheren Ausgang ihres Existenzkampfes, erhoben hatten, mussten verstummen. Wenn England einen Krieg gewonnen hat, so will es auch vor aller Welt als der Sieger erscheinen.
 Und nun, da wir die Reihe der Friedensschlüsse vor unseren Augen haben vorüberziehen lassen, hätten wir die Frage zu beantworten, welche eigentümlichen Züge hier festzustellen wären. Wie schliesst England Frieden und wie unterscheidet es sich dabei von anderen Nationen? – Manche Beobachtung drängt sich wie von selber auf. Die Zähigkeit in der Weiterführung des Krieges, die erbarmungslose Ausnutzung des Sieges über einen völlig geschlagenen Feind, die kühle Preisgabe der Bundesgenossen, die Neigung, einen oder den andern aus dem Ring der Gegner herauszulocken, um ihn zur Sonderverhandlung oder zum Friedensschlusse zu vermögen – das alles sind sicherlich scharf ausgeprägte Eigenarten Englands als kriegführender Macht. Nicht als ob diese Züge sich gelegentlich nicht auch bei anderen fänden – man denke nur an die verschlungene Politik des grossen Kurfürsten oder auch Friedrichs des Grossen –, aber nirgends treten sie so oft, so unverhüllt, so selbstverständlich auf wie hier. Dieses vorausgeschickt, versuchen wir auch einmal, die [41] einzelnen Fälle nach ihrer typischen Eigenart in gewisse Gruppen zu ordnen. Wir erhalten etwa die folgenden:
Natürlich liessen sich der Spielarten auch noch mehr unterscheiden. Man würde Beispiele geschickter Kombinationen von a und b oder auch von b und c nachzuweisen haben. Oder man könnte die Grade bewiesener Zähigkeit beliebig nach Z l, Z 2 und Z 3 unterscheiden und würde eine solche Betrachtung etwa mit dem hundertjährigen Kriege des Mittelalters zu beginnen, würde bei den holländischen Kriegen des 17. Jahrhunderts ausführlich zu verweilen und mit dem grossen Kampfe gegen das napoleonische Frankreich, wenn nicht gar mit der gesamten Periode von 1688–1815 zu enden haben.
 Aber nicht mit so schematischen Formulierungen möchte ich schliessen. Hinter dem englischen Staate steht das englische Volk. Die Staatsmänner vollbringen, was der Geist des Volkes von ihnen fordert. So mögen denn noch einige Bemerkungen folgen über die Psychologie des englischen Volkes10 und besonders über seine Staatsauffassung. Wie oft haben wir von einem merkwürdigen Gegensatz zwischen dem Wesen des einzelnen Engländers und dem des englischen Staates reden hören. Im Privatleben, sagt man, ist der Engländer, zumal in seiner Heimat, liebenswürdig, gastfrei, gefällig im besten Sinne, nach aussen zeigt sich der englische Staat hart und egoistisch, rücksichtslos und brutal. Auch ein Wort von Kant wird zitiert,11 welches lautet: "Die englische Nation als Volk betrachtet, ist das schätzbarste Ganze von Menschen im Verhältnis gegen einander, aber als Staat gegen andere Staaten der verderblichste, gewaltsamste, herrschsüchtigste und kriegserregendste von allen". Die Beobachtung erstreckt sich auch auf das Verhältnis Englands zu seinen eigenen Bundesgenossen. Wie gebieterisch tritt es heute Frankreich gegenüber auf, und wie freundlich und sanft, wie fein säuberlich verfahren wir mit unseren Verbündeten. [43] Wir fragen: wie versteht der Engländer seinen Staat und was fordert er von ihm? Er unterscheidet, er zerlegt, wie man gesagt hat,12 das was wir Staat nennen, in die zwei Begriffe der Regierung und der Nation. Die erstere soll das Geschöpf der zweiten sein, und sie ist es auch. Die Nation hat das Unterhaus gewählt und aus seiner Mehrheit ist das ausführende Organ, das Kabinett hervorgegangen. Der Engländer sieht in diesem, bei jeder Neubildung der Regierung sich vollziehenden, Prozess den besten Teil seiner Freiheit, aber dabei täuscht er sich dennoch über die wahre Lage der Dinge. Denn während er glaubt, dass die Regierung nun auch der fortwährenden Kontrolle des Parlaments unterliege, ist sie dieser Kontrolle längst entwachsen.13 Wie wir heute das englische Kabinett kennen, übt es die Exekutive mit einer Allmacht aus, in der der alte Begriff des englischen Parlamentarismus nicht mehr wiederzuerkennen ist. Der für Volk und Parlament völlig überraschende Eintritt Englands in den Weltkrieg mag als genügender Beweis dafür gelten. Von dieser Lage der Dinge weiss aber die grosse Menge nicht viel. Sie glaubt noch fest an die in jedem Augenblick entscheidende Funktion des Parlaments. Nur in dieser Gestalt erscheint ihr die staatliche Autorität erträglich. Eifersüchtig gegenüber jedem Zwange, dem seine Handlungen innerhalb der Gesellschaft unterliegen, ist der Engländer erst beruhigt, wenn er sich überzeugt hat, dass es "by Act of Parliament" so und nicht anders zu geschehen habe. Er hasst das polizeiliche Verbot und findet den Deutschen unfrei, weil er sich nicht bewegen könne, ohne fortwährend auf polizeiliche Verbote zu stossen. Er freut sich in Unschuld seiner Freiheit, wenn er sich in den öffentlichen Parks ungehindert auf den Rasenflächen ergehen darf. Im eigenen Lande möchte er den Staat nicht zu oft bemerken. Da soll er bescheiden auftreten, soll sich so wenig wie möglich in die Angelegenheiten des einzelnen mischen. Aber dem Auslande gegenüber wünscht der Engländer seinen [44] Staat ganz anders. Da soll er sich geflissentlich einmischen, da soll er, gestützt auf die Beherrschung des nassen Elements, auch auf dem trockenen Lande den englischen Anspruch überall hervorkehren, soll dem Engländer den Weg ebnen in allen Teilen der Welt. Darum ist jede Macht, die dem Wachstum der Welt Englands in den Weg treten könnte, als eine feindliche Macht zu behandeln. Darum muss heute Deutschland ebenso niedergezwungen werden, wie vor ihm Spanien, Holland und Frankreich. Das ist einfach die Aufgabe des Staates.14 Ist England alsdann in einem Kriege begriffen, so hat der Staat dafür zu sorgen, dass es "gewinnt", wie man es gern mit dem Sportausdruck nennt. Der Sieg muss vollkommen, restlos, er muss auf allen Fronten erfochten sein. Es braucht nicht auf einmal zu geschehen, denn England hat Zeit. Ja, man erinnert sich mit Behagen daran, dass es im Anfang früherer Kriege so oft Niederlagen erlitten hat. Nach einem Naturgesetz, so hat Chamberlain einmal gesagt, wird England stets zuerst geschlagen, um am Ende umso vollständiger zu triumphieren. Dann aber soll der Gegner auch nicht nur überwunden werden, er soll sich auch als den Geschlagenen bekennen, die Welt soll erfahren, dass England der Sieger ist. Die Demütigung des Gegners wird zum Selbstzweck. Gerade hierfür fehlt es nicht an Beispielen aus der Geschichte. 1719–20 hat England an der Spitze der Quadrupel-Allianz von dem zum Friedensschlusse bereiten Spanien vor allem gefordert, es müsse zunächst einmal die Quadrupel-Allianz annehmen, von der noch kürzlich der spanische Minister erklärt hatte, niemals werde sich sein König "à cet exécrable traité" unterwerfen. Sei aber diese Forderung einmal erfüllt, so werde man auch zu Zugeständnissen bereit sein. Und so geschah es in der Tat. Neuerdings ist diese Neigung noch stärker geworden. Die Masse, sagt der Franzose Boutmy, will ein England, das nicht nur allmächtig sei, sondern auch "parlant de haut". So habe Chamberlain im Momente des Triumphes von Faschoda auch Wert [45] darauf gelegt, durch die Fortsetzung seiner Rüstungen aller Welt die gewaltige Überlegenheit Englands zu beweisen.15 Nicht anders auch der Ausgang des Burenkrieges mit der obenan, in Artikel 1, stehenden Anerkennung der Annexion der Burenstaaten und dem dann folgenden entgegenkommenden Inhalt der weiteren Artikel. Was solcher Anschauung zu Grunde liegt, ist jenes bis in die Sphäre des Religiösen gesteigerte Nationalgefühl des Engländers, jene Denkweise, die bei ihm seit den Zeiten des Puritanismus haften geblieben ist. Was Ranke von den Genossen Cromwells sagt: "Der Gott Israels gilt ihnen als besonderer Gott, vor dessen Angesicht sie als die zweiten Erwählten zu streiten glauben", das mag auch heute noch als Ausdruck englischer Anschauung gegenüber allen fremden Völkern gelten. Ja, es gibt heute in England eine Gesellschaft, die, mit wenig historischem Sinn begabt, in allem Ernste behauptet, die Engländer seien die verlorenen zehn Stämme Israels, also in der Tat das auserwählte Volk Gottes. Wenn dem so ist, so sind alle anderen Nationen so viel geringer, stehen so viel tiefer, darum sind Menschlichkeit und Milde ihnen gegenüber auch so viel weniger am Platze. Hier fühlt sich der Engländer schlechthin als der Höherstehende, hier ist erlaubt, was dem Volksgenossen gegenüber verwerflich wäre, hier hat nur Englands Wohl zu reden, hier ist man jenseits von Gut und Böse. Dieser Denkweise entspringt auch der oft beschriebene Zug abstossender Härte gegen andere Völker, der so auffallend absticht von dem weichen Mitgefühl gegen die eigenen Volksgenossen; jener Zug, den Burke in der Figur des englischen Beamten in Indien schildert, der dem bengalischen Bauern seine bescheidene Portion Reis und Salz verkürzt und sich persönlich bereichert, um nachher, in England, der gütige Herr seiner Untergebenen zu werden. Es ist ein Zug, der sich vollends dem Feinde gegenüber zur Brutalität und Grausamkeit steigern kann, wenn er auch mit echter Leiden- [46] schaft garnichts gemein hat. Er offenbart sich in der Behandlung der indischen Rebellenführer, die man, um die Hinrichtung eindrucksvoller zu gestalten, vor die Mündungen der Kanonenrohre bindet, er ist ausgeprägt in dem von Kitchener im Kampfe um den Sudan gegebenen Befehl, alle Derwische, die in die Hände englischer Soldaten fallen, mitleidslos zu töten, und er ist wieder zu erkennen in dem von demselben Kitchener befolgten System der Konzentrationslager, das die Herzen der Buren zur Unterwerfung reif machen soll, indem es ihr Land der Verwüstung anheimgibt, ihre Frauen und Kinder aber so in Verwahrung nimmt, dass sie zu Tausenden dahinsterben. Er ist verkörpert in jener Hungerblockade, die heute, ohne alle moralischen Bedenken, über 70 Millionen Deutsche verhängt wird. Derselbe Geist ist es auch, der die von Gott erwählte Nation zu der Überzeugung führt, dass sie allein auf dem rechten Wege sei, dass alle edle Menschlichkeit, ja die gesamte Kultur, die Gesittung der Welt auf ihrer Seite streiten gegen die rohe Gewalt, die in der Form des Militarismus zum Selbstzweck wird und alles Höhere niederzutreten sucht.16 Es hat gegenüber solchen Anschauungen, die nicht von heute sind, zwar niemals an warnenden Stimmen gefehlt. John Morley hat einmal von dem Unglückstage gesprochen, "an dem wir uns zwei Gewissen anschaffen würden, das eine für das Mutterland, das andere für die weite Welt da draussen". Es hat auch, um auf unser Thema, auf die Kriege und die Friedensschlüsse zurückzukommen, stets Männer gegeben, die für Masshaltung, für weise Beschränkung der Ziele eintraten. Im Jahre 1800, während des Krieges gegen Bonaparte, hat Charles James Fox warnend erklärt: "Unsere Geschichte ist voll von Beispielen, wo wir sich bietende Gelegenheiten, zu verhandeln, versäumt haben. Wir haben stets Schaden davon gehabt." In neuerer Zeit ist der genannte Morley so manches Mal als Mahnender aufgetreten, er war auch einer derjenigen Minister, die beim Eintritt Englands in den [47] Weltkrieg ihr Amt niedergelegt haben. Aber diese Stimmen sind verhallt und der englische Staat fühlt sich berufen, das Urteil des Weltgerichts an seinem Gegner zu vollstrecken.
 Wir sind am Ende unserer Darlegungen. Mehr zu sagen, den deutschen Staatsmännern, die einmal den Frieden mit England zu schliessen haben werden, den Weg weisen zu wollen, wäre vermessen. Unterschätzen wird diesen Gegner bei uns wohl niemand mehr. Mögen Volk und Regierung in der entscheidenden Stunde fest zusammenstehen. Dann wird auch unserer Staatskunst die Kraft nicht fehlen, stark und unbeirrt ihren Weg zu gehen, und nach dem alten Spruche zu handeln:
Hie gut Deutsch allewege!

Über das Thema dieser Arbeit ist kürzlich unter dem Titel "Englische Friedensschlüsse" eine kleine Schrift von A. v. Ruville (Halle 1918) erschienen. Doch lässt sich m. E. schon wegen des engeren Rahmens, in dem dieselbe gehalten ist, die nochmalige Behandlung des Gegenstandes wohl rechtfertigen. 1Den Nachweis gedenke ich an anderer Stelle zu bringen. ...zurück... 2Vgl. F. Brie, Imperialistische Strömungen in der englischen Literatur. 1916. S. 3. ...zurück... 3Koch, Die Friedensbestrebungen Wilhelms III von England in den Jahren 1694–1697. 1903. S. 98. ...zurück... 4Vgl. W. Michael, "Das Urbild John Bulls." Hist. Zeitschr. 100. ...zurück... 5Nach den englischen Akten im Record Office London. ...zurück... 6"A Review of a Pamphlet entitled, Observations on the Treaty of Seville, examin'd. 1730." ...zurück... 7Lehrreich ist hier ein Schreiben des englischen Gesandten in Wien, Sir Thomas Robinson, aus Paris vom 20. Juni 1731, wo es heisst "I find the French in general are much discontented at our late behaviour, and the Cardinal not a little displeased at his friend Mr. – (gemeint ist Horace Walpole) not having let him into the secret." Hist. Mss. Comm. Rep. 15, App. 6.83. ...zurück... 8Coxe, Memoirs of Horatio Lord Walpole, l, 311. ...zurück... 9W. Michael, "Die englischen Koalitionsentwürfe des Jahres 1748." (Forsch. zur brand. und preuss. Gesch. l, 231.) ...zurück... 10Vgl. G. Boutmy, Essai d'une psychologie politique du peuple anglais. 1909. ...zurück... 11Bei Dietrich Schäfer, Weltgeschichte der Neuzeit. 7. Aufl. 1917. 2, 396. ...zurück... 12Hatschek, Die Staatsauffassung der Engländer. 1917. S. 5. ...zurück... 13Vgl. Sidney Low, Die Regierung Englands. Übers. v. Joh. Hoops. Tüb. 1908; A. O. Meyer, Deutsche Freiheit und englischer Parlamentarismus. München 1915. ...zurück... 14Auf die Logik dieser Denkweise und die daraus entspringende Kriegsgefahr hat Erich Marcks schon vor Jahren hingewiesen in seinem Aufsatz "Die Einheitlichkeit der englischen Auslandspolitik von 1500 bis zur Gegenwart". (Wieder abgedruckt in Männer und Zeiten. 4. Ausgabe. 2, 203. ...zurück... 15A. a. O. S. 443. ...zurück...
16Über die englischen Stimmungen
gegen Deutschland seit dem Anfang des Krieges vgl. Meinecke in der
Abhandlung: "Kultur, Machtpolitik und Militarismus" (aus "Deutschland und der
Weltkrieg", wieder abgedruckt in der Sammlung Preussen und Deutschland im
19. und 20. Jahrhundert. 1918.). ...zurück...

Aus unserem Versandbuchhandel:
Deutschlands Friedensschlüsse seit 1555:
Englands politische Moral in Selbstzeugnissen
Die englische Hungerblockade im Weltkrieg 1914-15
|






