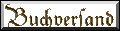|
 Der Westfälische Friede [Scriptorium merkt an: 1648] Die Westfälischen Friedensverhandlungen, bei denen die fremden Mächte über die wichtigsten innerdeutschen Fragen verhandelten, bedeuteten nach dem Aufschwung, den die kaiserliche Politik 1635 in Prag genommen, einen Tiefstand nationaler Entwicklung. Doch mangelte es selbst damals nicht an vaterländisch-deutschen Gesichtspunkten. Der französische Unterhändler schrieb an Kardinal Mazarin: "Wir müssen daran festhalten, daß die Neigung der deutschen Fürsten stark abweicht von den italienischen. Letztere wünschen und billigen aus guter Einsicht und Beratung alles, was ihre Selbständigkeit fördern hilft, und begrüßen es darum, wenn Frankreich einige feste Plätze in Italien behält und ihnen im Notfall schützend die Hand reichen kann. Die Deutschen werden von Vaterlandsliebe viel inniger durchdrungen. Daß Fremdlinge das Reich zerstückeln, ist ihnen ein unerträglicher Gedanke. Getreu einer des Klimas würdigen Politik wollen sie eher den Körper erhalten, von dem sie nur Glieder sind, als seine Zerteilung befördern, aus der jeder Einzelne den größten Vorteil ziehen könnte." Und als die Franzosen drohten, wegen Breisachs den Krieg ein Jahrhundert fortzusetzen, antwortete der kaiserliche Gesandte Trauttmannsdorff: "Nun gut, so werden wir uns unserer Haut wehren." Freilich drangen solche nationale Empfindungen nur selten durch. Das Ruhebedürfnis war für solchen Widerstand gegen französische und schwedische Begehrlichkeiten zu groß. Hatten doch während des ganzen Dreißigjährigen Krieges die Friedensbemühungen bloß kurze Zeit aufgehört! Nach dem Wunsche seiner ersten Urheber wäre er sofort nach dem böhmischen [7] Aufstande beendigt worden. Aber der Kaiser und Maximilian von Bayern hätten das Kriegsvolk bezahlen und ihre Unkosten decken müssen; als gute Haushalter hatten sie das dem unterlegenen Feinde aufgebürdet und lieber den Krieg verlängert. Doch zu grell war den meisten evangelischen wie katholischen Fürsten der Gegensatz zwischen der langen, wenn auch ereignisarmen Friedenszeit und den schweren, wechselreichen Kampfesjahren entgegengetreten. Sie hatten meist durch ungestörte Entwicklung ihrer Heimat mehr zu gewinnen als durch Schlachtenglück. Darum wollten sie Schluß machen und möglichst lange neuen blutigen Auseinandersetzungen vorbeugen. Der konfessionelle Zwiespalt, welcher ursprünglich den Hauptkriegsgrund gebildet hatte, war stark zurückgetreten. Wollten die Deutschen einmal ehrlich und allseitig den Frieden, so begegneten selbst die umstrittensten Fragen keinen unüberwindlichen Schwierigkeiten. Kaiser Ferdinand III., seit 1637 der Nachfolger seines gleichnamigen Vaters, war nicht wie dieser von religiösen Fanatikern abhängig, hielt nur an der Gegenreformation in den habsburgischen Erbstaaten fest und war sonstigen evangelischen Wünschen nicht unzugänglich. Auch im übrigen war schließlich die Verständigung leichter als beim Augsburger Reigionsfrieden. Damals hatten Katholiken und Evangelische ihren Herrschaftsbereich noch nicht abgegrenzt gehabt und deshalb jene sich vor weiteren Einbußen schützen, diese alle Hindernisse ihrer schrankenlosen Ausbreitung wegräumen wollen. Jetzt war allmählich ein Gleichgewicht der ringenden Parteien entstanden und eine große Verschiebung vom freien Spiele der Kräfte nicht mehr zu erwarten. Beide Teile konnten den Tatbestand hinnehmen und sich auf dieser Grundlage vertragen. Schon in Prag hatte man sich geeinigt, daß Kirchengüter, die zu einem bestimmten Zeitpunkt evangelisch oder katholisch gewesen waren, dies künftig bleiben sollten. Dieser Grundsatz wurde in den westfälischen Verhandlungen wiederholt; nur fiel der Vorbehalt hinweg, daß nach 40 Jahren neue Bestimmungen kommen sollten, die jetzigen evangelischen Inhaber ehemals katholischer Stifter also bloß einstweilen geduldet wurden. War man darüber einig, daß gewisse Stifte evangelisch blieben, die jetzt noch katholischen [8] dagegen nicht säkularisiert werden sollten, so durften die Katholiken leichter den evangelischen Stiftsinhabern das hartnäckig verweigerte Stimmrecht auf den Reichstagen gewähren; sie behaupteten trotzdem eine große Mehrheit im Fürstenrate. Die Gleichberechtigung der Reformierten mit den Lutheranern war ebenfalls durch die geschichtliche Entwicklung besiegelt. Auch die Frage, welche Stände von der Reichsacht begnadigt werden sollten, war lösbar, nachdem die Deutschen wirklich und allseitig den Frieden wollten. Vertrauen und Einvernehmen erforderten, daß die aus Land und Eigentum vertriebenen Fürsten heimkehrten und nicht mehr Umsturzpläne schmiedeten. Größere Schwierigkeiten wurden durch die territorialen und finanziellen Interessengegensätze hervorgerufen. Der Entschluß, die Geächteten zu begnadigen, verzögerte sich wesentlich durch das umkämpfte Schicksal des Kurfürsten von der Pfalz. Der Münchner Maximilian hatte mit dem gewonnenen pfälzischen Kurhut einen alten Wunsch der bayrischen Wittelsbacher erfüllt und mit der Oberpfalz seine Kostenrechnung aus dem böhmischen Kriege beglichen. Es bedurfte vieler Erörterungen, bis ein Mittelweg gefunden war: der Pfälzer erhielt eine neue Kur und den rheinischen Teil der väterlichen Erbschaft; die alte Kur und die Oberpfalz blieben bayrisch. Ähnliche Meinungsverschiedenheiten prägten den Verhandlungen mit Frankreich und Schweden ihren Stempel auf. Richelieu hatte den Kampf mit den Habsburgern begonnen, um deren Übergewicht in Süddeutschland zu brechen. Noch immer galten die Gegenden des Oberrheins und Untermains für den ältesten deutsch-nationalen Kulturboden. Obgleich die Habsburger längst ihre österreichische Hausmacht begründet hatten, waren sie auf den Ausbau ihrer oberrheinischen Stellung bedacht gewesen. Sie besaßen auf beiden Rheinufern ansehnliche Gebiete und noch mehr Rechte, durch welche benachbarte Herren und Städte ihre Vasallen oder wenigstens von ihnen abhängig waren. Keine andere Landesobrigkeit jener Gegend erreichte die habsburgische Macht. Deshalb wollte Mazarin möglichst viele dieser habsburgischen Besitzungen und Rechtstitel am Oberrheine erwerben und verlangte zeitweilig außer der Landgrafschaft Ober- und [9] der Landvogtei Unterelsaß auch den Breisgau mit Freiburg und Breisach sowie die Ortenau. Damit hätte er die Habsburger jeder belangreichen Macht in Südwestdeutschland beraubt und sie wesentlich auf die österreichischen Erbstaaten zurückgeworfen; das Band zwischen dem habsburgischen Kaisertum und dem Deutschen Reiche wäre gelockert worden. Soweit war jedoch die Lage noch nicht reif. Der Wiener Hof verteidigte nachdrücklich seine oberrheinischen Überlieferungen, wollte anfangs nur seine geringfügigen unterelsässischen Rechtstitel opfern und gab erst allmählich die ausgedehnteren oberelsässischen Besitzungen, zuletzt auch den rechtsrheinischen Brückenkopf Breisach auf. Die Franzosen hatten mit dem Kaiser persönlich, nicht mit dem Deutschen Reiche Krieg geführt. Aber auch sonst hätten sie keine nichtösterreichischen Gebiete und Befugnisse beansprucht. Mazarin erstrebte noch keine geschlossene französische Herrschaft über das ganze linke Rheinufer, sondern nur den tatsächlich maßgebenden Einfluß in jenen Gegenden; hierzu genügten die habsburgischen Gebiete und Privilegien. Indes die kaiserlichen Politiker glaubten billiger wegzukommen, wenn sie andere elsässische Reichsstände zu Opfern heranzogen, und benutzten die Unklarheiten, welche mit dem allmählich entstandenen, schwankenden Gewohnheitsrecht verbunden waren und durch die allgemeine, besonders unter den Franzosen herrschende Unkenntnis der Sachlage vergrößert wurden. Trauttmannsdorff verleitete die Franzosen, die Bedeutung der habsburgischen Zugeständnisse zu überschätzen und nährte die irrigen Vorstellungen durch zweideutige Ausdrücke, welche später den Franzosen zu Ansprüchen außerhalb des Habsburgischen Gebietes gedient haben. Zunächst säten sie damit Mißtrauen. Als die Stadt Straßburg einen Fehler aufdeckte, glaubten die Franzosen, daß sie von den Österreichern vorgeschickt war, um Mazarins Gesandten nachgiebiger zu stimmen. Umgekehrt führte Trauttmannsdorff das Vorgehen auf partikularistischen Eigennutz und den Wunsch zurück, statt auch entgegenzukommen, die Franzosen durch Halsstarrigkeit zu höheren Ansprüchen an die Habsburger zu verlocken. Angesichts des allgemeinen Ruhebedürfnisses führten diese Auseinandersetzungen zuletzt nur zu neuen Vorbehalten und Un- [10] klarheiten. Der Wert der getroffenen Bestimmungen hing schließlich davon ab, ob die Franzosen sich mit Mazarins Standpunkt dauernd begnügen oder auf ihn neue Forderungen begründen würden. Ebenso langwierig waren die Verhandlungen über die schwedische "Satisfaktion". Gustav Adolf hatte über die Ostsee herrschen wollen, der Reichskanzler Oxenstjerna später auch an der Nordsee Stützpunkte gesucht. Wie gegen die französischen Ansprüche am Oberrhein war Deutschland gegen das schwedische Verlangen machtlos, nachdem der Prager Versuch, die Schweden höchstens mit Geld zu entschädigen, gescheitert war. Aber dasselbe Pommern, welches die Schweden verlangten, gebührte nach dem Aussterben der einheimischen Herzöge erbrechtlich dem Kurfürsten von Brandenburg, und letzterer brauchte die Odermündung und einen besseren Zugang zum Herzogtum Preußen. Zwischen beiden Anwärtern entstand ein langes Feilschen; schließlich waren die Schweden stärker. Die Hohenzollern konnten noch froh sein, wenigstens Hinterpommern und einen Ersatz für die schwedische Hälfte zu erhalten. Dem großen Kurfürsten ging der Verzicht auf die Odermündungen und die ersehnte brandenburgische Ostseemacht zu Herzen. Gerade durch den Verzicht wuchsen aber die Hohenzollern unbewußt in ihren künftigen deutschen Beruf hinein. Denn damit Brandenburg für Schwedisch-Pommern nicht etwa in Schlesien entschädigt wurde, bewilligten ihm die kaiserlichen Politiker die mitteldeutschen Stifter Halberstadt, Minden und die Anwartschaft auf Magdeburg. Obwohl die französischen und schwedischen Erwerbungen Reichsgebiet blieben, wurde durch solche Vorbehalte die Herstellung eines französischen Einfallstors nach Süddeutschland und die schwedische Fremdherrschaft über die Oder- und Wesermündungen bloß notdürftig verschleiert. Außerdem fanden partikularistische Sonderbestrebungen ehrgeiziger Reichsfürsten stärkeren Rückhalt. Ihre größere Selbständigkeit gewann erst dadurch vollen praktischen Wert. Denn die reichsrechtlichen Bestimmungen, durch welche der Westfälische Friede das deutsche Volk zersplittern half, bestätigten vielfach nur alte Gewohnheiten. Von ihrer neuen Befugnis, sich untereinander oder mit dem Auslande zu [11] verbünden, hatten die Landesherren längst Gebrauch gemacht. Ebenso hatten die drei Reichstagskurien schon früher nicht widerspruchslos geduldet, daß eine von den beiden anderen überstimmt wurde. Noch weniger hatten sich die evangelischen Reichsstände beliebigen Mehrheitsbeschlüssen gefügt. Endlich hatten seit mehr als hundert Jahren Sonderberatungen katholischer und evangelischer Reichsstände stattgefunden. Erst durch die damaligen politischen Voraussetzungen wurden die ganzen Vorschriften wichtig. Wenn jetzt Franzosen und Schweden jederzeit im Reiche Bundesgenossen finden und Deutschlands einmütige Verteidigung hindern konnten, war das eine bewußte Reaktion gegen den Versuch des Prager Friedens, die Glieder des Reichs zur festeren Kette zu schließen. Auch die Protestanten standen unter dem bewußten Eindrucke, daß sie sich während der letzten Jahrzehnte in bedeutsamen Lebensfragen verhängnisvollen Mehrheitsbeschlüssen knirschend gebeugt hatten und das nicht mehr tun wollten. Da war es nicht einerlei, ob Reichsfürsten, die ungestörter ihre Sonderbedürfnisse zu erfüllen strebten, auf gewohnheitsmäßig geübte, teilweise umstrittene Freiheiten angewiesen waren oder feierliche, schriftliche Zugeständnisse besaßen. Überdies ließ sich ein selbst alter und allgemein eingebürgerter Gebrauch leichter beseitigen wie ein international anerkanntes und zugesichertes Recht. Dazu bemächtigte sich die Wissenschaft bald der Friedensbestimmungen und prägte durch Universitätsunterricht, Lehrbücher und Einzeluntersuchungen den Fürsten und Behörden den Sinn ihrer Befugnisse ein.
|