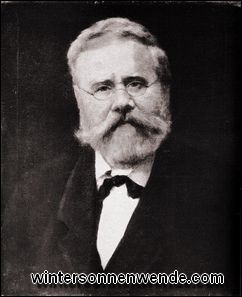|
[Bd. 5 S. 275]

Die weit verbreitete Vorstellung von dem jovialen Stammtisch-Reuter ist unwürdig des größten Dichters unserer mecklenburgischen Landschaft, eine kränkende Herabziehung des genialen Schilderers unseres Volkstums auf die Ebene des Kleinbürgers. Wir wollen ihn ohne diese Maske sehen. Der Mensch, der hinter ihr steckt und seine wirkliche Lebensleistung erscheinen nur um so größer und ehrwürdiger. Reuter wurde am 7. November 1810 in dem mecklenburgischen Landstädtchen Stavenhagen geboren, das damals 1200 Einwohner zählte. In seiner Skizze "Meine Vaterstadt Stavenhagen" erscheint die Kindheit, mit den Augen der Erinnerung gesehen, als eine Idylle. Aber das Leben dieses kleinen Ortes nach den furchtbaren Zeiten der französischen Invasion und der Befreiungskriege war alles andere als idyllisch. Es war ein unerbittlich harter Kampf um die nackte Existenz, um so schwerer, als zu Beginn der zwanziger Jahre die englische
Einer hat diesen Mann geliebt wie kein anderer und hat ihm doch den tiefsten Schmerz bereitet: das ist der Sohn. Und der Vater wiederum liebte den Knaben als den Erben seines Werkes. Welche unerbittliche Tragik offenbart der Briefwechsel zwischen den Beiden. Ein verzweifelter Kampf zweier Menschen, die sich lieb haben und doch nicht zueinander können. Mißtrauen, Verständnislosigkeit bei aller Langmut, Härte und schließlich ein stummes Sichabwenden auf seiten des Vaters; Ausweichen vor der Forderung des anderen, Verstellung, Unwahrhaftigkeit bis zu grausigem Zynismus auf seiten des Sohnes, für den doch [277] Johann Georg Reuter, dieser ernste, schmallippige Mann, fordernd wie richtend, Maßstab seines oft irren Lebens blieb. Das ist das tiefste Erlebnis des Dichters. Und seltsam, wie der reife Reuter seinem Vater nachartet! Von der Mutter stammen seine musischen Züge. Sie führt schon den Knaben in die Welt unserer Dichter ein. Vor allem aber dankt er ihr jenes lebendige Christentum, von dem wenig gesprochen wird, das man aber vorlebt. Der Kampf zwischen Vater und Sohn beginnt in dem Augenblick, wo der Knabe nach mancherlei Unterrichtsversuchen bei allerhand Dilettanten auf die höhere Schule kommt. Berücksichtigt man den verworrenen Bildungsgang, so hat Fritz eigentlich mehr geleistet, als der Vater billigerweise von ihm verlangen konnte. Schließlich bestand er doch, wenn auch dürftig, ein halbes Jahr früher, als erwartet, seine Abgangsprüfung. Auf der Schule schon, in Friedland und dann in Parchim, erkennt man eins: der Knabe drängt in die Welt künstlerischen Gestaltens. Maler will er werden; er schreibt den besten Aufsatz – vielleicht spukt in ihm schon die Idee des Dichters –; sonst möchte er Baumeister werden. Bei allem aber stößt er auf schroffe Ablehnung des Vaters. Und das ist nicht einfach Engstirnigkeit; hier spricht ein Tieferes, eine Grundeinstellung des ostelbischen Menschen überhaupt. Unser Land bringt Staatsmänner, Soldaten und Männer der Wirtschaft hervor. Diese Berufe – besser Stände – werden gewertet. Und wiederum ist es merkwürdig zu sehen, wie auch beim Dichter diese Züge hervortreten. Ut mine Stromtid, Reuters Hauptwerk, schildert ein wirtschaftliches Thema: den Kampf um Grund und Boden, um die Scholle. Als Reuter, der Dichter, berühmt wird, entwickelt sich bei ihm eine naive Freude am Geldverdienen. In seiner Vermögensverwaltung zeigt er sich als zählederner, nüchterner Geschäftsmann, der um sein Honorar handelt und feilscht wie ein Hansekaufmann. Damals aber als Schüler, und bald darauf als Student, beginnt jene Periode des Spielens mit dem Leben: von außen gesehen ein Hang zum Bummeln und frühzeitig – mindestens seit seinem Studium in Rostock – eine Neigung zum Trunk. Bei tieferer Schau erkennen wir, daß das Streben, das bei seinem Vater in den Erwerb und die Gestaltung des kleinen Gemeinwesens hineinschlägt, ihn in das Abenteuer drängt. Der Dämon in seiner Brust hetzt ihn, so viele Menschenschicksale in sich [278] aufzunehmen wie möglich, weil dann sein Ich, von dieser Lebensmelodie angerührt, zu tönen beginnt. Er spielt, weil er nicht imstande ist, das, was ihn erfüllt, zu gestalten. Es kann nicht anders sein: der Vater sieht in diesem Bummeln nur das Ausweichen vor der Pflicht, vor der Arbeit. Mißtrauisch setzt er dem Sohn Wächter und Aufpasser. Der leidet unter dem Argwohn. Ganz dumpf spürt er, daß er bei allem Fehl doch auch wohl recht hat, spürt aber zugleich, wie der Vater im Recht ist. Denn viel zu tief ist er ja dessen Sohn, als daß er – wie es die Romantiker damals so gerne taten – die Welt des Bürgers verachten kann. Er ahnt nicht, daß das Schicksal ihm sehr bald die furchtbare Wirklichkeit der großen Lebensmächte Staat und Geld in ihrer gnadenlosen Härte zeigen wird. Die Semester in Rostock waren verspielt und vertan. Davon mußte sich der Vater bei der Heimkehr des Sohnes überzeugen. Schulden, die er verschwiegen hatte und nun beichten mußte, führten zu heftigen Auftritten. Endlich willigte der Vater ein, daß Fritz studieren könne, wo er wolle, nur müsse er mit jährlich 300 Talern auskommen und in drei Jahren das Examen machen. – Wenn man sich die Langmut vor Augen führt, mit welcher der Vater hier und auch später immer wieder dem Sohne verzeiht und die Möglichkeit eines neuen Anfangens gibt, so ahnt man, daß dem leidenschaftlichen Manne doch wohl ein tieferes Wissen eignete um die dämonische Triebnatur seines Sohnes. Auch er erscheint nach der spärlichen Kunde, die wir von ihm haben, als ein Getriebener. Er hatte den Dämon in seiner Brust gebändigt, abgeleitet in die Arbeit. – Arbeit ist es, die er immer wieder dem Sohne empfiehlt. Über eins nur ist er sich nicht klar: daß für diesen gar kein Feld fruchtbarer Tätigkeit besteht. Seine, des Vaters, rastlose Tätigkeit trug ihren Sinn in sich: das Regiment der kleinen Stadt, die er langsam aus dem Elend emporhob, seine Tätigkeit in der Wirtschaft. Fritz aber wollte nicht Jurist werden; und dieser sein Wille war ebenso stark wie der äußere Zwang des Vaters, der ihn in diese Bahn drängte. So blieb das Studium für ihn nur ein verhaßtes Sichbeladen mit ödem, formalem Wissen. Und abseits lockte das Leben mit seinen bunten, gefährlichen Weiten. Die deutschen Hochschulen waren damals erfüllt von gärender Unruhe. Die große Idee der Einheit der Nation ließ die Herzen erglühen. Man war revolutionär, Republikaner aus Überzeugung, weil man nur auf diesem Wege das Reich schaffen zu können glaubte. Man verkannte die große Realität der Macht; man verkannte vor allem, daß die Frage der deutschen Einheit keine deutsche, sondern eine europäische sei. Erst der große Realist Bismarck war berufen, Traum und Sehnsucht jener Generation in schwerem Kampf mit den starken, politischen Gegebenheiten in die Wirklichkeit umzusetzen. Daß Reuter der schwärmerischen Sehnsucht seiner Zeit verfiel, wen will das wundern? Es waren die Besten unserer Jugend, die damals diesen Weg gingen. Aber der dereinstige Dichter war kein Politiker. Er hat wirklich – wie er später vor dem Richter aussagte – sich im [279] eigentlichen Sinne nicht politisch betätigt. Er schwamm mit in dem bewegten, freien Burschenleben, war beteiligt an einer Anzahl von im Grunde genommen harmlosen Studentenstreichen. Schon damals führte er den Namen "Bierreuter". Die Kollegs blieben ungehört, und schließlich kam er nur eben um eine Relegation herum. Wieder rief ihn der Vater nach Hause. Und noch einmal gestattet er ihm, diesmal auf die Universität Berlin überzusiedeln. Inzwischen aber hat die politische Lage sich jählings verändert. Der törichte Anschlag der Studenten auf die Frankfurter Stadtwache im April 1833, hatte den Staat gegen die Burschenschaft mobil gemacht. Die Immatrikulation wird ihm verweigert; die ersten Verhaftungen waren erfolgt. Um ihnen zu entgehen, war Reuter nach Leipzig geflüchtet. Von dort ruft ihn ein angstvoll dringendes Schreiben seines Vaters zurück. Und nun ist's, als ob der Dämon ihn seinem Schicksal entgegentriebe. Er wählt den Rückweg über Berlin, verweilt dort, trotzdem er um die Gefahr weiß, und wird am 31. Oktober 1833 verhaftet. Und damit gerät er in die furchtbare Maschinerie der staatlichen Macht. Sein Spiel mit dem Leben endet mit einem "Verspielt". Er wird zum Tode verurteilt, dann zu dreißigjähriger Festungshaft, die späterhin auf acht Jahre abgekürzt wird, begnadigt. Was er dort erlebt und erlitten hat, steht nicht in der Festungstid. Man muß es lesen in den Briefen an den Vater. Und man muß es verstehen, zwischen den Zeilen zu lesen. Denn selbst hier bleibt Tiefstes verschwiegen: daß er dem Trunk verfällt, die grausige Zerrissenheit zwischen dem Bewußtsein des Abgleitens, wildem Taumel und verzweifeltem Sichtreibenlassen. Als er nach zuletzt milder Haft in Dömitz in das väterliche Haus zurückkehrt, ist er ein Zerbrochener: krank, dem Trunke ergeben, belastet mit dem Bewußtsein, die sieben besten Jahre seines Lebens verschüttet zu haben. Der Versuch des Vaters, ihn noch einmal auf die Universität zu schicken, endet mit der Katastrophe von Heidelberg, von wo er den Sohn zwangsweise zurückholen lassen muß mit der Drohung, ihn in eine Anstalt zu bringen. Schon in Dömitz hat ihn der Vater zu einem Verzicht auf sein Erbe veranlaßt. Als dieser im Jahre 1845 am Krebs stirbt, erklärt er ihn in seinem Testament für einen Trinker und bestimmt, daß er von dem Pflichtteil von 4750 Talern nur die Zinsen beziehen und deren verlustig gehen soll im Falle einer Heirat. Der Vater hat den Schlußstrich gezogen unter das – wie er glaubt – verfehlte Leben seines geliebten Sohnes. Neun Jahre weilt Reuter von nun an auf dem Lande, zuerst bei seinem Onkel, dem Pastor in Jabel, wo er seelisch langsam gesundet in der friedevollen Atmosphäre eines evangelischen Pfarrhauses. Dann lernt er bei dem trefflichen Gutspächter Rust Landwirtschaft. Doch zu einer Pachtung fehlt ihm das Vermögen und auch die stetige, wirtschaftliche Haltung, die der Landmann nun einmal braucht. So hat es den Anschein, als ob er den Rest seines Lebens als einer jener schrulligen alten Onkel bei Verwandten und Freunden zuzubringen habe, wie sie damals auf so vielen mecklenburgischen Gütern zu finden waren: Lebenswracks, die man mit durchschleppte.
Hier muß einmal über das Wesen von "Fritz Reuters Trunksucht" gesprochen werden. Der Dichter war in dem damals trunkfreudigen Alt-Mecklenburg ein gewaltiger Zecher. Das waren andere auch und wurden trotzdem nicht aus der Bahn geworfen. Bei ihm kam aber ein Zweites hinzu: Von Zeit zu Zeit überfiel ihn der Trunk in der Form einer Süchtigkeit. Beides muß man auseinanderhalten. Diese letztere Erscheinung beginnt mit einer krankhaften Reizbarkeit und Verdüsterung seines gesamten Seelenlebens. Er trinkt nicht aus Freude am Trinken, sondern um sich zu betäuben, aus einem Gejagtwerden, ohne daß der Alkohol seine eigentliche Wirkung tut. Dieser letztere Zustand entwickelt sich oft aus dem gewöhnlichen Zechen, tritt aber vielfach auch nach Wochen und Monaten völliger Abstinenz ein. "Wenn in solchem Anfall endlich die Natur reagierte", – berichtet Fritz Peters – "so marterte furchtbare Todesangst den Gequälten; er war jedesmal des sicheren Glaubens zu sterben, und wer ihn sah, glaubte, er habe recht. Kam er dann zu sich, so war sein Gemüt verwüstet, sein Magen krank; er nahm nichts an als Sodawasser, gekochtes Backobst, etwas schleimige Nahrung. Plötzlich entwickelte sich dann aber die ganze Heilkraft seiner riesigen Natur. Mit ungeheurer Eßlust stellte er sich wieder her. Sein Geist lebte wunderbar auf; seine höchsten Gaben entfalteten sich." An immer wiederkehrenden, inneren Verstimmungen hat Reuter schon als Schüler gelitten. In Jena haben sie ihn zu ausschweifendem Zechen verführt. Der letztere, pathologische Zustand ist das Ergebnis seelischer und physischer Qualen während der Festungszeit. Schuld und Schicksal erscheinen hier untrennbar verschlungen. Jedenfalls hat der Dichter sein Tun stets als Schuld empfunden. Er ist auch seinen Dämon in der Ehe nicht losgeworden. Dieser wich von ihm erst nach jenem, von rastloser Tätigkeit erfüllten Jahrzehnt, in dem er seine Meisterwerke schuf, mit dem Erlöschen seiner Schöpferkraft: damit andeutend, daß er schicksalhaft, dunkel irgendwie mit dem Genius in Verbindung stand, daß er mehr war als ein Laster oder eine Krankheit. [281] In die Zeit seiner landwirtschaftlichen Lehrjahre gehen nun die ersten literarischen Entwürfe zurück, so eine hochdeutsche Vorstufe zur Stromtid, zur Festungstid, zur Reis' nah Belligen und zur Franzosentid neben kleineren Arbeiten. Daneben regt der Genius seine Schwingen in den Briefen, die aus dieser Zeit stammen. Sie sind in ihrer Durchgeformtheit, ihrer plastischen Anschauungskraft eigentlich schon halbe Kunstwerke, Vorstudien, in denen der künftige Poet zum erstenmal die Umwelt zu gestalten versucht. Was all diesen Fragmenten fehlt, ist die epische Gelassenheit. Das Ich des Dichters hat noch keinen Abstand gewonnen zu den Zuständen und Persönlichkeiten, die er schildert; der Humor geht noch auf Stelzen und entbehrt der schelmischen Trockenheit; er quillt nicht aus aus jener inneren Weltschau, die dem Niederdeutschen nun einmal eigentümlich ist. Überhaupt – als Grundlage einer Existenz kommt schriftstellerische Tätigkeit nicht in Betracht, wenn sie auch nebenher ins Auge gefaßt wird. Darum handelt es sich jetzt, wo der Dichter ein Heim schaffen will für die geliebte Frau. Er muß ganz von vorne anfangen. Der große Vergeuder muß lernen, wie schwer es ist, nur den Lebensunterhalt zu erwerben. Alle hochgespannten Pläne wirft er über Bord; nur der enge, geflickte Rock des Schulmeisters ist das, was ihm bleibt. In dem kleinen pommerschen Städtchen Treptow läßt er sich als Privatlehrer nieder. Im Jahre 1851 wurde Reuter getraut, und die beiden nächsten Jahre waren der Gründung und dem Ausbau einer Lebensstellung gewidmet. Sie war bescheiden und mußte in harter Arbeit verdient werden. Dann aber erfolgt jene [282] schicksalhafte Wendung im Leben, die wir bezeichnen können als die Begegnung Reuters mit der Sprache der Heimat. Gewiß ist er zu seinen Läuschen un Rimels angeregt worden durch Claus Groths Quickborn. Gewiß handelte es sich für ihn zunächst wirklich nur darum, sich eine Einnahme zu verschaffen, als er jenes Büchlein mit plattdeutschen Schnurren herausgab. Aber es war wie bei einem Rutengänger, der über eine verborgene Quellader hinschreitet. Vielleicht, daß er selber erschrickt über den jähen Ausschlag der Rute. Der Quell in der Tiefe ruft, ohne daß er ahnt, was ans Tageslicht treten wird. Der Erfolg des Büchleins war wunderbar. Schon nach sechs Wochen wurde eine Neuausgabe erforderlich. Rasch folgen Polterabendgedichte in hoch- und niederdeutscher Mundart und der erste tastende Versuch zu epischer Darstellung in De Reis' nah Belligen. Der Dichter hat das Feld seiner Arbeit gefunden, die ihn nach des Vaters Glauben erlösen würde. Und er begreift: seine Stunde ist gekommen; noch einmal bietet ihm das Schicksal eine letzte Chance. So wird er der fleißigste Schriftsteller, den es gibt. Vielleicht ahnt er, daß seine Zeit bemessen ist. Jahr für Jahr in unerschöpflicher Fülle, aber gleichzeitig in steigender Vollendung, türmt er Werk auf Werk: 1855/56 Meine Vaterstadt Stavenhagen neben den meist hochdeutschen Beiträgen in dem Unterhaltungsblatt für beide Mecklenburg und Pommern, das er kurze Zeit herausgibt, 1857 Kein Hüsung, die Tragödie eines mecklenburgischen Tagelöhners. Mit seinem Werk Ut de Franzosentid vom Jahre 1859 erreicht er zum erstenmal den Gipfel der Vollendung. In der reizenden Vogel- und Menschengeschichte Hanne Nüte un de lütte Pudel wird ein Stück altmecklenburgischen Handwerkertums geschildert. Dann zieht er mit der Festungstid eine Brandmauer vor der dunklen Tiefe, durch die sein Lebensweg lief, und gewinnt so die Kraft, in seinem großen Epos Ut mine Stromtid die Welt des mecklenburgischen Gutes aufzubauen. Mit Dörchläuchting kehrt er noch einmal zur geschichtlichen Dichtung zurück. Die sinkende Gestaltungskraft kündet sich an in einem Humor mit leise grotesken Zügen. Noch zwei Werke folgen: De Reis' nah Konstantinopel und De Urgeschicht von Meckelborg. Damit ist der Kreislauf seines Schaffens erfüllt. Der Dichter schweigt. Lieber will er aufhören, "als seinen Lesern Birnen vorsetzen, die teigig geworden sind". Entscheidend ist für Reuter die Hinwendung zum Niederdeutschen. Alle bisherigen dichterischen Ansätze waren mehr oder minder steckengeblieben. In dem Augenblick, wo er beginnt, plattdeutsch zu schreiben, ist es, als ob die Sprache ihn trägt. Er gewinnt jene große Gelassenheit des Erzählers von Gottes Gnaden. Erst der sinnliche Reichtum des Plattdeutschen, dem für das Abstrakte überhaupt weitgehendst der Ausdruck fehlt, gibt seiner Schilderung jene Plastik und Schärfe, hinter der das Ich des Erzählenden verschwindet, so daß es ist, als ob wir unmittelbar mit den Augen des Dichters selbst schauten. Daher die unendliche Lebendigkeit [283] dieser Dichtungen. Was hier geschildert wird, ist Blut von unserem Blut. Denn wer ist der Held in Reuters Dichtungen? Kein einzelner: das mecklenburgische Land und der mecklenburgische Mensch, unser Volk! Er schafft die Welt der heimatlichen Landschaft mit dem weiten Wolkenhimmel über ihr; er bevölkert sie mit seinen Gestalten; er läßt sie weinen und lachen und ihr Schicksal erfüllen. Aber es ist seine Welt, von ihm geschaffen. Hier gilt es, einem weit verbreiteten Irrtum entgegenzutreten. Man hat vielfach geglaubt, Reuter habe gewissermaßen vom Leben abgeschrieben, d. h. jene vielen Originale und Käuze, an denen Alt-Mecklenburg so reich ist, seien so, wie sie sind, in sein Werk hineinspaziert. Die fleißige Forschung hat scheinbar für jede Persönlichkeit, für jedes Motiv aus den Büchern des Dichters eine Entsprechung im Leben festgestellt. Nur eins hat man übersehen: nicht eine einzige Gestalt ist in Reuters Werk eingegangen, so wie sie ist. Des Dichters Phantasie ist gesättigt mit exakt aufgenommener Wirklichkeit, aber er schaltet souverän mit diesen Bildern. Er haucht ihnen erst ihr innerstes Leben ein, daß sie den Schein der Wirklichkeit von sich ausstrahlen. Und doch sind es Dichtungen! Es wirkt wie ungewollte Ironie, wenn es in den wissenschaftlichen Einleitungen immer heißt: Eigentlich war die Person so und so. – Als ob überhaupt Wirklichkeit und Dichtung auf einer Ebene lägen! Nein, etwas anderes ist es, was heimatliches Volkstum Reuters Dichtung gibt: Bei aller Fülle bunten und persönlichen Lebens seiner Personen, bei aller tiefen und echten Menschlichkeit, die ihnen eignet, scheint doch durch sie hindurch die Umrißlinie ihres Typus, die Gebundenheit an Stand und Gewerbe. Das ist die Art, wie der Landmensch schaut, der in jeder Gestalt die ewige Daseinsform gewachsenen Lebens hindurchschimmern sieht. Darum findet er sich in den Gestalten des Dichters wieder. Sie sind zeitlos und allgegenwärtig. So sprechen sie unmittelbar zum Herzen des Volkes. Bismarck hat das entscheidende Wort geprägt, wenn er Reuter schon im Jahre 1866 den "berufenen Volksdichter" nennt. Denn das ist ja das besondere an Reuters Werk: Alle verfallen sie seinem Zauber, der Gebildete wie der einfache Mann. So geschieht das Staunenswerte, daß der Plattdeutsche weit über die Grenzen des Niederdeutschen hinweg gelesen wird, aber eben plattdeutsch, nicht in Übersetzung, denn diese Dichtungen lassen sich nicht übersetzen. Es hat Zeiten gegeben, wo der Absatz von Reuters Dichtungen nach Mittel- und Süddeutschland, vor allem nach der Schweiz, größer war als nach dem niederdeutschen Sprachgebiet. Waggonweise sind seine Werke nach Amerika gegangen zu den Deutschen ins Ausland. Aber zu diesem beispiellosen Erfolg des Dichters trug wohl noch etwas bei: Die Zeit des alten, agrarischen Deutschland ging ihrem Ende entgegen; die Stadt und die Maschine begannen in steigendem Maße das Leben zu beherrschen. So entstand etwas wie Heimweh nach dem Lande und nach dem landgebundenen Menschen. Im Werk des Dichters erscheint noch einmal das alte Deutschland, mit dem es nunmehr zu Ende geht.
Und weil er um beides weiß, ist er fähig zu jener großen Gelassenheit des niederdeutschen Humors, jener Haltung, in der auch das Schwerste und Bitterste plötzlich leicht und schwebend wird und sich in einem Lächeln löst. Es ist ja nicht wahr, daß der Humor an sich ein eigentümlicher Ausdruck des Niederdeutschen ist. Bei Storm findet er sich nicht, bei Hebbel kaum. Humor – wohl zu scheiden von der bloßen Komik, die noch vorwiegend in Reuters Erstlingswerken, vor allem in den Läuschen un Rimels waltet – ist weltanschaulich bedingt. Er beruht auf der Fähigkeit, das Heroische und Tragisch-Pathetische in seiner Fragwürdigkeit zu sehen, in seiner Winzigkeit gegenüber dem Ewigen; aber andererseits das, was wir belachen oder für belanglos erachten, doch verbunden zu wissen mit all dem Schmerzlichen und Mühebeladenen, das nun einmal in jedem Menschentun und Werk steckt. Erst das Wissen um beides läßt jenes Lächeln aufkommen, in dem sich das Mitgefühl des Herzens an beiden Strebungen befreit: Niederdeutscher Humor hat etwas zu tun mit tapferer Gelassenheit. [285] Der Gehalt ist es, der dieses Dichters Werk unsterblich gemacht hat, sein Herzschlag – nicht ästhetische Vollendung. Mit leisem Lächeln liest der Leser in den Einleitungen die Beanstandungen der Literarhistoriker. Wirklich vollendet ist vielleicht nur die Franzosentid. Vielleicht aber ist es so, daß das Volk nicht falsche, sondern andere Maßstäbe an die Dichtung legt. Die Geschichte der deutschen Dichtung vom Leser aus ist ja noch immer nicht geschrieben. Welche Dichter werden denn eigentlich von unserem Volk gelesen, immer und immer wieder gelesen? Wir wissen es nicht, auch nicht, warum es dieser oder jener ist. Eins aber wissen wir: daß in der Wertschätzung des deutschen Volkes Fritz Reuter mit obenan steht.
Das schöne Haus am Hang des Wartburgberges steht vollendet. Im Garten, den der ehemalige "Strom" sich mit großer Liebe eingerichtet hat, wachsen die Sträucher und Blumen, die er sich aus der Heimat kommen ließ. Für ihn selber aber gilt es, Abschied zu nehmen. Ein Herzleiden, das seit 1871 in steigender Heftigkeit auftrat, raffte ihn am 12. Juli 1874 dahin. Ein unendlicher Trauerzug zeigte die Teilnahme der Nation am Heimgang ihres Dichters. Die Grabschrift, die er in schlummerloser Nacht sich dichtete, steht nicht auf seinem Grabe, aber über seinem Leben:
Der Anfang, das Ende, o Herr, sie sind Dein.
 |