 |
[Bd. 5 S. 9]
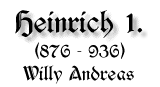
Mit ihm begann ein langsamer, aber stetiger Aufstieg deutscher Macht, und der Staat gewann Festigkeit im Innern. Siebzehn Jahre bloß hat Heinrich seines Königsamtes gewaltet. Was er aber in dieser kurzen Zeitspanne getan, hat ihn zum Neubegründer, zum Mehrer des Reiches gemacht, und auf dem tragfähigen Grunde dieses Reiches sollte sich fortan das deutsche Volk entwickeln. Nur eine Rückschau auf die Wirrsal, der Konrad der Erste, sein Vorgänger, nicht zu steuern vermocht hatte, kann Heinrichs Leistungen ins richtige Licht setzen. Es schien, als lasse sich der Niedergang, der bald nach dem Tode Karls des Großen schon anhebt, nicht aufhalten. Auch diese Entwicklung bedarf eines Streifblicks, will man begreifen, welch glückliche Wendung König Heinrichs Regierung herbeigeführt hat. Karls Imperium, das sich auch über Frankreich bis nach Spanien hinein und über den größeren Teil von Italien erstreckt hatte, war im Vertrag von Verdun (843) unter seine drei Enkel geteilt worden. Das eine dieser Teilreiche, das ostfränkische, zu dem ein Menschenalter später auch Lotharingien hinzukam, umspannte die Stammesgebiete der Sachsen, Thüringer, der Franken, Schwaben und Bayern. Trotzdem die Absonderung dieses eigenen Gebildes für das Entstehen eines deutschen Reiches grundlegend wichtig werden sollte, hatte man damit keineswegs an eine völlige Auflösung des karolingischen Imperiums gedacht; noch galt dieses ostfränkische Reich, obwohl die Volksentwicklung hier wie drüben im Westen seit langem ihre eigenen Wege ging, als Bestandteil des größeren Ganzen; seine Könige waren verpflichtet, mit den anderen Herrschern, die untereinander erbberechtigt waren, zusammenzuarbeiten; einer vollen Selbständigkeit und Hoheit [10] erfreute es sich nicht. Als die ostfränkische Linie des Karolingerhauses mit Ludwig dem Kinde ausstarb, hätte jetzt der westfränkische Zweig in Deutschland zur Regierung gelangen müssen. Daß jedoch der Frankenherzog Konrad zum König gewählt wurde, stieß die überkommene Anschauung um und bedeutete die endgültige Zerreißung des karolingischen Universalreiches. Es wurde damit die Selbständigkeit des ostfränkischen Teiles begründet. Nicht, als ob sich damit bereits der Gedanke eines deutschen Nationalstaates durchgesetzt hätte! Diese frühmittelalterlichen Jahrhunderte lassen sich ja überhaupt nicht mit neuzeitlichen Maßstäben messen. Ein Volksbewußtsein im vollen Sinn kannte das zehnte Jahrhundert schon deshalb nicht, weil das Leben der Stämme noch in viel zu eigenwilligen Bahnen sich bewegte, und sie einander von Haus aus recht fern standen. Wie sollte auch der Sachse den Alemannen oder Bayern verstehen: eine ganze Welt lag zwischen ihnen! Konrad selbst, aus der Reihe der Herzöge emporgestiegen zur obersten Würde, war nur von einem Teil der ostfränkischen Stämme zum König gewählt worden. Die Bayern und Schwaben erkannten ihn erst nachträglich an, gerieten aber bald in erbitterten Streit mit ihm. Die Lothringer hingegen hielten zum westfränkischen Herrscherhause, folgten also der karolingischen Reichsüberlieferung und dem Gebot der Legitimität. Die Erfahrungen, die Konrad in seinem neubegründeten Regnum Francorum machte, waren traurig und zermürbend. Sieben Jahre des Unfriedens und der Kräftezersplitterung. Äußere und innere Feinde machten dem König das Leben sauer! Dänen und Wenden tummelten sich auf deutschem Boden, und in verheerenden Zügen rasten die Ungarn durchs Reich. Wilde Kämpfe zwischen weltlichem und geistlichem Adel! Die Krone in verzehrendem Ringen gegen die bodenständigen, aber ungebärdigen Sondergewalten der Stammesherzogtümer. In ihnen sammelte sich, während der Reichsgedanke zerfiel und die Führerkraft des Königstums erlahmte, fast ausschließlich das Gemeinschaftsgefühl und das Bedürfnis nach Zusammenschluß, soweit es im Volke lebendig war; sie wollten sich ihre Selbständigkeit nicht rauben lassen. Um nicht selber zu versinken, klammerte sich der König wie die Spätlinge des karolingischen Hauses an die kirchliche Hierarchie, deren Herrschsucht daraus Vorteil zog. Ihr festgefügter Verband bot schier allein noch der wankenden Reichseinheit einen gewissen Halt. Aber auch sie schien das Schicksal des geschwächten Königtums teilen zu müssen und sah sich von dem Machthunger der Herzöge aufs schwerste bedroht. Besonders schlimm, daß auch die Sachsen sich dem übrigen Deutschland wieder entfremdeten. Kein Stamm hat sich so stark wie sie dem Bannkreis der Königsgewalt entzogen. Verglichen mit den anderen Stämmen waren sie ganz etwas für sich. Jene, ob Franken, Bayern oder Schwaben, hausten auf einem Boden, der einst vom [11] Römertum und seiner Kultur unmittelbar und tief beeinflußt worden war. Sachsen war davon vollkommen unberührt geblieben, und ebenso hatte es sich dem Christentum gegenüber später als sie und nur unter grimmigster Gegenwehr erschlossen. Ihre Unterwerfung durch Karl, den mächtigen Frankenherrscher, war mit Strömen von Blut erkauft worden. Der Geist des großen Widukind, der einem Weltenkaiser die Stirn geboten, lebte nach der Eingliederung ins Frankenreich auch im Heldenlied und der Erinnerung seines Volkes weiter, während die Kirche Sorge trug, sein Andenken in ihrem Sinne umzudeuten. Heidnischer Trotz und stämmische Eigenwilligkeit blieben nun einmal, auch nachdem das Christentum die Seelen dieser germanischen Menschen umzuformen begann, den Sachsen angeboren. Sie liebten es, ihre besonderen Wege zu gehen. Stark beansprucht durch Grenzlandkämpfe mit den Slawen und Dänen, standen sie den Vorgängen im Reich nur lau oder unbeteiligt gegenüber. Die Nachfahren Karls des Großen kamen ziemlich selten in diese Lande, während sie im mittleren und südlichen Deutschland sich häufiger sehen ließen. Der Niedergang des karolingischen Hauses und Reichs, sein Versagen im Innern und nach außen, lockerte den Zusammenhalt noch mehr: die Notwendigkeit der Selbsthilfe steigerte das natürliche Selbstgefühl der Sachsen. Träger der Stammesgeschichte waren Heinrichs Ahnen, das mächtige, einflußreiche Geschlecht der Liudolfinger. Begütert war die Familie in Westfalen, in Engern und Ostfalen. An den Hängen und in den Tälern des Harz legte sie zahlreiche Wirtschaftshöfe an und trug so zur Besiedlung des schwachbevölkerten, unwirtlichen Gebirges bei. Der Großvater Liudolf hatte im östlichen Teile Sachsens herzogliche Gewalt ausgeübt; die Großmutter Oda, eine Edle fränkischen Geschlechts, hatte noch Kaiser Karl erlebt. Brun, der Oheim, war an der Spitze seiner Mannen im Kampfe gegen die Normannen auf der Walstatt geblieben (880). Otto, der Vater, hatte als Herzog über ganz Sachsen geschaltet, aber auch in Thüringen Macht gehabt, der Schlüsselstellung für eine wirksame Ostpolitik. Bis nach Lothringen hatte sich sein Einfluß und Besitz erstreckt. Die Mutter hieß Haduwich, vielleicht war sie eine Verwandte des königlichen Hauses. Über ihre Herkunft und Persönlichkeit gibt keine Überlieferung nähere Kunde. Otto war lange im Kampfe gegen die Daleminzier gestanden, jenen Sorbenstamm, der um Lommatzsch und Meißen herum hauste; indem er seinem Sohn Heinrich ein Heer gegen sie anvertraute, trat der Erbe schon in jungen Jahren in den Bereich von Grenzmarkauseinandersetzungen, die später einen Teil seiner Lebensaufgabe bilden sollten. Wohlgerüstet nach den verschiedensten Seiten hin, hatte Otto den inneren Parteiungen im Reich gegenüber Zurückhaltung geübt. Dem Sohne sollte dieses Aufsparen der Stammeskraft, wie sich bald zeigte, zugute kommen. In dieser geschlossenen, kernigen Welt seiner sächsischen Heimat war Heinrich aufgewachsen. Nach dem Tode des Vaters (912) wurde er, sechsunddreißigjährig, von den Großen zum Herzog erhoben. Als solcher stieß er bald mit König Konrad [12] zusammen, der auch dieses Herzogtum niederzuhalten suchte. Ein Unterfangen, das ihm ebensowenig glückte wie seine Kämpfe gegen die Schwaben und Bayern. So verschieden die Persönlichkeiten dieser drei Stammesherzöge unter sich waren, der Gegensatz entsprang der gleichen Wurzel, und die Regierungsproblematik von Konrads Herrschertum trat in Niedersachsen genau so zutage wie auf oberdeutschem Boden. Tat sich der König hier im Süden mit Bischof Salomon von Konstanz zusammen, um dem schwäbischen Herzogtum beizukommen, so verband er sich, um Sachsens Herr zu werden, mit Erzbischof Hatto von Mainz, dem Haupt der deutschen Reichskirche, der sich auch starken persönlichen Einfluß auf ihn sicherte. Da sich die Besitzungen von Mainz tief nach Thüringen hinein erstreckten, Heinrich aber dort die markgräfliche Gewalt und die Grenzwacht gegen die Ungarn ausübte, ging der Erzbischof mit König Konrad zusammen. Heinrich blieb in der Oberhand: Eberhard, Konrads Bruder, erlitt vor der Eresburg eine Niederlage. Konrad selbst wurde vor Grone in der Nähe von Göttingen zum Abzug gezwungen (915). Immer wieder zeigte es sich in diesen Jahren, daß er seinem dornenvollen Amte nicht gewachsen war. Die Machtgrundlage seines fränkischen Herzogtums erwies sich, zumal es durch inneren Streit geschwächt war, als zu schmal, die Aufgabe zu meistern. Man kann es bezweifeln, ob selbst die vereinte Kraft des Herzogtums Sachsen und Thüringens, über die sein Nachfolger gebot, stark genug hierzu gewesen wäre, hätte nicht der neue König die Begabung des echten Herrschers mitgebracht. Dieser Nachfolger war Herzog Heinrich, Konrads sächsischer Gegner!
Das vertraute Bild, in dem die Liebe des Volkes seinen Herrscher heiter verklärt hat, findet in der geschichtlichen Überlieferung keine Stütze. Doch klingt darin wohl die Überraschung der Zeitgenossen nach, daß die Krone des Reichs, das wie von altersher noch das fränkische geheißen wurde, plötzlich von dem führenden Stamm auf einen Sachsen übergegangen war. Ein Umschwung, der offenbar tief empfunden wurde. Aufgekommen ist die Sage erst zweihundert Jahre später. In Wahrheit spielten sich die Dinge anders ab. Wohl hatte, wie der Geschichtsschreiber Widukind berichtet, der sterbende Konrad in der Erkenntnis, daß die Zeit der fränkischen Macht dahin sei, seinem Bruder Eberhard das Versprechen abgenommen, die Wahrzeichen des Königtums dem Gebieter der Sachsen zu überbringen. Es war die segensreichste Tat des unglücklichen Königs! Die Selbstüberwindung, die in dieser Überordnung des Reichsgedankens über das Stammesgefühl lag, zeigt einen großen Zug und hat in unserer mittelalterlichen Geschichte kaum ihresgleichen. Selbst [13] wenn man die Überlegung anstellt, daß das konradinische Haus vielleicht gut tat, lieber auf den zweiten Platz zurückzuweichen, als durch den Stärkeren ganz ausgelöscht zu werden, behält der Vorgang Einzigartigkeit und hohe Würde. Eberhard, dem die Einwilligung schwer ward, hielt Wort. Er legte die Reichskleinodien, Krone, Schwert und Gürtel, den Mantel und die Armspangen selber in die Hand des Nebenbuhlers. Anscheinend bekam diese Übertragung dadurch, daß Eberhard auch den Reichshort übergab, erhöhten Nachdruck. Es mußte aber ein Akt von noch allgemeinerem Gewicht hinzutreten, dem letzten Willen des toten Königs volle Wirkung zu verleihen: es ist ein Hergang, den man nicht als Wahl Heinrichs, sondern eher als seine Erhebung oder Ausrufung zum König bezeichnen sollte. An der Grenze ihrer Stammesgebiete, zu Fritzlar, an der uralten Thingstätte der Hessen, trafen sich Sachsen und Franken, die einen geführt von Heinrich, die andern von Eberhard. Auch Erzbischof Heriger von Mainz war mit etlichen Bischöfen erschienen. Es war im Mai des Jahres 919. Eberhard schritt in den Ring und erklärte vor allem Volk Heinrich als den König der Franken. Einstimmiger Zuruf begrüßte nach altgermanischer Sitte den Auserkorenen, und am lautesten erklangen die Stimmen der Sachsen, als ihrem Herzog diese Ehre widerfuhr.
Die Persönlichkeit Heinrichs wirkt auf uns nicht durch herrscherlichen Glanz und menschliche Fülle, sondern durch ihre Echtheit, ihren Geradsinn, ihre Einfachheit. Ein Mann von gehaltenem Ernst, zur rechten Zeit auch einmal fröhlich, aber von einer Zurückhaltung in der Art sich zu geben, die man als niederdeutsch empfindet! Die lebhafteren Herren aus dem Süden des Reiches mögen manchmal das Gefühl gehabt haben, von ihm durchschaut zu werden, ohne daß er ein Wort darüber verlor. [14] Ausdrücklich betont Widukind von Corvey, der westfälische Mönch, dessen Chronik den Stolz auf sein Sachsentum atmet, Heinrich sei darauf bedacht gewesen, seinen Stamm zu erheben, und so habe er viele in Sachsen durch Schenkungen, durch Verleihung eines Amtes oder Vertrauen gefördert. Wenn ihm die Überlieferung nachsagt, er habe eine offene Hand für die Seinen gehabt, Hausgesinde und Gefolgschaft seien ihm unbedingt ergeben gewesen, so deuten auch diese Züge auf patriarchalische Haltung und breiten niedersächsischen Lebenszuschnitt hin. Beim Mahle gesellig, vergab er doch nie etwas der königlichen Würde. Keiner seiner Krieger, fügt Widukind hinzu, habe sich Heinrich gegenüber eine Unschicklichkeit zuschulden kommen lassen, auch wenn er scherzte: solche Zuneigung und Ehrfurcht zugleich erweckte er in ihren Gemütern. Im Kampfspiel überwand er alle, so daß er beinahe Furcht einflößte. Seine Überlegenheit im Reiter- und Schwertgefecht verführte ihn jedoch nicht dazu, damit zu prunken oder sich ruhmredig zu gebärden. Die Liebe zur Jagd paßte zu seiner mannhaft schlichten Art. Offenbar fand er in der freien, einsamen Natur auch etwas von der inneren Sammlung, die sein ganzes Wirken auszeichnet. Von Heinrichs Familienleben wissen wir wenig. Ein erstes Mal war er vermählt gewesen mit Hatheburg, der Tochter des Grafen Erwin von Merseburg. Sie war, als Heinrich sie heiratete, bereits Witwe und hatte den Nonnenschleier genommen. Infolgedessen erhob die Kirche, vor allem der Bischof von Halberstadt, Einspruch. Schließlich ließ Heinrich, nachdem Hatheburg ihm bereits einen Sohn namens Thankmar geboren hatte, von ihr ab und vollzog die Trennung. Ihr stattliches Erbe allerdings behielt er ein. Hatte er durch diese Verbindung die Besitzungen seines Hauses an der Saale gen Thüringen zu gemehrt, so faßte er durch seine zweite Vermählung mit Mathilde, einer Urenkelin des alten Sachsenführers Widukind, die einem der edelsten Geschlechter Westfalens entstammte, dort noch festeren Fuß als seine Vorfahren. Auch die Ehe war schon vor der Thronerhebung geschlossen worden. Fünf Kinder hat Mathilde, die wesentlich jünger war als Heinrich, ihm geschenkt, drei Söhne und zwei Töchter. Sie selbst war von hoher, stolzer Sinnesart, hatte Freude an höfischem Prunk und königlicher Machtentfaltung. Eine Frau von tiefer Frömmigkeit, genoß sie als Wohltäterin der Kirche und der Armen viel Verehrung. Des Königs äußere Erscheinung entsprach der herrscherhaften Überlegenheit seines Wesens. Breitschultrig und hochgewachsen, so wird er uns auf der Höhe seiner Regierung geschildert, alle anderen überragend, mit klaren blauen Augen und kurz gehaltenem blondem Bart. Fern jeder Phantastik, ohne den leisesten Anflug zum Abenteuerlichen, aller Schwärmerei abhold, ein nüchterner Mensch, der auch der Kirche gegenüber wohlbedachten Abstand wahrte, stand Heinrich fest auf dieser Erde. Die Lieder, in denen die Sachsen ihre Helden besangen, feiern auch die Taten ihres Herzogs Heinrich. Widukind, dem wir so viel überzeugende Einzelheiten über sein Leben verdanken, [15] hat aus diesen Liedern seines Stammes geschöpft, um Lücken der verbürgten Überlieferung auszufüllen. Es spricht für Heinrich, daß sein früherer Feind Eberhard, der dem König freilich eine Mehrung seiner Macht in Franken und Schwaben zu danken hatte, ihm zeitlebens ergeben blieb. Wenn Heinrich unter den starken Stammeshäuptern sich als König behaupten konnte, ja so eigenwillige Männer wie Hermann von Schwaben und Arnulf von Bayern zu Freunden gewann, so ist das ein Beweis für die innere Stärke seines Führertums, für seine staatsmännische Befähigung, aber auch für seine hohen menschlichen Eigenschaften. Insbesondere wurde ihm die Tugend der Gerechtigkeit auch von solchen Zeitgenossen nachgerühmt, die Heinrich weder stammesmäßig noch menschlich nahe standen. Niemand soll er Unrecht zugefügt, keinen gekränkt haben; obwohl für seine Person ganz im sächsischen Boden verwurzelt und hier auch innerlich zu Haus, setzte er doch keinen deutschen Stamm gegen den anderen zurück. So ist es für Leistung und Inhalt dieser Regierung kennzeichnend, daß weder die neuere noch die ältere Geschichtsschreibung ihr einen Makel vorzuwerfen hat. Wohl lassen sich die Grenzen von Heinrichs Wirksamkeit aufzeigen; aber er sah sich auch vor besonders schwere Aufgaben gestellt. Darum mußte er sich mitunter mit Teillösungen begnügen, und manches konnte er nicht mit einem beherzten Griff anpacken, sondern nur allmählich, Stück um Stück verwirklichen. Dann aber geschah es sehr beharrlich. Auch diese bedachtsame Zähigkeit ist niedersächsischen Gepräges. Wenn Heinrichs Sohn Otto, dem die Geschichte den Beinamen des Großen beigelegt hat, über den Vater hinauswuchs durch die Weite des Gesichtsfeldes, die Hochgespanntheit des Wollens und den Schwung der Gesamtpersönlichkeit, so stand er doch in der sicheren Einschätzung des Erreichbaren hinter ihm zurück. Denn Heinrich war ein Meister politischer Taktik, die vor jedem Schritt die Festigkeit des Bodens prüfte und doch nicht in Bedenklichkeiten hängen blieb. Eine glückliche Verbindung von Kraft und Klugheit, von Willensstärke und Maß, von Wucht und Milde macht sein Walten aus. Man versteht es, daß das Herrschertum eines solchen Mannes, der als Hüter von Friede und Recht empfunden wurde, in der Lohengrinsage fortlebt, die König Heinrich im fernen Brabant als Schirmherrn und Retter der Bedrängten auftreten läßt. Während Heinrichs Vorgänger im Bunde mit der Kirche gegen die Herzöge regiert hatte, suchte er, indem er das Steuer entschlossen herumwarf, im Einvernehmen mit jenen widerspenstigen weltlichen Gewalten Deutschland zu lenken. Es gelang ihm, wenn auch nicht ohne Schwierigkeiten und Zugeständnisse. Denn Bayerns Herzog Arnulf hatte sich anfangs sogar zum Gegenkönig erheben lassen. Nur indem Heinrich sich mit einer losen Oberherrschaft über ihn begnügte, die Arnulf volle Kirchenfreiheit, die Einsetzung der Bischöfe und [16] Äbte seines Landes sowie das alleinige Münzrecht überließ, bewog er ihn dazu, sein Königtum anzuerkennen. Wie die Bayern, so hatten auch die Schwaben der Versammlung in Fritzlar nicht beigewohnt. Auch sie mußten durch klug entgegenkommende Diplomatie gewonnen werden. Nur dadurch vermochte Heinrich Widerstände zu bannen; daß ein Sachse nun einmal die Königskrone trug und mit über Süddeutschland gebieten sollte, war allen Überlieferungen und ihrem Sinn zuwider. Herzog Burkhard, der zweite dieses Namens, ließ sich die Anerkennung Heinrichs mit weitreichender Einflußnahme auf die schwäbischen Kirchen bezahlen, mit denen der unbändige, beutehungrige Krieger rauh umsprang. Eine vollkommen andere Stellung gegenüber dem Stammesherzogtum, als sie sein Vorgänger eingenommen hatte, drückte sich in Heinrichs Haltung aus. Jener hatte die urwüchsigen und lebensfähigen Gewalten niederhalten wollen, aber in fruchtlosem Ringen seine Kräfte verbraucht. Der Herrscher sächsischen Geblüts jedoch leistete sich nicht die Vermessenheit, aus dem bisherigen fränkischen Reich ein sächsisches machen zu wollen. Dazu hätten seine Machtmittel schwerlich ausgereicht, und schließlich boten ja auch diese geschichtlich gewordenen Kräfte Möglichkeiten des Reichsaufbaus: bluthaft stark und bodenverbunden wie sie waren, bedurften sie mehr der Einordnung und der Bändigung, nicht der Unterdrückung oder voller Einebnung. Heinrich achtete in jeder Hinsicht, verfassungsmäßig wie politisch die Befugnisse und Gefühle der Franken. Er richtete nach fränkischem Recht. Auf ihrem Stammesboden fanden auch in Zukunft die wichtigsten Reichsversammlungen und die Königswahlen statt. Seine Kanzlei betonte oft die fränkische Tradition. In der Beschränkung zeigte er den Meister! Doch nahm Heinrich, wenn eine günstige Gelegenheit sich bot, sie wahr, um die königliche Macht auch im Bereich des Stammesherzogtums vorzuschieben. Schwaben gegenüber gelang ihm das, indem er nach dem Tode Burkhards das verwaiste Land einem Angehörigen des konradinischen Hauses anvertraute, der ihm treu ergeben war. Während bisher die Herzöge von den Stämmen kraft eigenen Rechts, oft gegen den Willen des Königs, zu ihrer Würde erhoben wurden, zog nun der stammesfremde Hermann, ein Vetter Eberhards von Franken, als Vertrauensmann des Königs dort ein. Die Zeiten, in denen der Schwabenherzog selbständig in die burgundischen Verhältnisse und die italienischen Wirren eingriff und etwas wie eine eigene auswärtige Politik hatte wagen können, waren vorüber. Schwabens Verhältnis zur obersten Reichsgewalt hat sich seitdem grundlegend geändert. Auch hier gebot nun der Wille des Königs, und er wußte sich fortan auch der schwäbischen Kirche gegenüber unmittelbar zur Geltung zu bringen. Was Heinrichs allgemeine Haltung zur Kirche anlangt, so hat er sie gern gefördert, hat ihr Schenkungen und Gnade erwiesen; aber er blieb ihr Herr. Welche Wandlung auch da gegenüber dem Vorgänger! Die Vertreter des früheren [17] Systems starben allmählich aus. Auf die erledigten Stühle seines Machtbereichs brachte der König seine Anhänger. Nicht Roms Wille galt in Deutschland, sondern der seine. Allerdings hätte den Päpsten, bei der Versumpfung und Günstlingswirtschaft, die an ihrem Hofe herrschte, auch die Kraft gefehlt, sich zur Geltung zu bringen! Einen vollen Erfolg erntete Heinrichs Politik schon in den ersten Jahren der Regierung im Westen. Hier erreichte er, indem er die Schwierigkeiten ausnutzte, mit denen sich der französische König im eigenen Lande herumzuschlagen hatte, die vertragliche Anerkennung des neuen deutschen Königtums (921). Die karolingische Dynastie entsagte damit endgültig dem Anspruch auf Deutschland. Karl der Einfältige, dem zu Unrecht dieser Beiname zuteil geworden ist, hielt freilich noch an Lothringen fest, auf dessen Boden ein wesentlicher Teil der innerfranzösischen Machtkämpfe sich abspielte. Eben diese Wirren Frankreichs und die Zwistigkeiten der lothringischen Großen untereinander erleichterten es bald darauf, Lothringen, das seit dem Tode Ludwigs des Kindes verloren gegangen war, in zwei Feldzügen wiederzugewinnen (925). Es geschah ohne starken kriegerischen Einsatz und so, daß Heinrich nicht auf die Hilfe der süddeutschen Herzöge zurückzugreifen brauchte. Den unruhigen, rauflustigen Herzog Giselbert beließ er in seiner Würde, und später gab er ihm seine Tochter Gerberga zur Frau. Großherzig zu sein und ihm einen ähnlichen Spielraum zu gönnen wie dem Schwaben und Bayern, erwies sich in diesem Falle auch als klug. Denn durch Lothringens Erwerbung vergrößerte sich das Reichsgebiet um etwa ein Drittel, und es befanden sich darunter so bedeutende Städte wie Utrecht, Kambryk, Toul und Verdun – Namen, die einen schicksalsvollen Klang für Deutschland gewinnen sollten. Das Reich aber erhielt dank dieser Tat die Westgrenze, die es im wesentlichen das ganze Mittelalter hindurch behauptet hat. Was König Heinrich mit der Eingliederung Lothringens vollbrachte, ist eine der größten Errungenschaften unserer Geschichte, hinleuchtend über tausend Jahre deutschen Lebens: denn erst der Besitz dieser wichtigen Kernlande des alten Reichs machte den Rheinstrom zur Herzader unseres Vaterlandes.
Denn Heinrich nutzte den Zeitgewinn, auf den es zunächst einmal ankam, um Atem zu schöpfen und Kräfte zu sammeln. Das Reich dauernd ungeschützt zu lassen oder gar preiszugeben, war er nicht im geringsten gewillt. Er wartete nur die richtige Stunde ab und sorgte innerhalb jener Frist dafür, daß die Wehrordnung sich planmäßig kräftigte. Burgen wurden angelegt, vorhandene Wohnplätze ummauert, verfallene ältere Anlagen neu instand gesetzt. Kleinere und größere Orte, aber auch Klöster und Stifter erhielten Befestigungen. Das alte Volksaufgebot wurde erneuert, die Reiterei vermehrt und besser geschult; zur Bekämpfung der Ungarn und ihrer beweglichen, wendigen Taktik war ja gerade sie unentbehrlich. Mit besonderer Tatkraft wurden diese Maßnahmen in Sachsen durchgeführt; es empfing eine umfassende Wehrorganisation, und ebenso nahm sich Heinrich Thüringens in dieser Weise an. Möglicherweise haben dabei als Vorbilder die angelsächsischen Ringwälle, die Boroughs, gewirkt, wie es ja auch sonst an Beziehungen zwischen diesen nah verwandten Stämmen nicht fehlte. In den sogenannten Burgwarden entstanden militärische Bezirke, die sich um einen befestigten Ort, um eine Wall- und Fluchtburg herum bildeten. Sie waren mit Vorräten ausgerüstet und erhielten wohl wechselnde Besatzung. Im Frieden schwächer, wurden sie im Ernstfall verstärkt; durch kluge Verteilung der Pflichten unter die Insassen der Burg wurde gleichzeitig für die Bestellung der Felder gesorgt. Es heißt bei Widukind, immer der neunte Mann dieser stets sattelbereiten ländlichen Krieger sei für den Burgdienst abgeordnet worden, die anderen acht ackerten auch für ihn. Landbau und Streitkraft, Bodenliebe und Reichsverteidigung, Nähr- und Wehrstand waren miteinander in Verbindung gebracht. Die königlichen Dienstmannen wurden zur Verteidigung dieser
Noch bevor er zum Entscheidungskampfe gegen die Ungarn vorging, nahm Heinrich die alte sächsiche Grenzpolitik in großem Maßstabe auf, ein Beginnen, das für die Zukunft hohe Bedeutung haben sollte. Während der Jahre des Stillstandes nämlich bekriegte er mit seinem neugeübten Reiterheer die benachbarten Slaven oder Wenden zwischen Elbe, Saale und Oder. Wie so oft in unserer Geschichte, so auch unter Heinrich fiel dem Ostland für Deutschlands Schicksal eine entscheidende Rolle zu: Wieder einmal maß sich das Germanentum mit dem Slawentum im Kampf, artverwandte, aus gemeinsamer Rassenwurzel entsprossene Völker von edlen Anlagen, beide kampferprobt und kulturell leistungsfähig, aber im tiefsten Fühlen bereits sich entfremdet. Den Hevellern an der Havel nahm Heinrich im härtesten Winter die Brennaburg ab, die auf der heutigen Dominsel von Brandenburg lag und als uneinnehmbar galt. Die Daleminzier besiegte er im Raum von Meißen, wo auf seinen Befehl die unbedeutende slavische Wachanlage in eine stattliche deutsche Burgfeste umgebaut wurde, das heutige Meißen. Der Fall der daleminzischen Hauptfeste Jahna besiegelte die Niederlage dieses Stammes, im Endkampf von den Sachsen offenbar mit schonungsloser Erbitterung geführt. Gegen die Böhmen zog Heinrich im Verein mit dem unmittelbar benachbarten Bayernherzog zu Felde. Indem er mit Erfolg seinen Angriff gegen Prag, die Hauptfeste des Landes, richtete, erreichte er es, daß Böhmen den Ungarn nicht einfach mehr als Durchmarschraum gen Franken hin dienen konnte. In einem einzigen Jahr gelang es ihm, die ganze slavische Front aufzurollen und die deutsche Herrschaft über die fremden Stämme herzustellen. Denn auch die Wilzen, Redarier und Obotriten, die sich erhoben hatten, zwang er zum Gehorsam. Die Redarier, diese südlichen Nachbarn der Heveller, warf er aus den befestigten Lagern an der Löcknitz heraus, den Lausitzern nahm er ihre Volksburg Lebusa im südöstlichen Fläming ab. Sie alle wurden der deutschen Oberhoheit unterworfen und zur Zahlung jährlicher Tribute verpflichtet, wenn auch an eine Einverleibung und Besiedlung dieser Gebiete nicht zu denken war. Unter der Aufsicht der angrenzenden deutschen Grafen lebten sie dahin. Es ist eine Ordnung, die das Schutz- und Überwachungssystem der Grenzmarken in der Art Karls des Großen erneuerte: der Sachse trat mit dieser Sicherung der östlichen Lande in die Fußstapfen des Franken und wurde zugleich der [20] Vorläufer eines anderen bedeutenden Herrschers aus niedersächsischem Geblüt, Heinrichs des Löwen, der die Kolonisation des Ostens im großen Stil fortführte. Auch das neuchristliche böhmische Reich unter Wenzel, dem ersten dieses Herrschernamens, hat der König zur Anerkennung der deutschen Oberhoheit gezwungen (934), was freilich nach der Ermordung Wenzels unter dessen Bruder Boleslaw bald einen tschechisch-heidnischen Gegenschlag auslöste. Doch wagte der neue Gebieter der Tschechen zu Lebzeiten König Heinrichs nicht, die deutsche Lehenshoheit abzuschütteln. Nicht minder bedeutungsvoll sind die Vorgänge im Norden, durch die Heinrich diese Flanke seines Reichs schützte und manches Versäumnis seiner Vorgänger auf dem Thron wieder gutmachte. Hier fanden die Dänen, die seit geraumer Zeit das Land nördlich der Elbe im heutigen Holstein überflutet hatten und die friesische Küste heimsuchten, ihren Meister. Heinrich brachte Gnupa, einem Teilkönig aus schwedischem Haus, der nördlich der Eider in der Gegend von Schleswig saß, eine Niederlage bei (934). Gnupa nahm die Taufe. Auch den mächtigen Dänenkönig Gorm, der von Seeland her seine Herrschaft in Jütland ausbreitete, beugte Heinrich unter seine Oberhoheit, beließ ihm aber die Herrschaft. Die Wiederherstellung der ehemaligen karolingischen Nordmark zwischen Eider und Schlei war das unmittelbare Ergebnis dieser Kämpfe, ein tieferes Verwachsen des Nordens mit der abendländischen Kultur und seine weitere Christianisierung war die Folge. Es ist der Forschung nicht entgangen, daß ein Zusammenhang zwischen den Zügen Heinrichs gegen die Slaven und seinem Abwehrkampf gegen die Ungarn besteht. Fast könnte man jene eine Art Probemobilmachung nennen: der Angriff gegen die einen bereitete die Verteidigung gegen die anderen vor. Die Ungarn hatten an den Elbslaven, nachdem diese von dem deutschen König unterworfen waren, nicht mehr den früheren Halt als Verbündete; Böhmen lag ihnen jetzt nicht mehr so ohne weiteres offen, und bezeichnenderweise getrauten sich die Daleminzier, als nun aufs neue die Ungarn sich anschickten, über Ost- und Mitteldeutschland herzufallen, nicht, ihnen wie früher Hilfe zu leisten (932–933). Heinrich selbst war es jetzt, der nach Ablauf des neunjährigen Waffenstillstands zum entscheidenden Schlag gegen die Ungarn ausholte; seine Vorbereitungen waren inzwischen weit genug gediehen, um dies wagen zu können! So wies er ihre Gesandten, die noch einmal den ausbedungenen Tribut erheben wollten, ab. Mit leeren Händen zogen sie von dannen. Ein blitzschneller Einbruch in Thüringen und Sachsen war die Antwort der Steppensöhne. Heinrich errang einen großen Sieg über ihr Hauptheer bei Riade an der Unstrut (933), worunter vielleicht das heutige Kalbsrieth am Ostrand der Goldenen Aue zu verstehen ist. Gleichgültig ob diese Waffentat hier oder, worauf andere Überlieferungsreste hindeuten, südlich von Merseburg bei Keuschberg stattgefunden hat: erfochten mit den Heereskräften des gesamten Reichs, darunter auch Bayern und Schwaben, war damit eines der machtvollsten nationalen Befreiungswerke unserer Geschichte vollbracht, das weithin in Europa Widerhall fand.
[21] Drei Jahre waren dem König noch zu schaffen vergönnt. So wie in seinen Beziehungen zu den Nachbarländern ein Anstieg von nüchterner Bescheidung zu höheren Ansprüchen und Erfolgen zu beobachten ist, zeigt sich auch zu Ende seiner Regierung ein gewisser Drang ins Weite. Er verwirklichte sich zwar nicht mehr; aber es ist, als lasse er das große Thema der Ottonischen Zeit mit seinen gewaltigen geistigen und politischen Spannungen bereits anklingen: das Hinausstreben des deutschen Königtums über seine nationale Grundlage zur beherrschenden Vormacht des Abendlandes in Gestalt des Kaisertums – jener Entwicklung, die allen Glanz, aber auch alle Tragik unseres Mittelalters birgt! Denn an ihrem Ende steht dreihundert Jahre später der Untergang der Staufer, einer der furchtbarsten Zusammenbrüche deutscher Geschichte! Offenbar nämlich hat sich Heinrich noch zuletzt mit dem Plane getragen, seinem Sohne die Lombardenkrone zu erobern, in die italienischen Verhältnisse einzugreifen und vielleicht sogar die brachliegende Kaiserwürde zu erringen. Die Nachricht stammt von Widukind von Corvey: entspricht sie der Wahrheit, dann dürfte sie vielleicht im Zusammenhang stehen mit einer Annäherung an die Kirche, wofür Anzeichen vorliegen. Es könnte sein, daß diese kirchenfreundlichere Haltung unter dem persönlichen Einfluß der Königin erfolgt ist, oder daß Heinrich die deutschen Bischöfe der Krone zu verbünden suchte in der Absicht, damit die Hierarchie in die Hand zu bekommen und sie dem Reichsgedanken dienstbar zu machen; dann wäre es denkbar, daß im Rahmen solcher Politik von einem Romzug und universalen Zielen eine stärkere Lockung ausging als bisher. Die heilige Konstantinslanze, die als Symbol des Anspruchs auf Italien und auf das Imperium galt, hatte Heinrich schon zehn Jahre zuvor von Rudolf von Burgund erworben und ihm sogar Basel dafür überlassen – eine Tatsache, die zu denken gibt! Möglich aber auch, daß den König die Schwerkraft der italienischen Verhältnisse aus anderen Gründen anzog. Denn längst blickten auch die Herren anderer deutscher Stämme dahin, und ein deutscher König konnte nicht dulden, daß sie dort Politik auf eigene Faust trieben. Burkhard von Schwaben war einst im Kampfe um Italien gefallen, und an Eberhard von Bayern, den Sohn Arnulfs, gelangte noch zu Lebzeiten Heinrichs der Ruf einer oberitalienischen Adelspartei, er möge helfend über die Alpen kommen. Mußte der König angesichts solcher über die Grenzen hinausgreifender reichssprengender Regungen nicht versuchen, sich hier selber mit eigenem Handeln einzuschalten? Auch diese Frage kann nur gestellt, nicht eindeutig beantwortet werden. Wie dem auch sei: unsere Quellenzeugnisse sind nicht reichhaltig und zwingend genug, um einen sicheren Schluß zu erlauben, ob der König in der Tat am Abend seines Lebens eine neue Wendung vollziehen wollte und aus welchen Gründen es geschah. Eingetreten ist sie nicht mehr! Das Rätsel, mit welchen Gedanken er sich trug, wird wohl immer ungelöst bleiben. Die Fahrt über die Berge, von der Widukind spricht, der Römerzug unterblieb! Der Sohn erst sollte diese ganz [22] anderen Bahnen eröffnen. Unsterblichkeit gewonnen hat Heinrich als deutscher König, nicht als römischer Kaiser! Der Schlaganfall, von dem Heinrich auf der Herbstjagd (935) im Harzgebirge getroffen wurde, hat ihn gehindert, jenen kühnen und gefährlichen Lockungen stattzugeben. Monatelang siechte er dahin. Aber in der Sorge fürs Reich erlahmte er nicht. Es gelang ihm noch, auf seinem letzten Hoftag zu Erfurt durch Designation seinem Erstgeborenen die Nachfolge zu sichern. Es geschah nicht in der Art des karolingischen Erbrechts mit seinen verhängnisvollen Reichsteilungen. Es setzte sich damit auch nicht die ganz freie Königswahl in Deutschland fest, sondern es drang das altgermanische Geblütsrecht durch, das die Wahl ans bestehende Herrscherhaus und an dessen tüchtigsten Sproß band. In Memleben, wohin der König sich gleich nach der Erfurter Reichsversammlung begeben hatte, ereilte den Sechzigjährigen der Tod (936), nachdem er von seiner Gemahlin Abschied genommen und ihr für ihre Treue gedankt hatte. In der Peterskirche zu Quedlinburg, wo sich bald nachher die große Stiftskirche St. Servatii erhob, wurde er zu Grabe getragen.
 Als dauerndes Erbe König Heinrichs ging in die Geschichte der nächsten Jahrhunderte ein die Neubefestigung der königlichen Gewalt als Lebensform des Reichs und Grundlage weiteren Aufschwungs, ferner eine stärkere Geschlossenheit des Ganzen. War sie auch keineswegs schon endgültig gesichert, so hatte Deutschland doch eine festere Durchbildung durch ihn empfangen. Freilich, die verschiedenen Abstufungen des eigenen Herrschaftsgrades gegenüber den einzelnen Stammesgewalten im Süden und Westen deuten darauf hin, daß ihr gleichmäßigere Reichweite und tiefere Gesamtverwurzelung zu wünschen war. Aber auch die Bande zwischen den Stämmen selbst mußten sich noch enger miteinander verknüpfen, wollte das Reich nicht Gefahr laufen, durch innere Gegensätze erneut zerwühlt zu werden. Noch trat das Gemeinsame nur in Fällen heftigster Bedrängnis durch auswärtige Feinde hervor, wie es die Ungarn waren, die allen zur Plage wurden oder es werden konnten. Von einem umfassenden, in Fleisch und Blut übergegangenen Staatsgefühl, von einer wahren als Schicksal empfundenen Volksgemeinschaft war Deutschland noch weit entfernt. Seine Daseinsformen waren erst im Werden, eine nationale Ordnung nur in den gröbsten, wenn auch verheißungsvollen Umrissen vorhanden. Noch gebrach es allenthalben an wirklicher und letzter Einheit. Die Rheinländer kümmerten sich nicht viel um die Nöte, mit denen die Stammesgenossen König Heinrichs im Kampf an der Ostgrenze zu ringen hatten, und die bayerischen oder schwäbischen Annalen melden bezeichnenderweise fast nichts von den Unternehmungen gegen die Slaven und Dänen. Die Sachsen wiederum unterhielten nähere Beziehungen fast mehr als zu den anderen Deutschen mit ihren angelsächsischen Verwandten, wie denn auch Heinrichs Sohn Otto die englische Königstochter Edith als Gemahlin heimführte. [23] Die Lothringer schauten hinüber nach Frankreich und Burgund, wo ihnen Ziele besonderer Art winkten. Die Bayern aber und die Schwaben, unter sich auf gespanntem Fuß lebend, liebäugelten damit, in Italien sich fremde Kronen zu holen. Heinrichs feste Hand, seine klare Willensrichtung, seine Waffenerfolge haben die inneren Schwierigkeiten zu einem gewissen Ausgleich gebracht und die Sicherheit des Reiches gegen Slaven, Dänen und Ungarn erhöht. Daß der König insbesondere die Leitung im Kampfe gegen die gefährlichsten Reichsfeinde, die Ungarn, den Stammesgewalten, die hierin versagt hatten, abgenommen, sie um sich geschart und zum Siege geführt hat, bleibt sein größtes nationalpolitisches Verdienst. Es ist denn auch die Tat, die am stärksten in der lebendigen Erinnerung des Volkes gewirkt hat. Indessen, für immer waren die inneren und äußeren Gefahren alle nicht gebannt. Heinrichs Nachfolgern, den Herrschern aus dem sächsischen Haus, den salischen und staufischen Kaisern, die dessen Vermächtnis übernahmen, blieb noch genug zu tun übrig, um dem vielgestaltigen Deutschland, dem allseits bedrohten Reich der Mitte und der offenen Grenzen, den gebührenden Platz unter den Völkern Europas zu erkämpfen und zu behaupten.
 |































