
Süddeutschland - Eberhard Lutze
Drei alte
Reichsstädte
Der Dreiklang Rothenburg, Dinkelsbühl, Nördlingen besitzt auch
für den Ausländer einen Reiz, mit dem sich ihm Idealvorstellungen
von altdeutscher Lebenskultur verbinden. Obgleich das Gesicht der Städte
die Züge einer etwa gleichen Entstehungszeit trägt, sind sie ihrem
Wesen nach grundverschieden. Rothenburg: das ist das fränkische
Jerusalem, ein Vergleich, der dem Kaspar Bruschius im 16. Jahrhundert bei
dem Blick von der Engelsburg herab über das tief eingeschnittene Taubertal
hinauf zur türmereichen "Stadt in Franken lobesam" in Erinnerung an die
ähnliche Lage Jerusalems eingefallen ist. Dinkelsbühl: das ist die
Stadt mit der Flußlage "im stillen Tale der dunklen Wörnitz". Dies
und die Lage an dem natürlichen Kreuzungswege des
Ost–West- und
Nord–Südverkehrs hat wesentlichen Anteil an der Geschichte
Dinkelsbühls gehabt und auch an der Gestalt der Stadt Nördlingen,
der Stadt des Rieses. Ihr Grundriß wiederholt die rundliche Kesselform des
vulkanischen Seegebietes, ihre fünf Haupttore nehmen die
Hauptverkehrsstraßen des Rieses auf und sammeln sie im natürlichen
Stadtmittelpunkt, dem Marktplatz.
Wie kommt es, daß die drei Städte, deren mittelalterliche Bedeutung
durch den wohlerhaltenen Mauerring außer Frage steht, heute kleine
Landstädte mit etwa 9000, 5700 und 8500 Einwohnern sind, daß ihre
Entwicklung im wesentlichen abgeschlossen war, ehe entseelte
Unternehmerbauten des Maschinenzeitalters den mittelalterlichen Bannkreis
sprengen, ehe das Weichbild der wie ein Wunder in unserer Zeit stehenden
Bürgerstädte einer dreimal überholten altdeutschen Kultur
beeinträchtigt oder gar zerstört werden konnten, wie an so vielen
Plätzen unseres Vaterlandes? Eine erste Erklärung gibt das Ende
der - freilich bereits zur Bedeutungslosigkeit
herabgesunkenen - reichsstädtischen Freiheit. 1802 bzw. 1803 fielen
Rothenburg und Nördlingen der Mediatisierung zum Opfer. Sie wurden
Landstädte der bayerischen Krone. Dinkelsbühl hatte bereits 1731
Beschränkungen des Stadtregimentes erfahren, hatte Erwerbsgelüste
der Öttingischen Grafen und der Ansbacher Markgrafen [733] zurückzuweisen.
Nachdem die schwer verschuldete Stadt 1804 an Preußen gefallen war,
nahm 1806 endgültig Bayern von ihr Besitz. Die Verfassung einer
versunkenen Zeit ging in der Ordnung einer größeren Einheit auf.
Ein zweiter nicht minder folgenschwerer Eingriff war die neue
Grenzführung. Alle drei Städte liegen auf der Grenzlinie nach
Württemberg. Rothenburg büßte auf dem Tauschwege die
Hälfte seines einstigen Reichsgebietes an das westliche Nachbarland ein.
Damit war den Städten die Grundlage ihrer wirtschaftlichen Existenz
entzogen. Denn ein Ersatz wurde nicht geschaffen. Die Haupteisenbahnlinien
meiden die Städte. Es ist noch heute langwierig, nach Rothenburg und
Dinkelsbühl zu reisen, wenn die Sonderzüge der Hauptreisezeit
weggefallen sind. An dem Beispiel der schönsten altdeutschen
Reichsstädte wird eindringlich die Folge der Umwälzung deutlich,
wie sie die "so allgemeine und so reißend schnell durchgeführte
Umlegung aller großen Verkehrsstraßen" im Zeitalter der
Kunststraßen und der Eisenbahnen heraufgeführt hat. Die
Großstädte haben die Herrschaft über das Land angetreten;
einst blühende kleine und mittlere Herrenstädte mußten
verblühen. Das neuzeitliche
Schienen- und Kunststraßennetz hat infolgedessen die umgekehrte Wirkung
wie das mittelalterliche Straßensystem. Einst siedelten sich Städte
und Dörfer an den umständlich geführten Straßen an, die
bis in die entlegensten Winkel ausstrahlten und das Land individualisierten, heute
wählen die Verbindungsstraßen den kürzesten Weg, sie
zentralisieren das Land (Riehl).
Wie eine Ironie des Schicksals wirkt es daher,
wenn man hört, daß gerade Kleinstaaten es waren, die in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts mit der Anlage von Kunststraßen
begannen. Die erste moderne Chaussee soll im Ries, zwischen
Öttingen-Spielberg und Nördlingen gebaut worden sein. W. H. Riehl,
einer der Wiederentdecker vergessener altdeutscher
Städteschönheiten, schreibt dazu: "Jene Staaten ahnten die gewaltige,
staatlich zentralisierende Macht eines vollendeten Straßensystems nicht, sie
ahnten nicht, daß sie doch eigentlich nur die Wege ebneten, damit ihre
eigene Souveränität desto geschwinder auf denselben zum Land
hinausfahre."
Ihre reichsstädtische Verfassung danken die drei Städte den Kaisern
Friedrich II. und Rudolf von Habsburg. Nördlingen wurde unter dem
Staufer freie, nur dem Kaiser untertane Stadt, dem Rat und Bürgerschaft
den Huldigungseid zu leisten hatten; Dinkelsbühl 1273, Rothenburg 1274.
Ihre große Zeit aber hatten die Städte erst im 14. und
15. Jahrhundert, als sie sich die Form schufen, in der wir sie bewundern, als
seit 1489 die Reichsstädte zwar ihre gegen die Fürsten gerichteten
Sonderbündnisse aufgeben mußten, aber dafür die
Reichsstandschaft erwarben und als solche nicht anders wie die Landesherren Sitz
und Stimme im Reichstage hatten. Unter der Regierung der
städtefreundlichen Kaiser
Karl IV. und Wenzel gelang es
Rothenburgs genialem Bürgermeister Heinz Toppler, ein nur wenigen
anderen Städten gewährtes Vorrecht durchzusetzen, nämlich
das Recht, den Reichsvogt durch den Rat selbst wählen zu dürfen,
den völligen Blutbann und die Befugnisse des kaiserlichen Landgerichtes
zu erwerben. Der Rothenburger Reichstag von 1377 [734] machte den Anfang zu
dem beispiellosen Aufstieg der Stadt, die ihrem größten Führer
seine Taten schlecht gedankt hat. Im Verfolg einer von Rothenburg tapfer und mit
Erfolg geführten Fehde mit dem Burggrafen von Nürnberg und dem
Bischof von Würzburg war die Reichsacht verhängt und Toppler des
Verrates angeklagt worden. 1408 endete er im Kerker. Das reizende
"Topplerschlößchen" im Taubergrund und die erweiterte
Stadtbefestigung sind die Denkmäler des tragischen "Königs von
Rothenburg" in der von ihm zur Größe geführten Stadt.

[666]
Rothenburg ob der Tauber. Der Markus-Turm.
|

[665] Rothenburg ob der Tauber. Das Rathaus.
|
Auf dem sanft geneigten rechteckigen Marktplatz, dem das majestätische
Rathaus, der Ausblick in die wohlhabende patrizische Herrengasse, der reizende
St. Georgsbrunnen, die hallende Weite des Platzraumes einen festlichen
Zug wahrhaft hochgemuten Selbstbewußtseins verleiht, stehen wir im Kern
der alten Stadt. Leicht kann man von der südlich gelegenen Johanneskirche
aus, wenn man den konzentrisch geführten Gassen über den
Markus- und Weißen Turm zum ehemaligen Dominikanerinnenkloster
folgt, sich den Verlauf der ältesten Ummauerung klarmachen. Ein kleines
Gebiet, denn im Westen gab der steile Tauberabfall eine natürliche Grenze
und glänzende Befestigungsmöglichkeit. Die Herrengasse endete am
Burgtor, dem Zugang zu der auf langgezogener Bergzunge beherrschend
angelegten Burg, von der wir Kunde haben, längst bevor es eine Stadt
Rothenburg gab. Seit dem 10. Jahrhundert saßen hier die Grafen von
Rothenburg. Kaiser Heinrich V. verlieh sie 1116 seinem Neffen Konrad
von Hohenstaufen, der die Vorderburg errichten ließ. Von dieser
Reichsfeste aus erteilte 1172 Barbarossa der Siedlung das Weichbildrecht; die
Anfänge zur Stadt waren damit gelegt. Schon 1204 war der erste
abgesteckte Rahmen für sie zu eng geworden. Man konnte darangehen,
nach Osten hin sich erstreckendes Gartenland in hufeisenförmiger
Erweiterung zu ummauern. Die letzte Abrundung, wie schon erwähnt,
gelang der Führung Topplers durch die Einbeziehung des südlichen
Spitalviertels, unter meisterhafter Ausnutzung der Steillage über der
Tauber. Die Stadt folgt der Schleife, die der Fluß zu ihren
Füßen zieht. Die Außenbezirke ordnen sich bescheiden dem
vornehmen Stadtkern unter. Die Häuser werden einfacher, die
Bevölkerung handwerklich oder ackerbürgerlich. Noch heute
erinnern die Straßennamen an die einst dort ansässigen Handwerke.
Die Hauptstraßen selbst führen alle über den Marktplatz. Man
lasse sich durch die malerischen, immer wieder begeisternden und zu
beschaulichem Verweilen einladenden Straßenzeilen nicht täuschen:
auch in dem scheinbar so regellosen, so wie ein natürliches Gebilde
gewachsenen Rothenburg sind die Gassen nach einem vorbedachten Plan
geführt. Dies ist das Gesetz, nach dem sich die in sechs Wachten
eingeteilten Stadtteile um ihren natürlichen Mittelpunkt kristallisieren: das
Gesetz der Wehrhaftigkeit. Im Angriffsfalle mußten die der allgemeinen
Wehrpflicht unterliegenden Bürger schnell an die bedrohten Partien der
Mauer, zu den schwer bewehrten Türmen geworfen werden können.
Die Torwächter und die Wache auf dem Rathausturm hatten die Pflicht,
bedenkliche Bewegungen im Felde sofort zu signalisieren. Der raschen
Verbindung diente der Wehr- [735] gang, den abzuwandern
zu den allerschönsten Erlebnissen in Rothenburg zählt. Immer
wieder öffnen sich neue Blicke über die Dächer, deren in
warmem Rot leuchtende Schrägen auf steil sich reckenden
Fachwerkgiebeln bei jeder Mauerbiegung in immer neuen
Überschneidungen und Gruppierungen von dem jäh
emporschießenden Rathausturm, dem doppeltürmig flankierten
gestreckten Schiff der Jakobskirche, den zierlich behelmten Tortürmen
überragt werden. Alle 150 Meter, in dem Abstande eines
Pfeilschusses, werden Mauer und Wehrgang von Türmen unterbrochen. Sie
sitzen wie 35 Gelenke in dem steinernen Mantel der Mauer. In dem am
meisten gefährdeten östlichen Zuge stehen noch
12 Streichwehren im Graben. Die Straßenköpfe
schützen das
Klingen-, Würzburger-, Röder-, Spital- und Koboltzeller Tor. Sie
wurden aus Torburgen gegen Angriffe verteidigt. Es war keine Kleinigkeit
für den Belagerer, eine solche kleine Festung zu nehmen. War ihm
geglückt, das erste Torhaus mit Zugbrücke und Tor zu besetzen, so
stand ihm ein deckungsloser geschlossener Hof bevor. Graben, wiederum ein
Torhaus mit Fallgatter und Zugbrücke, der Zwinger und endlich der
eigentliche Hauptturm. Erschwert wurde die Einnahme noch durch mehrfache
Biegungen des Weges durch die Torburg, so daß der Gegner die Einfahrt
nicht unter Strichfeuer nehmen konnte. Eine immerwährende Sorge
mußte das gefährdet gelegene Spitaltor im Süden der Stadt
bleiben. Die 1586 vollendete Bastei ist der modernste Rothenburger
Verteidigungsbau. Der Stadtmeister Leonhard Weidenmann verwertet die
Befestigungstheorie Albrecht Dürers. Zwei ovale Höfe,
Streichwehren zum Auffahren schweren Geschützes, Kasematten zum
Bestreichen des Grabens, prachtvolle Buckelquadern, deren Auskragung das
Einhaken von Sturmleitern erschweren sollte. Vor der drohenden Bastion aber
rauschen die Linden ihr altes Lied, träumen von der alten
Reichsgröße, wie ihre Vorfahren, die den Einlaß Begehrenden,
bevor noch Brücke und Tor geöffnet waren, einen ersten
schützenden Willkomm der Stadt entboten. "Pax intrantibus, Salus
exeuntibus" - Friede den Ankömmlingen, Heil den
Scheidenden - grüßt ein Spruchband von der Bastei herab.
Zu der Herrschaft Rothenburg gehörten im ersten Drittel des
15. Jahrhunderts 167 Ortschaften mit
20 000 Einwohnern. Seit den Hussitenkriegen wird dieses Umland
durch die Landhege dem Verteidigungsnetz miteinbezogen. Noch heute stehen
einsam, mitten in der Landschaft, sechs Landtürme des aus einer doppelten
Umwallung mit Dornhecken zu einem bedeutenden Hindernis ausgebauten
Schanzwerkes. Der Obhut der städtischen Hegereiter war die Anlage
unterstellt. In dem reizend winkligen Hegereiterhaus im Spitalhof hatte der
Beamte seine Dienstwohnung.
Diese Andeutungen über das "Rothenburg in Wehr und Waffen"
mögen angesichts der Schönheit des Stadtbildes sehr nüchtern
klingen. Aber man hat mit dem Wissen um die kriegerische Sendung ein leichtes
Mittel bei der Hand, diese Schönheit nicht nur zu genießen, sondern
auch zu verstehen. Denn darin ist der Sinn dieser Schönheit am herrlichsten
erfüllt, daß er aus dem Bedürfnis der um ihr Rathaus und um
ihre Stadtkirche gescharten Bürger- [736] gemeinde, aus der
Lebensnotwendigkeit und Geschlossenheit einer Zeit gefunden wurde. In der
Einheit liegt die Schönheit dieser verwunschenen Stadt. Vor dem vom
Bahnhof kommenden Reisenden versinkt die Gegenwart, sobald die glatte
Asphaltstraße aufhört, und er auf holprigem Pflaster die beiden
Rödertore durchwandert; wer den Taubergrund entlangkommt, dem
öffnet sich überraschend auf beherrschender Höhe der Anblick
der Stadt, und man wandere im Tale weiter an dem Riemenschneiderkirchlein von
Dettwang vorüber, um den ganzen wechselvollen Umriß zu
genießen, von der Höhe der Engelsburg bei Abendsonnenschein oder
im Mondenglanz das vieltürmige Bild zu schauen und über die
doppelbogige Tauberbrücke - ein trotziges Denkmal aus
Rothenburgs politisch großer
Zeit - den Zugang durch das Koboltzeller Tor zu gewinnen. Die
mähliche Steigung des Weges überwachend entfaltet das
Plönlein alle Reize Rothenburger Stadtbaukunst: Durchblick auf zwei
Türme, die als Blickfang sich zwischen die Giebelwände der
Straßenzeile sperren, ein aus Fachwerkmuster und Durchfensterung
bestehendes Haus, das schmal wie ein Schiffsleib die Straßengabel zu
schöner Einheit zusammenschweißt. Giebel an Giebel,
treppenförmig gestufte und gerade Schrägen, Schnecken in bunter
Abfolge, jedes Einzelhaus sich einordnend in die "Schnur" der Gassenwand.
Schnittige Steinmetzarbeiten wie die Schauseite des "Baumeisterhauses" setzen
prunkende Akzente. Und ist nicht das Meisterwerk des Leonhard Weidenmann,
sein Rathausneubau, den er mit dem älteren gotischen
Turm- und Giebelbau zu einer jeder Symmetrie baren, einzigartigen
Ecklösung, zu einem Gebieter über Platz und Stadt
zusammenschloß, ist dieses schönste deutsche Rathaus nicht der
reichere Bruder all der anderen kleinen Rothenburger Häuser? Die
springende Unruhe des Umrisses, die Achsenvielzahl der Bogenfenster und
Dachluken, der aus der Mitte gerückte Treppenturm, der übereck
gestellte Erker: in jeder Einzelform zuckt und sprüht die Phantasie des
fränkischen Rothenburg, durchsättigt der die Zeiten
überdauernde Stammes- und Stadtcharakter die Stilformen der deutschen
Renaissance, deren schattenwerfende Profile schwer und reif neben dem zarten
Giebel des gotischen Nachbarn stehen.
Unbedingter als die Riemenschneiders Blutaltar umschließende
Rothenburger St. Jakobskirche beherrscht die dem Ritter Georg geweihte
Pfarrkirche zu Dinkelsbühl das Stadtbild. Gewaltig erhebt sich
das riesige Dach der schönsten süddeutschen Hallenkirche
über die niedrigen Giebel der behaglichen Bürgerhäuser. Die
Flußlage hat dem Stadtplan größere Weiträumigkeit
verstattet. Die Häuser dehnen sich wohliger an den breiten
Straßenplätzen, die sie gestaffelt besetzt halten. Schwäbische
Lust an Raum, sonnigen Plätzen und langfallenden Schatten ist das, die sich
in Dinkelsbühl mit fränkischen Zügen begegnet.
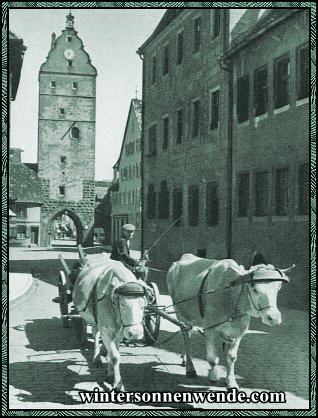
[668]
Dinkelsbühl.
|
Seit Jahrhunderten schwanken hochbeladene Ochsengespanne durch die Tore.
Längst ist der Tuchmacherei und den Sensenschmieden anderswo
Konkurrenz entstanden. Schwer hat die kleine Reichsstadt um ihre
Selbständigkeit gegen die ständig fehdelustigen Grafen von
Öttingen kämpfen müssen, schwer der Religionskampf um den
Glauben der Dinkelsbühler getobt. Mit harter Hand hat Karl V.
[737] die frühzeitig
zum Protestantismus übergetretene Bürgerschaft zum alten Glauben
zurückgeführt, dem noch heute die Mehrzahl anhängt und die
Georgskirche dient. Hart aber hat auch die Bürgerschaft ihre eigene Macht
behauptet, wie das Schicksal der Nachbarstadt Feuchtwangen dartut, die
nicht zur Macht kam, weil es den reichen Dinkelsbühlern nicht gefiel.
Immer wird die Stadt selbst das schönste Denkmal dieser stolzen und
reichen Geschlechter bleiben. Ihre bald sich weitenden, bald sich verengernden
Straßen, ihre schönen Durchblicke auf abgeklärt ruhig
wirkende Türme scheinen zum langsamen, genießenden Verweilen
geradezu geschaffen. Größe und Beschränkung: beides hielt
zukünftiges Schicksal für die Bewohner dieser Stadt in der Hand.
Die Nachfahren jener stolz-demütigen Generationen, die ihre letzte Kraft
daransetzten, ein Gotteshaus zu bauen, das dreimal soviel Raum bot wie
Einwohner bauten und beteten, die Nachfahren fielen der Beschränkung
durch die Mauer zum Opfer. Wie seltsam klingt doch der Satz des liebenswerten
Christoph von Schmid, eines Sohnes der Stadt, der den Brauch der
St. Ulrichsprozession zur Kapelle vor der Stadt mit der Begründung
begrüßt, weil dadurch die Bewohner, "die sonst nicht hinausgehen
würden, hinausgeführt werden, damit sie den Segen Gottes auf
Wiesen und Feldern auch einmal ansehen mögen".
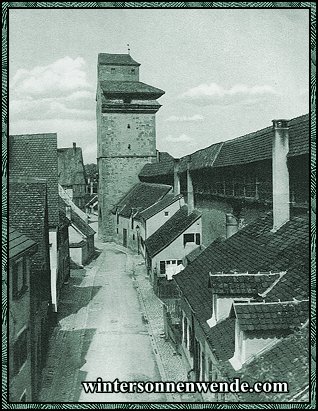
[667]
Nördlingen. Wehrgang aus dem 14. Jahrhundert.
|
Ob in Nördlingen ein solcher Geist der Enge je eingezogen ist?
Fast möchte man glauben, daß der Schein der Weltgeschichte, der in
den Nottagen des Jahres 1634 jäh über Nördlingen aufgezuckt
war, als sich durch die Niederlage Bernhards von Weimar das
dreißigjährige blutige Ringen zu entscheiden begann, noch
später nachgeleuchtet hat. Der junge Kaiser Ferdinand II. ließ
die Stadt ihren Trotz nicht entgelten. Sie durfte protestantisch bleiben. Damals
haben von dem Wahrzeichen der Stadt, dem "Daniel" der Georgskirche,
schwelende Pechkränze als Notzeichen der verzweifelten Bürger
dem schwedischen Entsatzheer durch das nächtliche Ries
entgegengeleuchtet. Die Beschießung hat nur geringen Schaden angerichtet.
Im Jahre 1651 konnte Andreas Zeidler den intakt gebliebenen runden
Grundriß zeichnen; unverändert bietet er sich dem heutigen Blick von
der Höhe des Turmes. 18 Türme bewachen die Mauer, locker,
zu einzelnen Blöcken regelmäßig geordnet liegen die
Häuser, aus deren traulich-behäbiger Gemeinschaft sich allein das
freistehende Rathaus mit der schönen gedeckten Freitreppe löst.
Keine überraschenden Durchblicke, keine fränkische Romantik gibt
es in der schwäbischen Stadt der Färber, Gerber und Lodweber; alles
ist klar, alles ausgerichtet nach dem schlanken Mittelpunkt des Daniel.
Düster, massig und drohend stehen die runden oder mit schweren Hauben
abgedeckten Festungstürme Wolf Waldbergers († 1613)
über der älteren Mauer: ein wehrhaftes Bild der Reichsstadt, die ihre
Rechte gegen 15 Landes- und Grundherren im Ries zu behaupten
wußte. Nördlingen blieb die "Königin des Rieses", die gar
wohl Hof zu halten wußte. Sie brauchte sich keine fremden Meister, wie
ihre Schwesterstädte, zu verschreiben: der Stadtmaler Friedrich Herlin, der
Dürerschüler Hans Schäuffelein schufen für sie. Die
Kreuzigungsgruppe in der Stadtkirche ist eines der ergreifendsten Schnitzwerke
unserer altdeutschen Plastik. Im sehenswerten Rathausmuseum findet [738] man auf einem
Altarflügel Herlins Nördlinger Bürger als Stifter solcher
eigenständigen Kunst dargestellt: andächtig knien sie in einem
Kirchengestühl. Ihr Blick ist klar, kühl und durchdringend. Wie diese
frommen schwäbischen Männer blickt ihre Stadt: hart und
geradsinnig, "nüchtern und ehrbar".
|