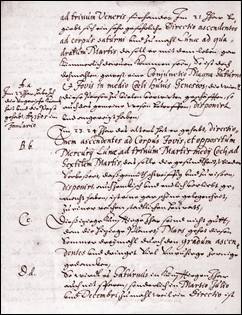|
[Bd. 1 S. 560]
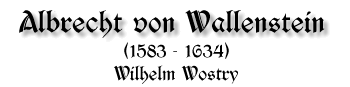
Wie im Fiebertraume die Bilder wirr und wüst durcheinandergehen und nur weniges davon klar im Bewußtsein haften bleibt, so bewahrte das Volk nur dunkle Bilder von jenem gewaltigen Drama. Von all den vielen Gestalten, welche in den wechselvollen Szenen dieses Kriegstheaters in bunter, verwirrender Fülle auftraten, sind ihm nur wenige dauernd im Gedächtnis geblieben. Keine von ihnen hat aber seine Phantasie so vielfach beschäftigt, wie die eine: Wallenstein. Über den Bereich verschwommener volkstümlicher Vorstellungen und verzerrter Darstellungen der Parteien hinaus hat die Geschichtsforschung in unermüdlicher Arbeit vorzudringen versucht, zu gesicherteren Ergebnissen über diesen Mann "unvergänglichen, wiewohl noch zweifelhaften Andenkens". Aber nicht die Historiker, auch nicht ihr größter unter den deutschen, Ranke, haben das Bild geschaffen, das sich die weitesten Schichten des Volkes von Wallenstein machen: der größte dramatische Dichter der Deutschen, Schiller, hat dem Schatten Wallensteins neues Leben eingehaucht; durch Schiller ist Wallensteins Name, der bis dahin nur berühmt gewesen war, unsterblich geworden. Und trotzdem konnte von Wallenstein, der die geschichtliche Erinnerung des deutschen Volkes, der die große deutsche Dichtung, der namentlich die gelehrte Forschung (die Bibliographie der Wallenstein-Literatur ist bändestark) gefesselt hat in einem Maße wie nur noch ganz wenige historische Gestalten – trotzdem konnte von ihm gesagt werden: seine Persönlichkeit stehe fremd in der deutschen Geschichte. Das wurde nicht behauptet im Hinblick auf seine Abkunft. Das altangesehene böhmische Geschlecht der Herren von Waldstein (dies, nicht Wallenstein ist der eigentliche Name des Hauses, der sich von der gleichnamigen Burg bei Turnau in Böhmen herleitet) war in den langen Generationen vor seinem berühmtesten [561] Sohne tschechisch gewesen. Gerade an Wallenstein aber offenbart sich die doppelseitige Verflechtung des damaligen böhmischen Adels mit der deutschen Umwelt. Der junge Wallenstein war durch Schulen gegangen, die dem Bereich deutsch-protestantischer Geistesbildung zugehörten, der gereifte Wallenstein stand, katholisch geworden, in engster Beziehung zum katholisch-deutschen Kaiserhofe. Der böhmische Landedelmann ist in eben jener Verbindung zum deutschen Reichsfürsten aufgestiegen. Aber auch das hätte seinen Platz in der deutschen Geschichte nicht bestimmt. Zweimal im Verlaufe des Dreißigjährigen Krieges schien sich die Möglichkeit zu bieten, das unselige Ringen früher und günstiger zu Ende zu führen. Das eine Mal wäre 1629 die Gelegenheit gewesen, die unvergleichliche Macht, welche die Siege der kaiserlichen und ligistischen Waffen Ferdinand II. in die Hand gegeben hatten, zu benützen zur Aufrichtung einer starken, überragenden Reichsgewalt, den Kaiser wirklich zum Kaiser, zum Herrn über die deutschen Fürsten zu machen und so des Reiches Einheit nach innen, seine Unabhängigkeit nach außen zu sichern. Das andere Mal hätte nach dem Tode König Gustav Adolfs von Schweden durch die Verbindung des von Wallenstein geschaffenen und geführten Heeres mit dem der deutschen Gegner des Kaisers, besonders der Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, die vereinte Kraft gekehrt werden können gegen die fremden Mächte, die, wie Spanien und Schweden, ihre Truppen auf deutschem Boden stehen hatten, oder die, wie Frankreich, hinter diesem standen. Voraussetzung für die Ausnützung beider Möglichkeiten wäre das Zurückstellen des konfessionellen Momentes gewesen. Daß Wallenstein dies erkannt hat, daß er – mag auch das Maß seines Eigennutzes hierbei noch so voll gerüttelt sein – in beiden Fällen der Träger des Gedankens war, die vom Schicksal gebotene und zum Teil von ihm selbst geschaffene Möglichkeit zum Nutzen des Reiches zu verwerten – das vor allem sichert ihm seinen Platz in der deutschen Geschichte. Freilich, es blieb bei den Gedanken; daß sie nicht zur Tat wurden, lag im ersten Falle neben anderen Umständen daran, daß der Kaiser selbst für den hohen Gedankenflug seines Feldherrn kein Verständnis aufbrachte; im zweiten Falle aber, dessen Verwirklichung nötigenfalls gegen den Kaiser hätte durchgesetzt werden müssen, lag das Scheitern zum größten Teile bei Wallenstein selbst, an der Kluft, die sich bei diesem namentlich in seiner letzten Lebenszeit auftat zwischen dem Planen und Wollen einerseits und dem Handeln anderseits. Damit aber ist ein Blick in den Mittelpunkt des Wallenstein-Problems getan, in das Rätsel seines Charakters, das die Phantasie des Volkes, den Gestaltungsdrang der Dichtung, den Forschertrieb der Historiker immer und immer wieder angeregt und beschäftigt hat. Albrecht Wenzel Eusebius Wallenstein wurde am 24. September 1583 auf dem Gute Hermanitz bei Arnau in Ostböhmen geboren; er entstammte einem minder begüterten Zweige des Herrengeschlechtes der Waldstein; seine Eltern gehörten religiös jener Richtung des Utraquismus an, die dem deutschen Luthertum nahestand. Die Erziehung Wallensteins – schon mit dreizehn Jahren war er Voll- [562] waise – stand denn auch stark unter deutsch-protestantischer Einwirkung. Ehe er 1600 auf die nürnbergische Akademie Altdorf ging, hatte er die lutherische Lateinschule in Goldberg in Schlesien besucht. Nach wenigen Monaten schon wurde der "tolle von Waldstein" von der Altdorfer Schule relegiert, und die übliche Kavalierstour führte ihn schließlich auf den katholisch-romanischen Kulturboden Italiens. Die Eindrücke, die er hier empfing, haben nachdrücklich auf den Stil und die Richtung seiner späteren Lebenshaltung eingewirkt. Mit der Rückkehr von der großen Tour in der Mitte des Jahres 1602 war die Erziehung des jungen Kavaliers abgeschlossen. Schon sein Eintritt in die Dienste des Hauses Habsburg wies eine bestimmte Richtung seiner Laufbahn. Er begann sie im ungarischen Feldzuge des Jahres 1604, dann wurde er Kämmerer des Erzherzogs Matthias, des künftigen Kaisers. Entscheidend für seinen weiteren Aufstieg aber war sein noch vor 1606 vollzogener Übertritt zum Katholizismus. Jesuitische Vermittlung knüpfte 1609 sein Eheband mit einer Witwe aus mährischem Adel; der Reichtum dieser Frau – sie starb schon 1614 – stellte ihn in die Reihe der mährischen Grundherren. 1615 machten ihn die mährischen Stände zum Obersten über ein Regiment Fußvolk. 1617, im Kriege des steirischen Erzherzogs Ferdinand – des späteren Kaisers – mit Venedig, unternahm Wallenstein zum ersten Male und im kleinen, was ihn später und in stetig größerem Maße ausgeführt seinem Kaiser höchst nützlich, dann unentbehrlich und endlich, zum eigenen Verderben, gefährlich werden ließ. Er warb auf eigene Kosten eine kleine Truppe von 180 Kürassieren und 80 Musketieren an, die er dem Heere des Erzherzogs zuführte und die unter seinem Kommando vor Gradisca gute Dienste taten. Schwer hatte die letzten Jahre her der Druck der konfessionellen und politischen Gegensätze auf Europa, namentlich auf Deutschland, gelastet. Doch nirgends war so viel Zündstoff aufgehäuft wie in Böhmen. Mit dem Prager Fenstersturze vom 23. Mai 1618 entlud sich das Gewitter der böhmischen Revolution; an ihr entzündete sich der fürchterliche Kriegsbrand, der in Deutschland durch dreißig Jahre hindurch wütete. Als dann am 19. August die böhmischen Stände sich von Ferdinand lossagten, den sie vor zwei Jahren zum Könige gewählt und gekrönt hatten, als sie eine Woche später den jungen Kurfürsten Friedrich von der Pfalz zu ihrem Könige erwählten, da war es schon längst entschieden: in dem Kampfe zwischen den beiden böhmischen Königen, deren einer, Ferdinand, nun auch deutscher Kaiser war, wird Albrecht von Waldstein nicht als mährisch-ständischer Oberst gegen den katholischen Habsburger, sondern als kaiserlicher Oberst gegen den protestantischen Pfälzer stehen. Sein erstes Hervortreten war allerdings nicht viel verheißend. Sein Versuch, das Regiment, dessen Kommando ihm die mährischen Stände anvertraut hatten, den Kaiserlichen zuzuführen, mißlang. Es waren überhaupt nicht so sehr hervorragende Leistungen im Felde, durch die er sich zunächst nützlich erwies; hieran [563] hat ihn damals schon vielfach die lästige Begleiterin gehindert, die ihn bis an sein Lebensende nicht mehr verlassen hat, die Gicht. Wohl aber erwies er dem Kaiser den besten Dienst durch Anwerbung und Aufstellung neuer Truppen, wofür er die nötigen Summen vorschoß. An der Schicksalsschlacht auf dem Prager Weißen Berge am 8. November 1620, in welcher der böhmische Aufstand zusammenbrach, hat er nicht teilgenommen – aber von den Früchten dieses Sieges hat er geerntet wie kein zweiter. Aus den großen nordböhmischen Herrschaften Reichenberg und Friedland, die der "Oberst von Prag" 1622 käuflich an sich gebracht hatte, und aus den vielen Gütern, die er dann noch hinzu erwarb, bildete er ein Herrschaftsgebiet, das vom Norden gegen den Osten und tief ins Innere Böhmens reichte und an die hundert Quadratmeilen, zahlreiche Städte und Hunderte von Dörfern einschloß. Die Frage, wie Wallenstein so gewaltigen Besitz erwerben konnte, führt in ein dunkles Kapitel seines Lebens. Beute und Gewinn, die der Krieg abwarf, Ausnützung der Geldentwertung, ja Teilnahme am Ertrag der Münzverschlechterung, niedriger Kaufpreis der Güter haben da zusammengewirkt. Vor allem aber eins: wie Wallenstein an Selbstsucht, Gewinngier und Skrupellosigkeit keinem nachstand in dem Kreise, aus dem er hervorgegangen war, so übertraf er sie alle an Geschäftsgeist, Unternehmungslust, Ordnungsliebe und Wirtschaftssinn – und hierin liegt der Schlüssel zum Rätsel seines staunenswerten Reichtums. 1624 erhob Ferdinand Friedland samt den 58 Herrschaften, die ihm einverleibt waren, zum Fürstentum, freilich als böhmisches Lehen, in welchem die Krone sich einige Regalien vorbehielt. Im Juni 1623 war Wallenstein eine neue Ehe eingegangen. Seine junge Gemahlin Isabella von Harrach verknüpfte ihn verwandtschaftlich mit dem Kreise des Wiener Hofes, der den Kaiser unmittelbar und bestimmend umgab, namentlich mit dessen einflußreichstem Günstling Eggenberg. Dieser Kreis hielt Wallenstein die Leiter, auf der er so rasch zu fürstlicher Höhe emporklomm. Nur, daß hier die Fürstenwürde einem zufiel, der wirklich zum Fürstenamte geboren war. Was ihn über die Kriegsfürsten seiner Zeit hinaushob, sein Organisationstalent, das befähigte ihn in noch höherem Maße zum Friedensfürsten. Denn stärker noch als seine militärische Begabung war sein Sinn für ordnende Verwaltung namentlich in ihren wirtschaftlichen Zusammenhängen. In ihm lebte durchaus die absolutistische Staatsauffassung seines Zeitalters. Und leise, wie von ferne kündete sich der kommende Wohlfahrtsstaat des aufgeklärten Despotismus an in der Fürsorge für das Wohl der Untertanen, in sozialen und hygienischen Vorschriften. Kirche und Schule erfreuten sich Wallensteins Förderung. Auch er hat die Gegenreformation in seinem Gebiete durchgeführt, doch ohne die nun in Böhmen und anderswo übliche Härte. Er hat Kirchen gebaut, geistliche Orden gefördert, den Jesuiten in Jitschin ein großes Kolleg mit einer Lateinschule gestiftet, ja sogar die Errichtung eines Bistums [564] und vielleicht einer Universität in Jitschin geplant. In seiner Volkswirtschaftspolitik hat er die Grundsätze und Anschauungen eines späteren Zeitalters vorweggenommen. Man mag es ablehnen, ihn einen Merkantilisten zu nennen. Aber es klingt an merkantilistische Grundsätze an, wenn er sich wiederholt äußerte, er wolle, daß das Geld unter die Leute komme, und er wolle, daß es im Lande bleibe; deshalb sollten die Güter und Waren tunlichst in seinem Territorium erzeugt werden. Deshalb seine stete Fürsorge für die altheimische Leinenerzeugung, für die Hebung der Tuchmachern, für die Einführung der Seidenindustrie, für seine Papiermühlen, für sein Brauwesen. In seiner volkswirtschaftlichen Politik (und Spekulation!) spielte die Armee eine große Rolle. Für sie arbeiteten seine Eisenhämmer, seine Schmieden, seine Pulvermühlen; den Kriegsbedarf vom Geschütz bis zur Stückkugel, ja bis zum Hufnagel, ließ er, unablässig antreibend, hier erzeugen, wie auch seine Schuster und Schneider, seine Bäcker einzeln und zunftweise die Monturen, das Schuhwerk zu Hunderten, zu Tausenden, das Brot und den Zwieback fuhrenweise liefern mußten. Indem Wallenstein so die reichen Erträge seiner mit überlegenem Verständnis geleiteten Wirtschaft dem Bedarf des Kriegs- und Heerwesens zuführte, indem er die großen Gewinne seiner finanziellen Operationen dem Kaiser als Vorschüsse zur Verfügung stellte, schloß sich der Ring seines einzigartigen wirtschaftlichen Wirkens. Freilich für ein solches Wirken, für einen Ehrgeiz und einen Machttrieb gleich dem Wallensteins war das neugeschaffene Fürstentum Friedland ein viel zu eng begrenztes Feld. Der Friedländer fühlte in sich den Drang und die Kraft, noch höher zu steigen, noch weiter auszugreifen, ja von sich aus bestimmend in den Verlauf des großen Ringens einzugreifen. Und es schien, als wolle ihm der stürmische Gang der Zeitereignisse auch dazu verhelfen. Mit dem Jahre 1624 konnte es scheinen, als gehe der Krieg zu Ende: die böhmischen Länder waren in der Hand des Kaisers, die Pfalz mit spanischer Hilfe erobert, die Parteigänger des Winterkönigs in Deutschland geschlagen, Bethlen Gabor zum Frieden gebracht. Aber der Sieg des Kaisers und mehr noch die Art, wie er für die Durchführung der Gegenreformation ausgenützt wurde, bahnte einen Zusammenschluß der evangelischen Mächte England, Holland, Dänemark und Schweden an. Und überdies: die hochgestiegene Macht des Hauses Habsburg rief die alte Rivalität Frankreichs wach. Dessen Politik wird fortan geleitet von der überlegenen Staatskunst Richelieus, in dem die Gedanken Heinrichs IV. von der Einheit und Größe Frankreichs, von seinem Berufe als arbitre de la Chrétienté und von der Notwendigkeit des accroistre nos limites lebten. Schon 1624 hatten sich die Umrisse einer großen habsburgfeindlichen Koalition gezeigt, mit dem nächsten Jahre trat der Krieg in seine zweite Phase, die des sogenannten dänischen Krieges. Unter dem Eindrucke der Nachrichten über die von König Christian IV. von Dänemark, von Westen wie auch von Ungarn her drohenden Gefahren nahm [565] Ferdinand ein Anerbieten an, das ihm Wallenstein schon früher einmal gemacht hatte: er wolle ihm auf seine Kosten eine Armee anwerben, aufstellen und sie kommandieren. Anfang April 1625 ernannte der Kaiser den Friedländer zum "Capo über alles Ihro Volk, so dieser Zeit im Heiligen Römischen Reich und Niederland vorhanden oder dahinwärts geschickt werden möchte". Wenige Wochen später erhöhte er ihn zum Herzog von Friedland. Der aber war in seiner Art daran gegangen, "capite, rapite", wie er später sagte, zu werben und die Armee auf den Fuß zu bringen. Es war das ein großes Kreditgeschäft zwischen dem geldbedürftigen Kaiser und seinem General, der den Vorschuß, den "Verlag" für die Kosten, das Lauf- und Anrittgeld, wohl auch den ersten Monatssold bereitstellte. Indem er aber einen Teil des Vorschusses durch die Obersten, dann auch durch die Hauptleute übernehmen ließ, selbst nur die Garantien bietend, machte er auch die Offiziere zu Gläubigem des obersten Kriegsherrn und fesselte sie zugleich in ihren materiellen Interessen an die Person des Feldherrn. Zum ersten Male zeigte Wallenstein der erstaunenden Welt sein Organisationstalent: binnen wenigen Wochen hatte er dem Kaiser aus einem kleineren Teile alter und aus neugeworbenen Truppen ein Heer von 24 000 Mann aufgestellt und trat mit ihm am 3. September 1625 von Eger aus den Vormarsch ins Reich an. Wie aber sollte der Kaiser das Heer erhalten, wenn er es schon auf Vorschuß hatte aufstellen müssen? Auch da wußte Wallenstein längst Rat: der Krieg muß den Krieg ernähren. Schon im böhmischen Kriege hatte er das Heer durch Kontributionen der besetzten Gebiete erhalten. Orte und Einwohner dieser Gebiete hatten nicht nur wie früher für Quartier und Servis der Truppen, Holz, Licht und Salz aufzukommen, auch nicht bloß für ihren Unterhalt und für das Futter der Pferde, sondern überdies noch für ihren Sold. Kein Zweifel, für die unglückliche Bevölkerung bedeutete Einquartierung und Kontribution eine unerhörte Last, aber das so geregelte Vorgehen war immerhin noch besser als die reine Willkür der Plünderung. Und so konnte selbst ein Gegner Wallensteins anerkennen: "Und ob es auch das Reich hart bedrängte, so hat doch der Soldat und der Bauer beisammen gelebt." Freilich, Willkür und Roheit und Gewalttat blieben auch so nicht ausgeschlossen, und schon die Höhe der Kontributionen und die Härte, mit der sie eingetrieben wurden, die Dauer der Einquartierung – kurz, diese Manier, Krieg zu führen, hat zum Ruin Deutschlands mehr beigetragen als die direkten Schäden der Schlachten.
Das Jahr 1627 brachte große Erfolge. Im Juni hatte Wallenstein die in Schlesien eingedrungenen Feinde zurückgedrängt. Dann wandte er sich nach Niedersachsen gegen den Dänenkönig; von hier aus fegten seine Reiter unter seinem Feldmarschall Schlick durch Jütland. Ehe das Jahr zu Ende war, hatte Christian IV. auf dem Festlande kein Heer mehr. Nun schien der große maritime Plan feste Gestalt zu gewinnen, nach welchem ein Seebund der Spanier und ihrer Niederlande, des Kaisers und der Hansestädte dem Handel der Holländer in der Ostsee den Todesstoß versetzen und zugleich dem Kaiser eine Flotte in der Ost- und Nordsee schaffen sollte. Wallenstein hatte diese Pläne begeistert aufgegriffen – aber sie blieben in den Anfängen ihrer Ausführung stecken. Seit Februar 1628 führte er den stolzen Titel "General des ozeanischen und baltischen Meeres", doch wie wenig er der See mächtig war, zeigt der Heldenkampf der Stadt Stralsund, die sich gegen seine Angriffe erfolgreich verteidigte. Aber auch so sah sich Wallenstein und mit ihm sein Kaiser gar bald auf der Höhe der Erfolge. Das geschlagene Dänemark war im Frieden von Lübeck 1629 aus dem großen Ringen ausgeschieden. Wallenstein aber hatte sich selbst nicht vergessen. Seine militärischen Leistungen, mehr noch freilich die Notwendigkeit, seine hochgestiegenen Schuldforderungen zu begleichen, hatten Ferdinand schon 1627 bewogen, ihm das schlesische Herzogtum Sagan als böhmisches Lehen zu überlassen. Dann belehnte er ihn auch noch mit Mecklenburg, dessen Herzöge wegen Unterstützung des Dänenkönigs geächtet worden waren. So ward Wallenstein ein freier, ein unmittelbarer Fürst des Reichs und sah sich in eine Reihe gestellt mit den ältesten und vornehmsten Häusern. Staunend, bewundernd oder voll Haß und Neid sah die Welt seinen Aufstieg. Rätselhaft mußte ihr der Mann erscheinen – und rätselhaft ist er auch der Nachwelt geblieben. Ein eiskalter Verstand, ruhige, rechnerische Überlegung, [567] stets waches Mißtrauen und daher wortkarge Verschlossenheit, unnahbare fürstliche Würde und jähe fürchterliche Ausbrüche des Zornes ohne Halt, unbesonnene Offenheit und blindes Vertrauen; über alles hinwegstürmende Kühnheit im Planen und im Reden und bedachtsamste Vorsicht im Handeln; ein Schwanken zwischen Möglichkeiten, das die Entschlußkraft aufzuheben schien, und doch, wenn der sichere Erfolg winkte oder wenn es die unerbittliche Notwendigkeit forderte, nach langer Passivität plötzlich geballte Tatkraft, blitzschnelle Bewegungen, harte Schläge. Den Krieg wollte er lieber durch Praktiken als aperto Marte führen, im Felde wie in der Politik wollte er nichts hasardieren, und doch mußte er oft a la desperata gehen wie ein verzweifelter Spieler. Was im tiefsten Grunde vielleicht Unsicherheit war, erschien nach außen als unergründliches Wesen. Diesen Mann, dessen reizbare Nerven durch sein quälendes Leiden noch empfindlicher geworden waren, muß etwas Geheimnisvolles umgeben haben, das mehr Scheu und Furcht als Liebe zu wecken vermochte. Die wärmeren Farben des Gemütslebens fehlen seinem Seelenbilde nicht: die Züge der Liebe zu Frau und Kind, der Sorge für seine Diener – aber die Außenwelt mußte ihn so auffassen, wie er sich vor ihr gab: unnahbar, voll unstillbaren Ehrgeizes,
Die Sterne schienen seiner Lebensbahn noch weitere, höhere Ziele zu weisen. Er wollte die Waffen des Kaisers und Deutschlands gegen den Erbfeind der Christenheit, gegen die Türken kehren, die christlichen Völker des Balkans befreien und "mit Gottes Hilfe unserm Kaiser die konstantinopolitanische Krone in den drei Jahren aufs Haupt setzen". Das mochten phantastische Pläne sein, großartige Worte, wie sie Wallenstein gern gebrauchte. Lagen nicht andere hohe Ziele näher? Wallensteins Heer und seine Siege hatten Ferdinand eine Macht in Deutschland gegeben, wie sie selbst Karl V. kaum gehabt hat. Hätte sie nicht dazu benutzt werden können, gestützt auf die starke Armee, die kaiserliche Gewalt fest zu begründen, die Einheit des Reiches zu sichern, die verderbliche Libertät der Landesfürsten zu brechen? Es lag durchaus im Bereiche der Gedanken Wallensteins, den Kurfürsten ihre Macht zu nehmen; ihm sind Äußerungen wohl zuzutrauen wie die, man müsse die Kurfürsten mores lehren, es dürfe in Deutschland nur einen Herrn geben: den Kaiser, wie es ja auch in Frankreich und Spanien nur einen Herrn gebe. Aber dieser Kaiser hatte für so hochfliegende Pläne keinen Sinn; ihm lag vor allem am Herzen, die gewonnene Machtfülle zum völligen Siege des Katholizismus zu benützen. So erließ er am 6. März 1629 das sogenannte Restitutionsedikt. Dessen Durchführung hätte einen völligen [568] Umsturz der seit ungefähr drei Menschenaltern in Deutschland eingelebten konfessionellen Besitzverhältnisse bewirkt. Es waren nicht nur, wenn schon vorwiegend, die innen- und außenpolitischen Folgen, die Wallenstein voraussah und die ihn das Restitutionsedikt ablehnen ließen. Er sah die Dinge im Reich in dieser Hinsicht nicht anders an als in seinem Herzogtum: "Die Reformation halte ich für gut, die Violenzen für schlecht. Darum will ich, daß man discretamente procedire." Er, in dessen Heer, namentlich in dessen Offizierskorps der Protestant neben dem Katholiken focht, hatte vor dem Erlaß des Edikts warnend zu bedenken gegeben, ob nicht große Widerwärtigkeit, ja gar ein Religionskrieg sich daraus erregen könne. Er sah voraus, daß das Edikt dem Kaiser neue Feinde erwecken müsse, er sagte über die Protestanten in der größten Verzweiflung: "Wir haben nichts Gewisseres als einen Generalaufstand zu gewarten." Aber zur vollen Durchführung des Restitutionsediktes ist es nicht gekommen, teils wegen der Widerstände, die es erweckt hat, teils und vor allem deshalb, weil dem Kaiser das Instrument, dessen er zur Durchführung bedurft hätte, aus der Hand gewunden wurde. Längst schon war durch ganz Deutschland (bei Protestanten wie bei Katholiken) eine einzige Klage über die Bedrückung der Reichslande durch die kaiserliche Soldateska, über Wallensteins gewalttätiges Regiment erschollen. Gerade die katholischen Kurfürsten, Maximilian von Bayern voran, drangen auf Reduktion des Heeres und Entfernung des Feldherrn. Daß es hierbei nicht bloß um die Abstellung von Übergriffen und Mißständen ging, sagten die Kurfürsten selbst: den Anschlägen Wallensteins sei zu entnehmen, daß "ein neuer unhergekommener Dominatus zu endlicher Eversion der alten löblichen Verfassung eingeführt werden solle". Aber nicht nur den Kurfürsten war der Kaiser viel zu mächtig. Längst schon war die französische Diplomatie tätig, um eine Koalition gegen das deutsch-spanische Haus Habsburg zustande zu bringen, mit dem Frankreich in Italien wegen der Mantuaner Erbfolge in neuen schärfsten Gegensatz geraten war. Auch hier hatte Wallenstein klar und deutlich die ringsum aufsteigenden Gefahren erkannt. Die Befürchtungen vor Schweden hatten ihn darauf dringen lassen, den dänischen Krieg durch einen glimpflichen Frieden zu beenden; aus Sorge vor einem Kriege mit Frankreich hatte er lange dem Mantuaner Abenteuer widerstrebt; aus seiner Mißbilligung des Restitutionsediktes hatte er kein Hehl gemacht. In solcher Lage kam es im Juni 1630 zum Kurfürstentage von Regensburg. Für Ferdinand war der Hauptzweck dieses Tages, die Wahl seines gleichnamigen ältesten Sohnes zum deutschen Könige in die Wege zu leiten und die Hilfe des Reiches zu gewinnen gegen die Holländer wie gegen Franzosen und Schweden. In alledem arbeitete ihm Richelieu entgegen, der schon längst bemüht war, die Generalstaaten, England, Schweden und Venedig in ein Kriegsbündnis gegen den Kaiser zu bringen und eine bayerisch-französische Allianz herzustellen. Er hatte eines der geschicktesten und gefährlichsten Werkzeuge seiner Diplomatie, [569] den Kapuzinerpater Josef, die "graue Eminenz", nach Regensburg gesendet, der in seinem Fanatismus am liebsten auch noch die Türken ins Feuer gebracht hätte. Ja, auch die römische Kurie hatte der fromme Kaiser gegen sich; denn Papst Urban VIII. trieb als Herr des Kirchenstaates italienische Politik. So stand der Kaiser vor einer schweren Wahl: erfüllte er die Forderungen der Kurfürsten (es waren nur die vier katholischen erschienen), verkleinerte er die Armee und entließ er Wallenstein, so gab er die Stellung auf, die er erreicht hatte und beraubte sich des Instrumentes seiner Macht; lehnte er sie aber ab, dann vernichtete er die Aussichten seines Sohnes und trieb die Kurfürsten in die Arme Frankreichs. In solchen Zweifeln bestimmte, scheint es, der Mann seinen Entschluß, der nach zeitgenössischem Urteil an Ferdinands Hofe "alles regierte" und noch vor kurzem zu Wallenstein in guten Beziehungen gestanden hatte, der kaiserliche Beichtvater P. Lamormaini. Dieser setzte nach der Ansicht des Königs von Spanien letzten Endes die Entlassung Wallensteins durch. Das Opfer war vergeblich gebracht; weder in der Wahlfrage noch in den Friedensverhandlungen mit Frankreich erreichte Ferdinand einen Erfolg. Wie nahm Wallenstein seine Absetzung auf? Man war nachher erstaunt, wie leicht er "dem kaiserlichen Befehl sich bequemt". Die kaiserlichen Räte, die ihm den Absetzungsbeschluß zu überbringen hatten, fanden beim Herzog – er stand damals, Ende August, in Memmingen – einen überraschend freundlichen Empfang: man habe ihm keine angenehmere Nachricht bringen können; der Rat, den man dem Kaiser gegeben habe, hätte nicht besser sein können. Auch sonst ließ er sich vernehmen: Was man in Regensburg konkludiert habe, sei ihm vom Grund seiner Seele lieb, dieweil er dadurch aus einem großen Labyrinth kommen werde. Man kann es billig bezweifeln, daß das seine wahren Gefühle waren. Jedenfalls mag er in dem Bewußtsein geschieden sein, daß sein Abgang in einem für den Kaiser und für die Liga verhängnisvollen Zeitpunkte erfolge. König Gustav Adolf von Schweden hatte seinen Fuß auf deutsche Erde gesetzt und seinen Feldzug gegen Kaiser und Liga begonnen. Wallenstein war von Memmingen nach Böhmen gezogen, wo er in der düster-feierlichen Pracht seines Palastes in Prag oder in seiner Residenzstadt Jitschin prunkvoll Hof hielt. Gustav Adolf hatte Pommern erobert, mit Frankreich und nachher auch mit den Generalstaaten seine Subsidienverträge geschlossen, die seiner Kriegsführung die nötigen Geldmittel sicherten. Die Flammen des von Tilly eroberten Magdeburg entzündeten die Gemüter der deutschen Protestanten zu hellem Zorn; Gustav Adolf aber hatte vorher die kaiserliche Oderarmee zertrümmert; von der Oder-Warthe-Linie her waren mit Schlesien die andern Lande des Kaisers bedroht. Es ist dem Schwedenkönige gelungen, den Kurfürsten von Brandenburg und schließlich auch den stets kaisertreuen Johann Georg von Sachsen zum Anschluß zu zwingen. Und Wallenstein? Betrachtete er wirklich völlig unbeteiligt jenes große [570] Labyrinth? Fühlte er sich wirklich "vom Kaiser im wenigsten nicht offendiret"? Wird von ihm nicht der zornige Ausspruch berichtet, er habe es dem Kaiser nicht vergessen wollen, "daß er einen Cavallier affrontired hab"? Aus dem Dunkel, in welches Wallenstein sein Verhalten und seine Pläne hüllt, läßt sich nur so viel in Umrissen erkennen, daß er die verlorene Stellung wiedergewinnen, ja über sie hinauswachsen wollte. Zwei Wege boten sich ihm hierzu: gegen den Kaiser zu gehen und gegen jene, die ihn in Regensburg gestürzt hatten – oder zu warten, bis die Not den Kaiser zwinge, seinen entlassenen Feldherrn zurückzuholen, und nun bessere Sicherstellung, noch größere Vollmachten, noch reichere Belohnungen zu erwirken. Und da entsprach es dem stolzen Selbstgefühl Wallensteins, seinem Ehrgeize und Machttrieb ebenso wie seiner stetig wachsenden inneren Unsicherheit, daß er keinen dieser Wege zu Ende ging, sondern letzten Endes seinen Standpunkt zwischen beiden Machtgruppen wählen wollte, um sich über beide zu stellen und die Lösung von sich aus zu bestimmen. Dabei brachte es die Lage mit sich, daß seine Bedeutung auch ohne sein Zutun stieg. Die Absetzung hatte die Verbindung des Herzogs von Friedland mit dem Wiener Hofe nicht abgerissen. Ferdinand hatte wiederholt rätliche Gutachten seines "hochgeborenen lieben Ohaimbs" Wallenstein erbeten, dieser sie erteilt. Aber schon liefen von Wallenstein die Fäden auch zur Gegenseite. Die Verbindung ging über die böhmischen Exulanten; diese standen, wie ihr Haupt, der alte Graf Matthias Thurn, in schwedischen Diensten oder weilten am kursächsischen Hofe, voll der Hoffnung, daß die Wechselfälle des Krieges ihnen die verlorene Heimat zurückgeben werde, mit der sie den Zusammenhang nie verloren hatten. Bis in den Verwandtenkreis Wallensteins reichten ihre Beziehungen; die Schwester der Herzogin war die Gemahlin des böhmischen Grafen Adam Erdmann Trčka, dessen Schwester mit ihrem Gemahl Wilhelm Kinsky zu Dresden im Exil lebte. Als Unterhändler diente jener Sezyma Raschin, der dann nach der Katastrophe durch seine Enthüllungen sich die Rückkehr in die Heimat erkaufte und der Nachwelt so einen freilich nicht klaren Einblick in das verworrene Geflecht der Verhandlungen Wallensteins mit den Gegnern des Kaisers ermöglichte. Aus diesem Kreise war dem Schwedenkönige schon im Frühling und Sommer 1631 zur Kenntnis gebracht worden, Wallenstein sei geneigt, sich am Kaiser zu rächen, wenn ihm Gustav Adolf die nötigen Truppen zur Verfügung stellte. Mit Hilfe des Schwedenkönigs wolle er sich der Länder des Kaisers bemächtigen, diesen nach Italien vertreiben – wenn die rechte Zeit gekommen sei. Waren das Übertreibungen, sei es des unbedachten Zornes Wallensteins, sei es des Berichtes Sezymas? Der Schwedenkönig soll zugesagt, ja sich erboten haben, Wallenstem zum Vizekönig von Böhmen zu machen. Eine zweite Verbindung ging zu dem Führer der kursächsischen Armee, Hans Georg von Arnim, einem lutherischen brandenburgischen Adeligen, welcher früher in schwedischen, dann unter Wallenstein in kaiserlichen Diensten gestanden hatte, [571] schließlich in kursächsische Dienste getreten war. In vielem ein echter Sohn seiner Zeit stand dieser "deutsche Träumer" in manchem fremd in ihr. Auch er hat nach der Weise der Kondottieri den Kriegsherrn gewechselt. Aber ihn erfüllte – und das hob ihn über die deutschen Gestalten jener Art hoch hinaus – letztlich ein tiefes, warmes deutsches Empfinden, ihn leitete ein hohes völkisches Ideal: über die Glaubensspaltung hinweg dem bedrängten deutschen Vaterlande ohne und gegen die Fremden Friede und Freiheit wiederzugeben. In ihm lebte der Gedanke der sogenannten dritten Partei, in der sich die evangelischen Stände eine starke Stellung zwischen der großen kaiserlich-ligistisch-spanischen und der schwedisch-französischen Mächtegruppe schaffen sollten. Mit Arnim hatte Wallenstein früher in besten Beziehungen gestanden und war auch nach seiner Entlassung mit ihm in lebhafter Korrespondenz geblieben. Mochte man sich, wie auf seiten der böhmischen Emigranten der sanguinische Thurn, wohl Hoffnungen machen, Wallenstein zu gewinnen – die Schweden blieben übrigens mißtrauischer –, so sah man sich bald schwer enttäuscht. Wallenstein trat wieder in die Dienste des Kaisers, freilich, um die Pläne seiner Rache am Hause Österreich um so sicherer durchführen zu können. In diesen Glauben suchte er Ende November 1631 Arnim und die Emigranten zu wiegen. Daß er das wolle, hatte er in den letzten Wochen durch sein Verhalten gegen die kaiserlich-ligistische Armee in Niedersachsen bewiesen: obwohl er die flehentlichen Bitten des alten Feldherrn Tilly mit freundlichen Zusagen beantwortet hatte, sabotierte er doch die Verpflegung des Heeres und trug so zu seiner Zerrüttung bei. Am 17. September 1631 siegte denn auch Gustav Adolf bei Breitenfeld in der ersten großen Schlacht des königlich schwedischen in Deutschland geführten Krieges, wandte sich dann nach Süden und trug seine siegreichen Fahnen bis in das Mainzer Erzbistum und in die Pfalz. Das nun rief erst recht die französischen Waffen an den Rhein. Die Sachsen aber waren unter Arnim in Böhmen eingedrungen; Mitte November war Prag in ihren Händen. Unter solchen Schlägen hatten sich der entsetzten Wiener Hofburg die Folgen der Entlassung Wallensteins immer bedrohlicher vor Augen gestellt. Nun erblickten nicht nur seine alten Anhänger in seiner Rückberufung die einzige Rettung, nicht ohne daß es an warnenden Stimmen fehlte, der stolze Herzog könne sich der wiedergewonnenen Macht bedienen, um sich am Kaiser zu rächen. Und dieser entschied sich für Wallenstein. Der aber ließ sich lange bitten, auch nur zu Verhandlungen nach Wien zu kommen. Schließlich ließ er sich wenigstens dazu herbei, sich auf drei Monate der kaiserlichen Armee anzunehmen und sie auf einen Stand von 40 000 Mann zu bringen. Was hatte ihn bewogen von der "heimlich prakticirten intelligence" mit des Kaisers Gegnern abzustehen? War diese wirklich durch eine unvorsichtige oder absichtliche Indiskretion des Heißsporns Thurn am Wiener Hofe bekanntgeworden, so daß Wallenstein nichts übrigblieb, als sich beim Kaiser "realiter durch Annehmung des Generalats zu [572] purgiren"? Wollte es sein Stolz nicht ertragen, daß Gustav Adolf ihm nicht nach Wunsch entgegengekommen war oder war ihm dieser zu mächtig geworden für die Stellung, die er selbst sich erträumte; amor et dominium,so sagte er gern, non patitur socium, und das dominium wollte er mit dem Schwedenkönig nicht teilen, denn: zwei Hahnen auf einem Mist vertragen sich nicht. Jedenfalls – die Werbungen begannen und Wallenstein erwies sich wieder als der Schöpfer kühner Heere. Und als es so weit war, war die Not noch höher gestiegen: mit der Schlacht bei Rain am Lech am 15. April 1632 verlor Maximilian von Bayern nicht nur seinen Feldherrn Tilly, sondern auch sein Land. Gustav Adolf stand in München – der Weg donauabwärts wies nach Wien. Wenn Wallenstein nun wirklich das Kommando über die von ihm aufgestellte Armee nicht übernahm, wer sollte, wer konnte sie an seiner Stelle führen? Nach neuen, für den Kaiser demütigenden Verhandlungen nahm Wallenstein am 23. April das Oberkommando wieder an. Aber unter welchen Bedingungen! Der Wortlaut der Göllersdorfer Abmachungen, wenn solche schriftlich niedergelegt wurden, ist nicht bekanntgeworden. Wenn auch der Kaiser auf seine Befehlsgewalt nicht ausdrücklich verzichtete, so bekam Wallenstein doch den Oberbefehl über das kaiserliche Heer ganz in seine Hand. Die Offiziere bis zu dem Obersten ernannte er, bei der Besetzung der hohen Kommandostellen fiel sein Vorschlag ins Gewicht. Der Sicherstellung der Armee sollten Steuern in den Erblanden dienen; über Konfiskationen von Rebellengütern und heimgefallenen Gütern in Böhmen und im Reich verfügte der Feldherr. Schon im Dezember hatte Ferdinand das für ihn nicht kleine Zugeständnis gemacht, daß sein Beichtvater und die Hofgeistlichen Wallenstein in seinem Dienst und in anderen Sachen nicht hindern sollen, hatte vielmehr zugesagt, ohne besondere Instruktion alles seiner guten "Dexterität, Treue und Fleiß" anheimzustellen. Das fiel wohl namentlich ins Gewicht bei der Befugnis zur Einleitung und Führung von Sonderfriedensverhandlungen mit Kursachsen, denen dann noch solche mit Kurbrandenburg und anderen Reichsständen folgen konnten. Und die Belohnung Wallensteins war natürlich auch nicht gering bemessen. Für Güter, die er aus der Konfiskationsmasse gekauft hatte, war er dem Fiskus noch 400 000 Gulden schuldig, sie wurden ihm erlassen; sollte er nicht wieder in den Besitz des verlorenen Herzogtums Mecklenburg kommen, dann hätte ihn der Kaiser mit einem Land gleichen Wertes und gleichen Ranges, also einem reichsunmittelbaren Fürstentum, zu entschädigen. Einstweilen wurde ihm das Herzogtum Groß-Glogau, damals ein böhmisches Lehen, pfandweise überlassen; weitere Landzuwendungen scheinen ihm für den Fall des Sieges in Aussicht gestellt worden zu sein. So groß, ja unerhört die Machtbefugnisse waren – eben um ihrer Größe willen bargen sie Gefahren in sich, für den Kaiser wie für Wallenstein. Unter dem Druck der höchsten Not hatte Ferdinand eingewilligt in der letzten Voraussetzung, daß seine Interessen, die seines Hauses und vor [573] allem die seiner Kirche gewahrt blieben. Aber würde Wallensteins Eigenwillen sich davor hüten, die so weit gezogenen Grenzen seiner Vollmachten zu respektieren? Der "General-Oberste-Feldhauptmann" war mit der Armee ins Feld gezogen. Schonend, unter ständigen Verhandlungen mit Arnim, um mit ihm zu einem Separatfrieden zu gelangen, drängte er die Sachsen aus Böhmen hinaus; am 25. Mai war Prag in seinen Händen. Dann rückte er über Eger ins Reich, verband seine Armee mit der Maximilians von Bayern, und Mitte Juni schon hatte er bei Nürnberg seinen großen Gegner Gustav Adolf vor sich. In der stark befestigten Stellung bei der "Alten Schanze" und bei Zirndorf erwies Wallenstein die Überlegenheit seiner Ermattungstaktik. Die gewaltigen Sturmangriffe der Schweden wurden blutig abgeschlagen. Die Friedensangebote des Königs lehnte der Herzog unter Berufung auf mangelnde Vollmacht ebenso ab, wie er auf einen weiteren Versuch, ihn selbst durch große Versprechungen zu gewinnen, nicht einging. Am 18. September brach Gustav Adolf, dessen Heer durch Seuchen und Proviantmangel schwer litt, sein Lager ab. Wallenstein wendete sich nach Sachsen und zwang so den Schwedenkönig, ihm zum Schutze des Kurfürsten dahin zu folgen. Bei Lützen kam es am 16. November zur Schlacht, die nicht nur durch den Tod Gustav Adolfs dem Kriege, sondern auch durch ihre weiteren Auswirkungen der Stellung und Haltung Wallensteins eine neue Wendung gab. In Wien hat man bald erkannt, daß die Viktorie von Lützen, nach der Wallenstein unter Verlust seiner Artillerie vom Schlachtfelde gezogen war, in der Hauptsache doch nur auf dem Tode des Schwedenkönigs beruhe. Wallensteins militärisches Ansehen ist dadurch nicht gestiegen, und als er gar die Armee in die Winterquartiere führte, da hatten die kaiserlichen Länder, besonders Böhmen, die Last der Einquartierungen, der Konfiskationen und der Kontributionen zu tragen, von denen auch die höchsten Kreise nicht verschont blieben. Fünf Monate residierte nun der Herzog in seinem prächtigen Prager Palaste. Er hat in dieser Zeit blutig Gericht gehalten über jene Offiziere, die in der Lützener Schlacht versagt hatten, er hat vor allem die Armee wieder schlagfertig gemacht und auf einen Stand von 60 000 Mann gebracht. Mit einem kleineren Teil des Heeres ließ er durch Feldmarschall Holk Böhmen gegen Meißen und Franken hin decken, er selbst zog mit dem Großteil nach Schlesien, wo die Sachsen unter Arnim, die Brandenburger und ein schwedisches Korps unter dem Grafen Thurn standen. Man hätte erwarten sollen, daß Wallenstein seine weit überlegenen Kräfte zu einem raschen Schlage benützen werde. Aber Ende Mai, schon in Glatz stehend, befahl er Holk, noch an den Grenzen Böhmens zu verbleiben, er hoffe, daß er mit dem Feind in Schlesien auf die eine oder andere Weise in kurzem fertig sein würde, und dann würden sich die Dinge im Reich und anderswo bald ändern. Der Verlauf der nächsten Monate zeigte, was Wallenstein unter der anderen Weise verstand: nicht Kampf, sondern wiederholt erneuten Waffenstillstand [574] und Unterhandlungen über den Frieden. Und zwar Unterhandlungen nicht nur mit den Sachsen, wozu der Herzog ausdrücklich befugt war, und Unterhandlungen über einen Frieden, wie ihn der Kaiser sicherlich nicht schließen wollte. Nicht nur mit Arnim, sondern auch mit den böhmischen Emigranten und den Schweden sah ihn der Sommer 1633 in Verbindung. Lockend wurde ihm wieder die böhmische Königskrone vor Augen gehalten, und schon wurden auch, wenn nicht von ihm, so doch von ihm nahestehender Seite Verhandlungen mit den Franzosen für ihn geführt, in denen wieder die böhmische Krone als Lohn für Wallensteins Abfall vom Kaiser ihre Rolle spielte. Wieviel namentlich bei den weitestgehenden Plänen auf Wallensteins Initiative zurückzuführen sein mag, läßt sich mit Bestimmtheit nicht sagen, so viel aber hat man zu erkennen geglaubt, daß es ihm vor allem darum ging, die sächsischen und brandenburgischen Waffen zu vereinigen mit dem von ihm geführten Heere zu doppeltem Zwecke: zur Herstellung eines Reichsfriedens, wobei natürlich seine Stellung und seine sicher nicht geringen Ansprüche entsprechend gewahrt sein mußten, und zur Verdrängung der Fremden, vor allem der Schweden, vom Boden des Reiches. Ein solcher Frieden aber war nur zu erzielen durch Preisgabe des starren konfessionellen Standpunktes, also des Restitutionsediktes, durch ein Zurückgehen auf die Verhältnisse vor 1618. Und so sehr auch am Wiener Hofe Stimmen für den Frieden laut wurden, selbst für einen mittelmäßigen – einen solchen Frieden, wie er hier geplant war, würden weder die Gewissensräte noch die politischen Ratgeber Ferdinands annehmen wollen, ihm würde sich dieser im Bunde mit Spanien und Bayern widersetzen. Dann sollte der Friede "ohne Respekt einiger Personen", also auch gegen den Kaiser erzwungen werden. Daß es in einem solchen Kampfe um seine Stellung, ja seine Existenz gehen konnte, hat sich der verwegene Rechner nicht verhehlt; für diesen Fall sollten die zu der böhmischen Emigration, zu den Schweden und zu den Franzosen führenden Fäden den nötigen Rückhalt sichern. Aber Wallensteins höchst widerspruchsvolles Verhalten, das die unterhandelnden Parteien immer wieder vor neue Situationen stellte, das sich nie zu eindeutigen, greifbaren Verpflichtungen herbeiließ, das sich immer, wie er selbst sagte, eine Zwickmühle behalten, sich die Entscheidung immer bis zuletzt sparen wollte, hat nicht nur jene Parteien mit höchstem Mißtrauen gegen ihn erfüllt, sondern auch am Wiener Hofe und anderwärts Zweifel an seiner Loyalität erregt. Wohl nahm er am 12. Oktober in einer plötzlichen Wendung die schwedische Armee in Schlesien samt ihrem Kommandanten Thurn bei Steinau an der Oder gefangen. Doch als er den "alten Hauptrebellen" freiließ, als er seinen Sieg, der so reiche Aussichten bot, nicht ausnützte, ja schließlich seine Armee nach Böhmen führte, als man bald wieder von neuen Verhandlungen hörte, da gewann der Verdacht gegen ihn neue Nahrung. Es mußte das Vertrauen des Kaisers zu ihm vollends erschüttern, als durch seine hartnäckige Weigerung, dem gehaßten [575] bayerischen Kurfürsten Hilfe zu leisten, Regensburg an Herzog Bernhard von Weimar am 14. November verlorenging und Österreich sich vom feindlichen Einfall bedroht sah. Als aus seinem mit großen Worten angekündigten Vormarsch gegen Bernhard von Weimar nur eine Kavalkade wurde, die er am 3. Dezember schon in Furth nach Böhmen umkehren ließ, weil er dieses für bedroht erklärte, als er namentlich dem "ernstlichen kategorischen Befehl" des Kaisers, die Offensive gegen die von der Donau her drohende Gefahr doch noch zu ergreifen, in Pilsen den höheren Kommandierenden vorlegen ließ zur Begutachtung seiner Durchführbarkeit, da mußte dies alles erst recht den Anschein erwecken, den Ferdinand vermieden wissen wollte, als ob er gleichsam einen corregem an der Hand und in seinem eigenen Lande keine freie Disposition mehr übrig habe. Vergeblich, daß Wallenstein darauf hinwies, der Feldzug im Winter müsse die Armee ruinieren, in deren Konservierung das ganze Heil des Kaisers ruhe, vergeblich seine wiederholte eindringliche Mahnung, Frieden zu machen – "sonst wird alles unsererseits verloren sein". Seine Gegner sahen in alledem nur neue Beweise für die Berechtigung ihres Verdachtes. Durch weit übertriebene Gerüchte und durch Verleumdungen gehässigster Art, durch offene Flug- und geheime Denkschriften über die Gefahren, mit denen Wallensteins Pläne das kaiserliche Haus und die katholische Kirche bedrohten, wurde der Kaiser geängstigt und in seinem Gewissen bedrängt. Als schließlich auch die Spanier, deren Plänen in Deutschland Wallenstein aus berechtigter Sorge vor dem Eingreifen Frankreichs seine Unterstützung versagte, ihn fallen ließen, war der Ring seiner Gegner am Hofe, der Kronprinzenpartei, der Jesuiten, des Kurfürsten von Bayern geschlossen. Ende des Jahres sahen sie sich am Ziele: der Kaiser faßte im geheimen den Entschluß, dem Herzog von Friedland die Kriegsdirektion und das Generalat zu nehmen. In jenen Tagen hatte auch Wallenstein die Entscheidung getroffen, der er solange hatte ausweichen wollen. Er war sicher nicht ohne Kenntnis dessen geblieben, was man in Wien gegen ihn vorbrachte und vom Kaiser erwartete. Wallenstein erkannte klar, was ihm drohe: die neuerliche Absetzung. Und nun erzwang die Notwendigkeit von dem noch immer Schwankenden die Ausführung dessen, was er in seinen Plänen als eine der frei wählbaren Möglichkeiten erfaßt hatte: den Bruch mit dem Kaiser, den Anschluß an dessen Feinde. Zwei Aufgaben erwiesen sich nun als dringend. Mit den beiden protestantischen Kurfürsten, aber auch mit Schweden und mit Frankreich mußte nun das Einvernehmen erzielt werden. Deshalb wurden eifrige Verhandlungen nach allen Seiten gepflogen, deshalb fanden sich Anfang Januar 1634 Kinsky und Herzog Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg in Pilsen bei Wallenstein ein; mit besonderem Verlangen erwartete dieser Arnim, denn noch immer lag ihm an einem Abschluß mit diesem am meisten. Dann aber und vor allem galt es, die Grundlage zu prüfen, auf der das ganze Gebäude seiner Pläne ruhte; Wallenstein mußte sich vergewissern, ob ihm die Armee auf den Wegen folgen werde, die er sie nun führen wollte. Diesem Zweck diente der [576] Konvent der Generale und hohen Befehlshaber, die der Feldherr vom 11. bis 13. Januar 1634 in Pilsen um sich versammelte. Es sind ihrer 49 gewesen. Die Schilderung, die Feldmarschall Ilow über das Verhalten des Hofes gegen die Armee gab, erbitterte die Versammelten ebenso, wie sie besorgt wurden durch die Mitteilung, der Herzog sei entschlossen, wegen der Vernachlässigung der Armee und wegen der ihm widerfahrenen beleidigenden Behandlung seine Stelle niederzulegen; denn für die ausständigen Vorschüsse, welche die Offiziere zu fordern hatten, bot ihnen ja doch eben der Herzog und sein Kredit die genügende Sicherheit. Erregt ließen sie Wallenstein bitten, bei der Armee zu bleiben. Das wurde ihnen zugesagt, wogegen sie den Revers unterzeichneten, in welchem sie sich an Eides Statt verpflichteten, mit Gut und Blut treu und ehrlich bei ihrem Feldherrn auszuhalten. Daß aber dieses Instrument ihn der Armee nicht auf alle Fälle auch gegen den Kaiser versichern könne, zeigte sich schon am nächsten Tage: Bedenken, die den Obersten gekommen waren, mußte er durch die Erklärung beschwichtigen, er plane nichts gegen Kaiser und Reich. Mit Besorgnis hatte man in der Hofburg dieser Offiziersversammlung entgegengeblickt. Die Armee, das wußte man, war zum großen Teil auf Wallensteins Kredit, auf seine Kosten geworben und ausgerüstet. Würde sie meutern, wenn er abgesetzt würde, würde sie ihm folgen, auch wenn er sie gegen den Kaiser führte? Was Wallenstein mit dem Pilsener Reverse versucht hatte, die höheren Kommandierenden fest in die Hand zu bekommen, das war dem Kaiser bereits insofern gelungen, als er sich der Treue wichtiger Generale versichert hatte, darunter solcher wie Piccolomini, Gallas und Aldringen, denen der Feldherr fest vertraute. Fortan wirkten dessen Maßnahmen die geheimen Gegenzüge seiner Generale entgegen. Die Nachrichten über den Pilsener Konvent erweckten die schwersten Befürchtungen: das war, so stellten sich die Pilsener Vorgänge in Wien dar, der Ausbruch einer Empörung, bestimmt, das Haus Habsburg zu verderben und seine österreichischen Länder unter die Verschwörer zu verteilen. Aber nicht schon auf Grund dieser und noch stärker übertriebener Alarmnachrichten unternahm Ferdinand seine nächsten Schritte, sondern erst, als ihm eine Kommission, die er aus dreien seiner vertrautesten Räte, keineswegs Feinden Wallensteins, gebildet hatte, die Schuld des Herzogs und der Berechtigung der äußersten Maßregeln dartat. Nun erst und natürlich auch nach Einholung des Gewissensrates des Beichtvaters erließ am 24. Januar Ferdinand das zunächst geheimgehaltene Absetzungspatent. Am gleichen Tage aber erging an die ins Vertrauen gezogenen Generale der Befehl, Wallenstein und seine vornehmsten Mitverschworenen womöglich gefangen nach Wien einzuliefern oder als überführte Schuldige zu töten. Und so weit ging die beiderseits meisterhaft geübte Kunst des Dissimulierens, daß der Kaiser bis zum 14. Februar mit seinem insgeheim abgesetzten Feldherrn in Korrespondenz blieb. Mittlerweile aber waren die Verhandlungen, die Wallensteins Hilfe von außen sichern sollten, nicht weiter gediehen. Es zeigte sich, daß das Mißtrauen, das Wallen- [577] stein durch sein vieldeutiges Verhalten so lange genährt hatte, sich so rasch nicht beseitigen ließ, wie er es nun wünschen mußte. Nicht nur die französische Diplomatie, die einen weitgehenden Vertragsentwurf für Wallenstein fertiggestellt hatte, zweifelte selbst noch in jenen Wochen, ob er nicht unter dem Vorwande der Unterhandlungen seine Verstellung und seine Ränke verberge, ja hierbei im Einverständnis mit dem Kaiser handle. So kam er mit keiner Seite zum Abschluß. Namentlich beunruhigte ihn das Ausbleiben des sehnlich erwarteten Arnim. Um so mehr war er bestrebt, sich auch jetzt noch seine Zwickmühle offen zu halten. Mit dreißig höheren Offizieren, die am 19. Februar in einem Protokoll sich neuerdings bereit erklärten, bei ihm aushalten zu wollen, unterfertigte er andern Tages den "zweiten Pilsener Schluß", worin er versicherte, es sei ihm nie in den Sinn gekommen, etwas gegen den Kaiser oder die Religion zu unternehmen; für den Fall, daß er dem zuwider handeln würde, entließ er die Offiziere jeder Verpflichtung gegen seine Person. Ähnliche Erklärungen ließ er mit erneuten Rücktrittsangeboten nach Wien gelangen zu einer Zeit, als hier bereits das Proskriptionspatent gegen ihn erlassen war. Das Verhalten Gallas', Piccolominis, Aldringens und anderer Offiziere enthüllte ihm schließlich das Maß seiner Verblendung, die Aussichtslosigkeit seiner Lage. [578] Was dann in Pilsen erfolgte, war Zusammenbruch und Auflösung. Es gewährt einen bedeutsamen Einblick in Wallensteins tiefstes Denken, daß selbst in diesen schwersten Stunden dem von Krankheit Gequälten das Bild des verlorenen Friedens vor der Seele stand. Den letzten Zug nach Eger trat er mit wenigen Truppen an, nicht mehr als der heeresgewaltige Bündner der Feinde des Kaisers, sondern auf der Flucht vor den kaiserlichen Verfolgern. Als er am 24. in Eger einlangte, zog mit ihm das Verhängnis durch das Tor. Denn der Stadtkommandant Gordon, der
Noch vierzehn lange Jahre dauerte der entsetzliche Krieg. Da endlich kam dem aus tausend Wunden blutenden deutschen Volke der Tag des Friedens, den Wallenstein durch alle Nebel seines Ehrgeizes und seiner verräterischen Pläne einst erschaut und den er, sicherlich nicht in reiner Selbstlosigkeit, erstrebt hatte: der Friede des (nun freilich verstümmelten) Reiches auf der Grundlage des Gleichgewichtes gleichberechtigter christlicher Bekenntnisse.
 |