
[329]
Die Siebenbürger
Sachsen
Fritz Heinz Reimesch
Die gewaltige Flut der großen deutschen Ostbewegung im Anbeginn
unseres Jahrtausends trieb zwei Wellen weitab - die Balten nach dem
Nordosten, die rheinfränkischen Siedler nach dem Südosten in das an
anmutigen wie heroischen Landschaftsbildern überreiche
Siebenbürgen. Dies geschieht um die Mitte des 12. Jahrhunderts.
Auf welchem Wege die Kolonisten nach dem kaum bewohnten, urwaldbedeckten
Karpathenlande zogen, das einst Goten und Gepiden Heimat war, ist
ungewiß, doch wir kennen die Motive, aus denen heraus die Menschen von
Mosel und Saar, vom Hunsrück und aus den luxemburgischen
Wäldern, wohl auch vom Niederrhein in die Ferne
getrieben wurden - Sehnsucht nach Freiheit und eigener Scholle, denn die
Heimat war übervölkert, das altgermanische Recht der freien
Nutzung von Wald, Wasser und Weide, der unantastbaren Allmende, wich dem
römischen Rechtsbegriff, nach dem der Boden zu einer Handelsware
entwürdigt wurde. Das Kolonistenrecht, das vom Ungarnkönige
Geisa II. und öfters von seinen Nachfolgern feierlichst beschworen
und auch verbessert wird, ist uns in dem Original, das König
Andreas II. aus dem Anbeginn des 13. Jahrhunderts beschworen hat,
erhalten, und wer die Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen liest, wie
sie von den beiden Bischöfen Georg Daniel und Friedrich Teutsch
geschrieben wurde, der kann durch die abgelaufenen acht Jahrhunderte stets den
Willen der Kolonisten erkennen, das alte Recht nicht schmälern zu lassen.
Aus dem codifizierten Recht der Deutschen in Siebenbürgen spricht der
Wille der Siedler, ihr Leben und ihre Arbeit einer großen Idee
unterzuordnen, nämlich der Gemeinschaft oder wie es in der Mundart
lautet: "de Gemin".
Es ist gerade für unsere Zeit, die so stark nach Siedlung schreit, in der sich
kollektivistische Gedankengänge stark in den Vordergrund drängen,
von Wichtigkeit zu sehen, wie sich in früheren Jahrhunderten deutsche
Auslandssiedlungen gebildet haben und welche Kräfte mithalfen, sich
selbst in größten äußeren Kämpfen gegen
hundertfache Übermacht durchzusetzen. Die Gemeinschaft war für
die ersten Jahrzehnte der Landnahme und der Rodung selbstverständlich,
denn der Einzelsiedler hätte in der wilden Umgebung, die von Anfang
erfüllt war von Kampf gegen Mensch und Tier, nichts ausrichten
können; nicht einmal eine Sippensiedlung hätte das vermocht. Nur
"de Gemin" konnte den Urwald bewältigen, nur die Gemeinschaft
vermochte gleichzeitig zu kämpfen und Kulturgüter zu errichten. Der
bewegliche Franke entwickelt im Waldrand sehr bald ein starkes
Gleichheitsgefühl, das jedoch nicht mit der heutigen Demokratie
zu verwechseln ist. Er beseitigt nach langwierigen harten inneren Kämpfen
alle Versuche reich und mächtig gewordener Volksgenossen, die einen
Adel innerhalb des deutschen Kolonisationsgebietes, des sogenannten [330] Königsbodens,
aufrichten wollten. Selbst das Privateigentum an Grund und Boden, mit
Ausnahme der Hofstelle, wird Jahrhunderte hindurch nicht geduldet, die
zugewiesene Ackerscholle wird von Zeit zu Zeit gleichmäßig neu
verteilt. Wald, Weide und Wasser bleiben Gemeinschaftsbesitz bis auf den
heutigen Tag. Die nur auf sich selbst gestellten deutschen Grenzwächter,
die sich dem Könige gegenüber zu ganz bestimmten, das Deutschtum
ehrenden militärischen Diensten
verpflichteten - sie stellten 500 Reiter als Vortrab des königlichen
Heeres und führten eine blaurote Fahne mit der Aufschrift "ad
retinendam coronam" - hatten die Aufgabe, einen Kulturwall gegen
den nomadischen Osten zu errichten. Sie konnten also nicht den
Herrengelüsten ehrgeiziger Volksgenossen die Zügel schießen
lassen, wenn sie auch Führertum gerne anerkannten, denn sie mußten
die Stoßkraft der Gesamtheit ihrer Sendung unterordnen. Das Beispiel der
Dithmarschen liegt nah, die im gemeinsamen Abwehrkampf gegen das
Nordermeer ähnliche Gedanken entwickelten wie die deutschen Kolonisten
in Siebenbürgen, die von ihren Nachbarn Sachsen genannt werden. Freilich
die Dithmarschen unterlagen, und die Sachsen blieben Sieger insofern, als sie
innerhalb des alten, den Türken tributären siebenbürgischen
Fürstentums aus dem Kolonistenrecht ein Eigenlandrecht entwickelten, das
fast bis in unsere Tage Gültigkeit besaß, und erst durch die
demokratische Gesetzgebung Ungarns aus dem Jahre 1868 zunichte gemacht
wurde.
Krieg und Kampf ist den Siebenbürger Sachsen als schweres Schicksal
aufgebürdet, aber sie haben nie einen Krieg begonnen, sie haben
sich immer nur gegen Mongolen, Türken, Tataren, Walachen, gegen die
eigenen, das Recht beugenden Könige und die späteren
Landesfürsten, gegen Magyaren und Rumänen wehren
müssen, auch gegen die habsburgischen deutschen Kaiser, deren beste
Stützen sie im Kampf gegen die Türken waren und die ihnen zum
Dank ihr Geld abknöpften und sie mit der Gegenreformation, freilich ohne
jeden Erfolg, drangsalierten. Noch bevor der Türke das Land bedrohte,
waren die Städte, Hermannstadt als Mittelpunkt des
Königsbodens - Kronstadt, eine Gründung der
Ordensritter, die, bevor sie ins Kulmer Land zogen bis 1225 den
äußersten Osten Siebenbürgens, das herrlich schöne
Burzenland kolonisierten - aber auch das romantisch aufgebaute Schäßburg im
obst- und weinreichen Kokeltal und das
nördlichste Städtchen Bistritz in lieblichem
Hügelland zu Knotenpunkten des Handels, zu gewerbefleißigen,
wohlhabenden Gemeinwesen ausgebaut worden, in denen Künste und
Handwerk blühten. Die Bürger erbauten gewaltige gotische
Hallenkirchen und herrliche Rathäuser mit hochragenden Türmen.
Ihre Kaufherren waren bedeutsame Mittler zwischen Orient und Okzident. Die
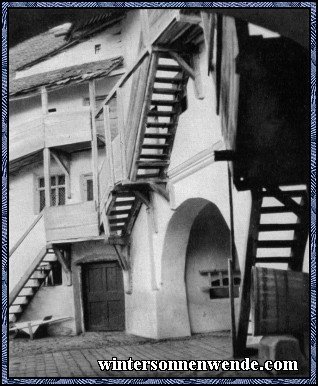
[331]
Inneres der größten sächsischen Kirchenburg
in Tartlau bei Kronstadt.
|
Städte waren stark befestigt. Auch auf strategisch wichtigen Bergen und in
den Pässen standen wehrhafte Festungen ähnlich denen des
Mutterlandes, aber das Symbol der abwehrbereiten Gemeinschaft ist die
Kirchenburg. Nach der Schlacht von Nikopolis im Jahre 1395 forderten
die Türkenkriege die ganze Kraft des Volkes in die
Schranken - nun sind die Sachsen nicht mehr Kolonisten, sie mögen
in den 250 Jahren ihrer Anwesenheit im Lande erkannt haben, daß sie eine
gottgewollte Sendung zu erfüllen haben, nämlich ein "Schutzschild
der Christenheit" zu sein, wie ein Papst sie im
15. Jahrhundert nennt. - In jedem Dorf steht das
Gottes- [331] haus inmitten der
Straßen auf freiem Platz oder auf einer nahen Anhöhe,
umgürtet von Mauern und Türmen, Wällen und tiefen
Gräben, hinter denen jeder Volksgenosse eine eigene Kammer besitzt, in
der er wohnt und seine Kostbarkeiten zu bergen vermag, aber auch einen eigenen
Standplatz am Wehrgang hat, woher er mit Armbrust oder Hakenbüchse
auf die Angreifer schoß, und seine Frau den Feind mit heißem Wasser
oder siedendem Pech, nicht selten auch mit scharfer Axt bewillkommnete. Das
Gotteshaus selbst ist für den letzten Fall zur Verteidigung eingerichtet
gewesen. Die Kämpfe sind grimmig und ungeheuer verlustreich.
Hunderttausende sind im Lauf der Geschichte im Kampfe gefallen oder von den
Türken verschleppt worden, aber die Sachsen sind nie kleinmütig
geworden, denn auch in ihren Herzen war die Kirchenburg errichtet.
Der tief in die Seele dieses Völkchens eingegrabene allgemeine Wesenszug
christlich nationaler Opferbereitschaft geht auf die unzähligen gemeinsam
überstandenen Kämpfe innerhalb der Kirchenburgen zurück,
ist auch heute noch so stark, daß selbst in unseren Tagen der
Umwälzungen gerade in glaubensmäßiger Beziehung eher eine
Vertiefung dieser Charaktereigenschaft zu sehen ist. Das gesamte Volk ging
gemeinsam zum Luthertum über [332] und hat nie
Religionskämpfe gekannt. Aus den alten Gedanken der
Rodungs- und Arbeitsgemeinschaft der Kolonistenzeit, noch mehr aber aus dem
oft engen und drückenden Neben- und Übereinander in der
belagerten Kirchenburg ist der starke soziale Sinn der Sachsen erwachsen, der
heute wieder eine entschiedene Stärkung erfährt. Es hat keinen
deutschen Stamm gegeben, in dem der Genossenschaftsgedanke so schnelle
Erfolge aufweist, wie bei den Siebenbürger Sachsen, deren gesamtes
Wirtschaftsleben ganz auf der Gemeinschaftsarbeit aufgebaut ist. Man
könnte meinen, Luther habe gedanklich sein "Ein feste Burg" dem
siebenbürgisch-sächsischen Kampfe entlehnt, und Hitler seine
Gedanken der Volksgenossenschaft dem Gemeinschaftsleben der Sachsen.
Aber auch das geistige und gesellschaftliche Leben der Sachsen ist durchaus auf
die Gemeinschaft, auf althergebrachte Formen und Sitten aufgebaut. Die
Nachbarschaften, Bruder- und Schwesterschaften umfingen und umfangen alle
Glieder der Gemeinde, geben ihnen nach außen eine würdige
Stütze, helfen in Not, führen zu gemeinsamem Vergnügen,
wie sie den Toten gemeinsam zu Grabe tragen. Alte Vorschriften regeln das
gesamte gesellschaftliche Leben, schreiben dem Hochzeitsbitter die Form der
Einladungen vor, wie sie dem Brautvater gebieten, mit welchen Wendungen er
beim Geistlichen, beim "wohlachtbar-würdigen Herrn Vater" um das
Aufgebot bittlich wird. Die alten, weisen Bräuche schützen die
Gemeinschaft vor den Einbrüchen fremden Volkstums, schädigender
Sitten, gefährlicher Laster, schirmen den Einzelnen auch in wirtschaftlichen
Dingen.
Trotz dieser so ausgeprägten kollektivistischen Lebensformen behält
der Einzelmensch aber doch viel mehr persönliche Freiheit als etwa der
Mensch, der in kommunistisch geführten Gemeinschaften lebt. Innerhalb
des Hofes ist der Sachse unbedingter Herr, hier kann er ganz nach eigener
Verantwortung schalten. Sowie er aber nach außen auftritt, muß er
sich den Regeln, die die Gemeinschaft aufgestellt hat, fügen, nicht nur in
den allgemeinen selbstverständlichen
Bürgerpflichten, - am gleichen Tage mußte mit der Saat
begonnen werden, wie auch am selben Tage jedermann zur Ernte des Korns aufs
Feld hinaus mußte -, sondern auch in Fragen der Tracht, in Fragen
öffentlicher Vergnügungen, in seiner Stellung gegenüber den
andern im Lande lebenden Völkerschaften. Es ist ungeschriebenes aber
desto strenger durchgeführtes Gesetz, daß jeder Jugendliche nach der
Einsegnung der Bruder- oder Schwesterschaft beitritt, der er bis zur
Verehelichung oder bis zum 24. Jahre angehört, ebenso wie es
Vorschrift ist, die mit Stolz eingehalten wird, daß beim Kirchgang und allen
feierlichen Anlässen die uralte farbenprächtige Volkstracht getragen
wird. Die Gemeinschaft ächtet national jeden, der eine Ehe mit einem
Fremdnationalen eingeht - nicht aus
Überheblichkeit - die Ächtung ist auch nicht eine
persönliche, jedoch in allen Fragen, die die deutsche Gemeinschaft
angehen, schaltet der, der eine Mischehe eingeht, aus, es sei denn, daß sein
Ehegenoß freiwillig dem Deutschtum und dem evangelischen Glauben
beitritt. So sind denn Mischehen selten. Nur durch diese oft starren Gesetze war es
möglich, daß sich Sprache und Rasse weitgehend rein erhalten haben,
so rein, daß der Siebenbürger Sachse heute nach 800 Jahren ohne
weiteres in seinem Dialekt mit seinem Luxemburger Vetter sprechen kann und
dieser höchstens feststellt, daß der Sachse "wohl schon lange von
daheim fort sei", womit er aber nicht die Jahrhunderte meint.
[333=Foto] [334]
National - christlich - sozial also sind die drei Hauptwesenszüge dieses
kleinen Volkssplitters, der nicht mehr als eine Viertel Million Seelen zählt,
aber nicht nur einem großen Teile Siebenbürgens den Stempel des
christlichen Abendlandes unverwischbar aufgedrückt hat, sondern auch
noch weit in die jenseits der Karpathen liegenden Räume des
rumänischen Volkes hinübergewirkt hat. Zäher Fleiß
und ein oft kühner Wagemut eignet den Sachsen in geschäftlichen
Dingen, doch sein gesunder Konservatismus schützt ihn vor
Übereilungen. Er ist jedoch durchaus nicht rückständig, nur
prüft er Neuerungen genau, bevor er sie einführt. Er ist ein sorgsamer
Rechner und er wurde in der Vorkriegszeit sehr wohlhabend, doch ist sein
Reichtum völlig zerschlagen worden durch Krieg, Inflation und
Wirtschaftskrise. Man sagt ihm Neid und Geiz nach, doch ist letzterer mehr auf
seine Person beschränkt, während er seinem Vieh die
schönsten Ställe baut, selbst aber in seinem alten Hause wohnen
bleibt. Sprichwörtlich ist seine unbedingte Ehrlichkeit und
Gewissenhaftigkeit. Fremden gegenüber ist er zunächst sehr
zurückhaltend, da er immer wieder schlechte Erfahrungen macht. Der
Magyare wird wegen seines überschäumenden Temperaments nicht
als vollwertig angesehen; den Rumänen, dessen Sprache er fast immer
versteht, anerkennt er heute als Herrn des Landes nicht eben mit Freude, da er ihn
als wenig arbeitsam und in vielen Dingen unzuverlässig empfindet; doch
der Sachse kennt keinen nationalen Haß. Der Zigeuner wird als
nichtvollwertig angesehen und den Juden gegenüber hat er eine starke
Abneigung, so daß sie in den meisten sächsischen Gemeinden nicht
ansässig werden können. Die Umwohnenden nennen die Sachsen
kalt, berechnend und stolz. Verglichen mit den südöstlichen
Völkerschaften wirkt er unbedingt kalt und
temperamentlos - besonders die Frauen -, doch stolz im
überheblichen Sinne ist er nicht, nur selbstbewußt, da er weiß,
daß er der Lehrer der andern Völker ist. Der Sinn für heiteres
Genießen, den seine Vettern im Rhein- und Mosellande haben, ist bei ihm
durch die leidvollen Jahrhunderte verloren gegangen; sein höchster
Genuß ist: Schaffen und Vorwärtskommen. Wohl gibt es auch unter
den Sachsen unverbesserliche Trinker und Schlemmer, Kartenspieler und sonstige
Tunichtgute, dumme Protzen und maulaufreißerische Prahlhänse, der
Gesamteindruck ist aber doch in überragender Weise der einer gefestigten
Persönlichkeit, die ihre Pflichten kennt und befolgt, was sich wohl am
besten dadurch ausdrückt, daß die Sachsen die pünktlichsten
Steuerzahler waren und sind.
Nur in einer Beziehung ist er schwärmerisch, in seiner Heimatliebe, in
seiner unentwegten Deutschheit und in der Verehrung, die er dem Mutterlande
entgegen bringt, was sich besonders in seinem Schrifttum zeigt. Ganz gewiß
gibt es keinen auslanddeutschen Stamm, der so ganz und gar geistig nur auf das
Deutsche eingestellt ist. Was der Siebenbürger Sachse für die
Erhaltung seiner Schulen zu opfern in der Lage ist, kann nur als großartig, ja
für den Binnendeutschen als beschämend bezeichnet werden. Er hat
in den guten Tagen soviel in seine Kulturrüstung hineingebaut, daß er
es heute in schwerer Notzeit kaum zu tragen vermag, aber da er von seiner
Sendung überzeugt ist, so kämpft er einen geradezu heroischen
Kampf um die Erhaltung seiner geistigen Höhenlage. Alles was uns im
Reich innerlich bewegt, macht auch der Siebenbürger Sachse durch; in
politischer, in wirtschaftlicher, noch mehr aber in künstlerischer wie in
allgemein geistiger und [335] seelischer Beziehung;
und er versteht all das zur Stärkung seines Deutschtums trefflich zu
benützen. Daher ist er dem Binnendeutschtum in einer Beziehung
wenigstens voraus - er ist unbedingt Volk geworden, er stellt
einen 100%igen Typus des Deutschen dar, so wie ihn unsere großen Denker
und Politiker oft und oft gefordert haben, er ist, geistig betrachtet, eine innige
Verschmelzung von allen deutschen Stämmen, da er bemüht
gewesen ist, all das zu erobern, was er im Mutterland als gut, schön und
erstrebenswert erschaut hat. So hat denn seine idealistische Deutschheit stets die
großen Männer des Mutterlandes begeistert und der Ausspruch Opitz'
"Germanissimi Germanorum" erscheint in verschiedener Fassung immer
wieder und wird mit Freude zur Kenntnis genommen, und der Jugend wird immer
gepredigt, sich dieser Werturteile würdig zu erweisen.
Siebenbürgen ist eine gewaltige Bastion, die aus den sie umgebenden
Tiefebenen und Steppen bis auf 2600 Meter hinausragt, ein Land, das seine
Bewohner zu harten und kühnen Menschen formt. Der
siebenbürgische Rumäne ebenso wie der Magyare, der Szekler, sie
sind charakterlich stark von ihren in den Tiefebenen lebenden Volksgenossen
verschieden. Überall dort, wo der Sachse die deutsche Pflugschar in die
Erde gedrückt hat, trägt das Land vielfache Frucht; aber Klima und
Boden lassen den Segen nicht mehr üppig gedeihen, sie fordern
ständige schwere Arbeit, aber sie lohnen auch mit Segen den [336] Fleißigen.
Hügel an Hügel begleiten die Flußläufe, die als
brausende Wildwässer von den Schneefeldern der Karpathen zu Tal
strömen. An der Kokel - inmitten des Landes, moselähnlich
und auch ihr Name mahnt an den Kokelberg bei
Trier - und ihren Nebenflüssen, reifen süße Trauben,
und der Wein, der aus ihnen gekeltert wird, ist dem der alten Heimat
ähnlich an lieblich duftender Würze, nur heißer und feuriger.
Weizen und Roggen, Kraut, Kartoffel und Rüben stehen auf den
Äckern, auf denen tellergroße Sonnenblumen ihre Gesichter drehen
und wenden und große Kürbisse sich wohlig auf der Scholle
lümmeln. Aber auch Hanf und Flachs werden gebaut und überall
baut man das türkische Korn, den Kukuruz, den Mais, doch ist sein Mehl
nicht wie bei den Rumänen ständige Nahrung. Der Sachse ißt
den Mais lieber im veredelten Zustande - er füttert seine Schweine
mit den goldenen Körnern. Brot und Speck, Wurst und Sauerkraut sind die
Hauptnahrungsmittel der Sachsen, und wenn sie Feste feiern, dann wissen sie die
langen Tafeln mit der Menge üppiger Speisen zu füllen, mit derber
und feiner Kost und köstlichen Weinen, denn die von den Magyaren so sehr
gerühmte Schlemmerfreude hat auch auf den Sachsen abgefärbt, nur
daß sie nicht zu seinem Lebensinhalt erhoben wurde.
Schnurgerade ziehen sich die breiten Dorfstraßen dahin, Giebel steht an
Giebel, ein Haus gleicht fast dem andern. Nach der Straße zwei bis drei
Fenster der guten Stube. Ein großes Tor schließt die Einfahrt auf den
rechteckigen Hof; neben der Toreinfahrt ein kleineres Wohnhaus, das Altenteil,
neben dem meist der Backofen und die Sommerküche stehen. Ein paar
Stufen führen in die Wohnräume hinauf und hinab in den Keller, in
dem Obst, die Krautfässer und Kartoffeln und im Weinland natürlich
auch der Rebensaft eingelagert wird. Unter dem selben Dach der
Geräteschuppen, auch Platz für einen Federwagen, dann die
geräumigen Stallungen mit steineren Fliesen, luftige Räume, in
denen edles alpenländisches Milchvieh, die für Siebenbürgen
so typischen Büffel und zumeist erstklassige Pferde zu finden sind. Der
stark mit Federvieh bevölkerte Hof beherbergt noch den Misthaufen und
eine Jauchengrube, Schweinekoben, manchmal auch einen kleinen
Suppengewürzgarten, und quer über die ganze Hofbreite ist die
große Scheune gestellt, deren hartgetretene Tenne freilich nicht
mehr zum Dreschen benützt
wird - die Zeit der hölzernen Flegel ist längst vorbei,
überall brummen in der Erntezeit die Maschinen. Hinter der Scheune ein
geräumiger Grasgarten mit Obstbäumen, mit Gemüsebeeten,
die von leuchtenden Bauernblumen bestanden sind, um die fleißige
Honigträgerinnen schwirren.
Das fränkische Gehöft in reiner Form.
Dort, wo die in der Planung der Siedlung vorgezeichneten Straßen
zusammentreffen, ein weiter Platz, auf dem sich einst die Wagenburg erhob, als
man das Land der Wildnis abrang; heute steht das alte Gemäuer der
Kirchenburg hier, verwittert und romantisch. Zumeist sind die einstigen
Wassergräben zugeschüttet, eine kleine Promenade ist entstanden,
oder ein Pfarrgarten, doch die Türme zeigen noch trotzig ihre Pechnasen,
die wehrhaften Mauerumgänge scheinen erst gestern verlassen zu sein. In
den Kammern steht auch heute noch die Frucht in großen Bütten, die
Speckseiten hängen von der Decke, doch nur selten sind die Kammern
verschlossen...

[333]
Siebenbürgische Frauen.
|
[337=Foto] [338] Und wenn
dann am Sonntag die Glocken zusammenklingen, dann treten die Bauern aus ihren
freundlichen Häusern. Die Schaftstiefel glänzen, schwarze Hosen aus
solidem Tuch stecken in den Schäften und der stolze blaue oder in andern
Gegenden weiße Mantel bedeckt den Körper; ritterliche Gestalten,
aufrecht und ihres Wertes bewußt, Herren besonders wenn sie hoch zu
Roß durchs Land reiten, um einen hohen Gast einzuholen. Die Frauen in
ihren altertümlichen Trachten, in ihren faltigen Schauben mit
weißgeschleierten Köpfen oder in dunkeln, spitzenbesetzten Hauben,
wie einem mittelalterlichen Gemälde entstiegen. Nur der weiblichen Jugend
ziemt die Fröhlichkeit farbenfreudiger Gewänder, feingestickter
Bänder, die von dem krempenlosen Samtzylinder, dem "Borten" flattern,
der die Flechten krönt. Die Sonne glitzert auf altem Geschmeide,
blühweiß leuchtet das bauschige Hemd aus dem
Mieder - es ist eine Pracht!
O, man könnte noch viel erzählen, von den guten alten Sitten, von
der lustigen Spinnstube in kalter Wintersnacht, wenn gewaltige Schneemassen die
Dörfer verschüttet haben, von den Osterbräuchen und
Maienspielen, von tagelangen Hochzeiten, wenn die Braut verstohlen wird,
könnte berichten von den ranken Turnergestalten der Jungmänner,
von ihren Wettrennen, vom Tanz der Jugend unter der Dorflinde, von den
althergebrachten Liedern, die sie am Abend auf den Dorfstraßen singen, von
dem harten Ringen gegen die neuen Gewalten, die aufgestiegen sind, und dem
schweren Kampf um die Erhaltung des Deutschtums in Schule und Kirche.

[335]
"Die Sachsen kommen!"
Festzug am Reformationstag in einem siebenbürgischen Städtchen.
|
Doch wir müssen eilen. Auch die Städte haben ein Anrecht darauf
geschildert zu werden, und dann ihr, ihr mächtig ragenden Riesen, ihr
schneegekrönten Häupter der Karpathen, ihr tiefen Wälder, in
denen Bär und Luchs hausen, ihr einsamen, hochgelegenen Triften und
Almen.
Hermannstadt ist
das Haupt des Sachsenlandes. Hier residiert der Bischof, das
Oberhaupt des Deutschtums, der geistliche und geistige Vater, die höchste
Instanz aller Volkstumsangelegenheiten. Noch stehen die alten
Befestigungswerke, noch erzählen uns die kühn gewölbten
gotischen Kirchen von der Zeit, da Hermannstadt eine Macht darstellte, um die
die Landesfürsten buhlten. Auf dem Großen Ring jenes
prächtige Palais des bedeutendsten Siebenbürgers, des Gubernators Samuel Brukenthal, des Freundes der Maria Theresia, des größten
Staatsmannes aus sächsischem Stamm, eines Kunstmäzens, der
seinem Volk ein einzigartiges Museum hinterließ von staunenswerter
Großartigkeit. Die Straßen mit ihren gediegenen
Bürgerhäusern, die schönen Plätze der sich dehnenden
neuen Stadt zwischen Parks und Gärten...
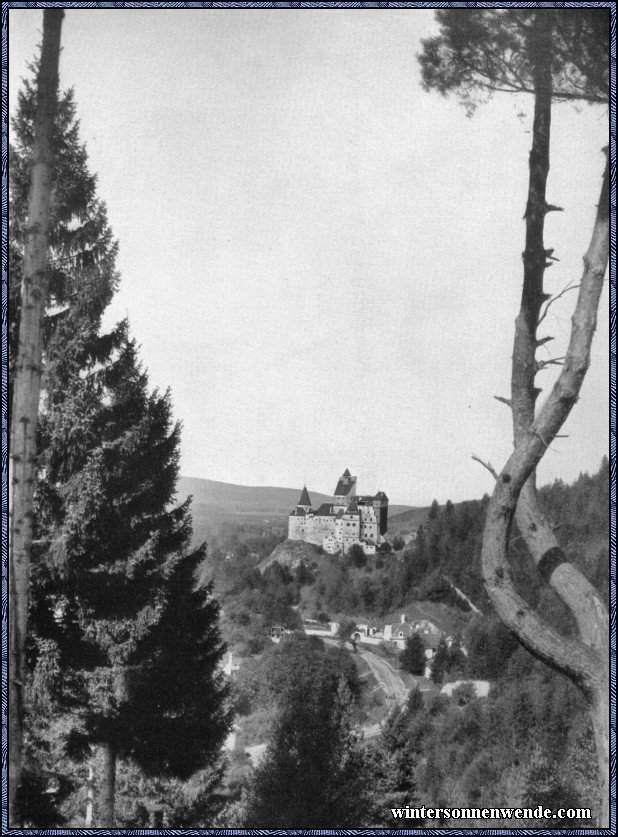
[337]
Die Törzburg. Deutsche Ordensburg aus dem 13. Jahrhundert.
|
Kronstadt, die Gründung der Ritter am Fuß der Zinne, bietet uns das
schönste Städtebild des Südostens. Vor seinen Toren breitet
sich die weite, tellerflache fruchtbare Ebene des Burzenlandes mit ihren
volkreichen großen deutschen Gemeinden. Hoch auf dem Berge das alte
Schloß, ungeheuerlich die klobigen Festungstürme der Stadtmauern,
formenschön das Rathaus und ehrfurchtgebietend die größte
der gotischen Kirchen, die östlich von Wien errichtet wurde, selbst den
berühmten Stefansdom an Größe überragend. Kronstadt
war und ist die bedeutendste Industrie- und Handelsstadt des Landes an dem
wichtigen Paß nach Rumänien, nach dem Balkan gelegen. Vor den
Toren werken die Fabriken, rauchen die Schlote, hämmern die Werke,
surren die Spindeln, die Stadt aber [339] klettert immer
höher hinein in die Täler, umgürtet von Gärten und
wonnesamen Wäldern, durch die die Wege hinausführen in den
schönsten Teil der Karpathen...
Und in diesen Städten, nicht minder aber auch in dem romantischen
Schäßburg und dem gemütlichen Weinstädtchen
Mediasch am Kokelflusse, im obstreichen Bistritz im Norden des Landes,
blüht deutsches geistiges Leben im Bezirk der alten Lateinschulen, hier
klingen die Männerchöre und Orchester von den großen
Werken, die deutsche Meister schufen, hier erbrausen die Orgeln von Fugen des
großen Thomaskantors...
Ein Stück Deutschland des Geistes und der Gesinnung, wenn auch politisch
nie zum Reiche gehörend, so doch eine Provinz jenes großen Reichs
deutscher Geistigkeit, das lebt, allen Gewalten zu Trotz!
|