
[Anm. d. Scriptorium:
eine detaillierte Karte
der deutschen Kolonien
finden Sie hier.] |
Land und Leute in unseren Kolonien (T. 3)
[134]
Unser Kamerun
Dr. Alex Haenicke
Das Land
Kamerun ist wohl die bekannteste unserer Kolonien gewesen - vielleicht lag dies
an dem seltsamen, exotisch klingenden Namen, über dessen
Ursprung sich allerdings die wenigsten klar gewesen sein dürften: er
stammt von den Entdeckern der mittelafrikanischen Westküste, den
Portugiesen, die dem Strand nach den unzähligen auf ihm
herumwimmelnden Seekrebsen, den "camarões", etwa
"Kamerunsch" ausgesprochen, den Namen gaben. Die für das Ufer
gedachte Bezeichnung wurde später auf das ganze Gebiet ausgedehnt,
wobei denn wieder einmal feststellbar ist, daß die Ableitungen von Namen
oft völlig sinnlos sind, denn was die riesigen
Urwald- und Steppengebiete des Landes mit den scherentragenden
Meergeschöpfen zu tun haben, wird wohl niemand so leicht zu
erklären wissen.
Aber auch die Landschaftsart der neuen Kolonie zog die Gedanken und
Sehnsüchte so manches romantisch veranlagten Deutschen an: denn ganz
im Gegensatz zur öden, dünenbegrenzten toten Küste
Südwestafrikas empfängt Kamerun den Ankommenden mit der
ganzen betörenden und betäubenden Üppigkeit der Tropen.
Über dem dichten Grün wildverwachsener Gebüsche,
Gehölze und Wälder erheben sich mächtige
Gebirgszüge in einer Höhe von 4000 m; edle Holzarten,
fruchttragende Bäume und Sträucher, üppigster Graswuchs
bekunden den Reichtum des von vielen Flüssen durchzogenen Gebietes, in
dem Überfluß an Nahrungsmitteln und kostbaren Rohstoffen
herrscht.
Aber auch Schönheiten locken, die nur von den Tropen gespendet werden
können: die traumhaften Nächte, in denen Negermusik aufbrummt
oder das dumpfe Schlagen der Nachrichtentrommel von fern sich nähert
und geisterhaft wie Waldesspuk wieder verschwindet...
Wenn trotz seiner Vorzüge Kamerun in der Folge an Anteilnahme
seitens der öffentlichen Meinung in der Heimat verlor und Kamerun das
"Stiefkind der Mutter Germania" wurde, so ist das auf Umstände
zurückzuführen, die nicht im Lande selbst begründet sind,
sondern in dem blinden Vorurteil der rot-schwarzen Reichstagsparteien.
Kamerun umfaßte ursprünglich ein Gebiet, das etwa die
Größe Deutschlands
besaß - 492 700 qkm; 1911 wurde es durch die mit
Frankreich abgeschlossenen Marokkoverträge aber bis zu der ansehnlichen
Ausdehnung von 790 000 qkm gebracht. Es gewann sehr bedeutende
Territorien im Süden und Osten des Landes, die wie die Fläche des
Erstbesitzes zum Teil bis in die neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
unerforscht gewesen waren.
Die Küste der Kolonie ist 320 km lang und erstreckt sich vom Rio del Rey
bis zum Kampofluß; sie ist durch viele Buchten gegliedert, aber der Mangel
der westafrikanischen Küste an guten Hafenplätzen macht sich auch
hier bemerkbar, weil die großen Flüsse Kameruns mit ihren
Wassermassen auch viel Schlamm ins Meer spülen, der sich in Barrenform
vor die Mündungen legt und so den Schiffen die [135] Einfahrt erschwert.
Ausgiebige Baggerungen haben in der
Duala-Bucht dem Übelstand abgeholfen. Da das Land im Westen
terrassenförmig zum Meere abfällt, sind die Flußläufe
vielfach von Stromschnellen und Wasserfällen durchsetzt, so daß ein
Eindringen in das Innere des Landes auf dem Wasserwege mit besonderen
Schwierigkeiten verknüpft ist.
Im Westen und Nordwesten grenzte Kamerun an
Britisch-Nigeria, im Süden und Osten an
Französisch-Äquatorial-Afrika. Nach dem Kriege wurde Kamerun
als Mandatland des Völkerbundes unter britische und
französische Herrschaft geteilt.

[54]
Elefantensee bei Kumba in Kamerun.
|
Nördlich von der Biafrabai, der Hauptbucht der Küste,
erhebt sich das vulkanische Kamerungebirge als gewaltiges
Wahrzeichen der Kolonie aus dem
Meere - die spanische, in der Bucht liegende Insel Fernando Po, sodann die
sich über 750 km ins Meer erstreckende Kette der Eilande Principe,
São Thomé und Annobom bilden die Fortsetzung des
festländischen Gebirgsstockes. Lange sind die Bemühungen um die
Bezwingung seines höchsten Gipfels, des Monga maloba vergeblich
gewesen; der deutsche Botaniker Gustav Mann, der englische Forschungsreisende
Burton und andere Reisende haben versucht, die 4100 m des
Kamerunberges zu ersteigen; aber sie kamen kaum über die hier sehr hoch
liegende Baumgrenze, zirka 2700 m, hinaus, dann machte, wie es in einem
älteren Bericht heißt, "der rauhe, vulkanische, mit Lavamassen
überdeckte Boden das Aufsteigen in höhere Regionen
unmöglich" - wobei zu bedenken ist, daß bis in die siebziger
Jahre trotz der Leistungen Edward Whympers, Tucketts, Leslie Stephens und
anderer Alpinisten die Hochtouristik noch keine sehr verbreitete und entwickelte
Kunst gewesen ist. Der Aufstieg ist zwar ziemlich lang, bietet aber nach den
heutigen Begriffen gar keine Schwierigkeiten. In 2400 m Höhe liegt
eine von Gustav Mann entdeckte und nach ihm benannte Quelle; der Pic selbst,
der "Berg des Donnerns" genannte Göttersitz, gipfelt sich dreifach in die
"Drei Schwestern".
Die Neger schrieben die Erfolge der ersten Weißen, als es ihnen gelang,
höhere Regionen zu erreichen, einer Medizin zu, die die Götter dem
Fremden gäben, um sie noch stärker und mutiger zu machen, als sie
ohnehin schon seien: denn die Eingeborenen hatten stets die Angst der
Naturmenschen vor dem Gebirge - genau wie die Europäer mit
wenigen Ausnahmen bis ins 18. Jahrhundert hinein, obgleich diese längst
keine Naturkinder mehr waren - und siedelten sich niemals höher als
1000 m hoch an. Bis in diese Gegend reicht die üppige tropische
Vegetation; dann folgt eine Urwaldregion mit dichtem Unterholz, bis sich die
Bäume allmählich lichten, bis sich nur noch vereinzelt Gras und
Strauchwerk sehen lassen, bevor die Kahlheit des Hochgebirges in ihre Rechte
tritt. Das ganze Gebirge hat eine Länge von etwa 50 km bei einer
Breite von 10 bis 15 km.
Die sandige Küste ist überall flach und an den
Flußmündungen von sumpfigem Schwemmland eingefaßt. Die
Eigentümlichkeit des Strandbildes wird durch [136] den Hintergrund des
dichten Mangrovengebüsches bestimmt; diese eintönige grüne
Wand, die sogar bis in die Flußbetten vordringt, gibt uns den Eindruck der
Abgeschlossenheit, des Geheimnisvollen, das Afrika mehr als jeden anderen
Erdteil umgibt. Es ist ein Mittelding zwischen Meer und festem Land, das zum
Teil, z. B. an der Mündung des Mungoflusses, dem Ufer vorgelagert
ist, eine Art Wattenregion, deren schlammiger, von Wasser bedeckter Boden
durch das vielfach verschlungene Wurzelgeflecht der Mangroven
zusammengehalten wird. Eine Reihe von Wasserrinnen, "Krieks" genannt,
durchzieht diese Sumpfniederungen, die erst
10 - 15 km landeinwärts in festes Schwemmland
übergehen; dieses steigt dann in etwa 50 km Entfernung bis zum Ort
Mundame bis zu 110 m Höhe an. Der Pflanzenwuchs geht
allmählich von der Mangrove in schwer durchdringlichen Buschwald
über, in dem sich vereinzelte Hochwaldbäume und Palmen
finden.
Diese Mangrovenwälder bergen eine große Gefahr: Aus dem
ungesunden Gewirr steigen Milliarden von Moskitos
auf - Afrika grüßt die Fremden nicht eben freundlich. Aber
auch das Hinterland ist gegen diese Gefahren nicht ganz sicher, denn der Wald
trägt die Krankheitsträger bis ins Innere, "so daß die
Eingeborenen oft nach der Windrichtung den Anzug einer Fieberepidemie
voraussagen können".
Die Küstenlinie wird durch die "Ästuarien" genannten
Flußmündungen unterbrochen, deren bedeutendste das
Kamerunästuar oder die Bucht von Kamerun ist; sie wird von fünf,
durch ein Netz von Nebenarmen verbundenen Flüssen gebildet. Der
Dibamba, der Wuri und der Mungo sind die
bedeutendsten.
"Die Einfahrt von der See her",
schreibt A. Seidel, "ist 8 km breit und so tief, daß die
größten Kriegsschiffe in die prächtige, außerordentlich
günstige Bucht einlaufen können. Vom Schiffe aus erblickt das Auge
während der Einfahrt zunächst nur flache niedrige Ufer, die das weite
Wasserbecken in großem Bogen umsäumen.
Die Szenerie ist eintönig, dichtes
Mangrovengebüsch bedeckt die Landschaft, die nur selten durch die aus
dem Buschwerk hervorlugenden Hütten eines Dorfes belebt wird. Erst nach
etwa zweistündiger Fahrt wird das Bild anziehender. Das Gelände
am linken Ufer des Flusses hebt sich, steil abfallende Uferberge treten hervor, und
der frühere Regierungssitz, an der linken Seite der Wurimündung auf
der »Joßplatte« gelegen (eine 10 m hohe Lateritplatte,
auf der der Gouverneur von Soden sein Haus und einen
prachtvollen Park angelegt hatte), kommt in Sicht. Hier liegen auch mehrere
Negerdörfer und europäische Anlagen, welche zusammen als
Duala bezeichnet werden. Alle Bauten und Dörfer
(Joß-, Akwa-, Bell- und Deidodorf) befinden sich auf der linken Seite des
Flusses, während auf der rechten nur Hickory, ebenfalls ein Dualadorf,
gelegen ist."
So zeigte sich Duala zu Beginn der deutschen Arbeit in
Kamerun. - Später traten machtvolle Veränderungen ein; das
Bild wurde freundlicher und einladender. - Zahlreiche stattliche
Gebäude öffentlicher und privater Art zeugten von deutschem
Fleiß und zielbewußtem Aufbau.
[137] In geringer Entfernung
von der Küste beginnt der Urwald; als breiter Gürtel bis
300 km Tiefe im Süden und 120 bis 150 km im
nördlichen Teil der Küste lagert sich das "Waldland" auf das
ansteigende Gelände. Fr. Hutter gibt in seinen
Wanderungen und Forschungen im Nordhinterland von Kamerun ein
anschauliches Bild des Urwaldinnern:
"Unter dem feuchten, dumpfen,
halbdunklen Blättergewölbe herrscht eine fast
gleichmäßige Temperatur Tag und Nacht, die eines Treibhauses.
Wenn der Himmel bewölkt ist, erreicht das Dunkel bisweilen einen solchen
Grad, daß man kaum Uhr und Kompaß ablesen kann. Ein
Sonnenstrahl dringt fast nie auf den
Weg - kein Glitzern und Spielen der goldenen Lichter auf dem Gezweig.
Und stiehlt sich einmal ein schwacher Lichtblick durch die grünen, grauen,
braunen, dumpfen Laubmassen, so erfaßt den Menschen, der tagelang da
unten, zwischen den mächtigen Pfeilerstämmen der Eriodendren,
dem Gewirr, Gestrüpp und Wurzelwerk den mächtigen Fangarmen
der Lianen, ein winziges Geschöpf, mühsam seinen Weg verfolgt,
die Sehnsucht, hinauf, hinaus zu gelangen, um nur endlich einmal wieder die
Sonne und den Himmel zu sehen.
Gleichförmig, eintönig ist der Wald, wie der
Ozean, wenn kein Windhauch ihn bewegt, kein Segel ihn belebt. Was heute das
Auge sieht, ist dasselbe, was es gestern gesehen hat, was es morgen sehen wird.
Überall grade aufstrebende Stämme, um die sich riesige, beindicke
Lianen schlingen, daran erinnernd, daß auch in dieser scheinbar in
ununterbrochener Ruhe dahinlebenden Pflanzenwelt hart und unerbittlich der
Kampf ums Dasein gekämpft wird. Die Opfer dieses Kampfes, die
abgestorbenen, halb vermoderten Baumleichen liegen allenthalben am Boden, und
furchtbar ermüdend sind die steten Klettereien darüber hinweg: bald
schwingt man sich nur mit Mühe hinauf, um ausgleitend drüben
hinunter zu stürzen; bald ist der Stamm bereits so verfault, daß man
bis an die Hüften durchbricht und Staub, Moder, Insekten und Maden in
Unmengen aufstört und wie von einer Wolke davon umgeben ist. Zum Teil
hängen die erstickten Stämme noch in den Armen ihrer
Überwinder, der Lianen, wie in riesigen Klammern, die sie zwingen,
hinaufzustarren in die Lüfte, gebleichte Riesenskelette. Neue
Gewächse sprießen aus ihnen hervor; unten auf dem Boden
schießt ein Heer von Blatt- und Schlingpflanzen
auf."
So war's noch zu Hutters Zeiten, also um die neunziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts - 10 Jahre später begann es anders zu
werden. Wo früher nur schmale Buschpfade liefen, zogen vielfach 20
Meter breite Schneisen durch den Wald, die Hauptorte des Landes verbindend. Sie
gaben der Sonne Zutritt zu dem feuchtwarmen Boden, trockneten ihn fest und
machten ihn leichter gangbar. Durch ordnende Nachhilfe von Menschenhand
wurden weite Strecken befahrbar, auch für Kraftwagen.
Die erste Terrasse erhebt sich über dem Küstengebiet;
Wasserfälle und Stromschnellen der Flüsse kennzeichnen sie. Ein
Hügelgebiet folgt, dem sich ein ebenes, etwa 40 km breites Plateau
in der Höhenlage von 500 - 600 m anschließt.
Dann zeigt sich wieder eine Hügellandschaft, ein zweites Hochplateau, bis
endlich das Hoch- oder "Grasland" nach schroffem Aufstieg erreicht wird.
Auch in Südkamerun fällt das Land mit zwei Terrassen ab, deren
erste ein mit mäßiger Steilheit ansteigendes Randgebirge aufweist,
während die zweite jähe Abhänge besitzt. Das Grasland, die
Savanne, stellt nicht etwa eine zusammenhängende
Wiesen- oder Weidefläche vor, sondern, wie einer der ersten [138] Erforscher, der im
Weltkrieg berühmt gewordene General von Morgen sagt, der als
Leutnant Kamerun durchquerte:
"Es sind große, von
Galeriewäldern durchsetzte Felder. Die Wälder bauen sich an den
Ufern der Flüsse auf und haben oft ansehnliche Breite. Außerdem
finden sich in der Savanne verstreut verschiedene Zwergbäume. Das Gras
selbst erreicht an einigen Stellen eine Höhe von 4 m. Der Boden,
vielfach roter Laterit, ist ungemein fruchtbar. Er ermöglicht bei den
Getreide bauenden Sudannegern eine zwiefache Ernte im
Jahr."
Den bekanntesten Teil des Hinterlandes von Kamerun nimmt das von
Passarge erforschte Adamaualand
ein - ein politischer, kein geographischer Begriff, da es das einstige
Sultanat Yola mit seinen Vasallenstaaten umfaßte. Gebirgswälle von
2000 m Höhe, die Tschebschti und die Mandaraberge begrenzen
es - sie sind auch heute noch nicht ganz erforscht. Das Hochland von
Südadamaua "arbeitet das Allgemeinbild zu immer schrofferen Formen
aus". Die Geländewellen werden höher und tiefer, weite Mulden und
Kessel bilden sich; die Einzelerhebungen werden isolierte mächtige Kegel
(gleich dem Hohentwiel im Hegau); die Höhenzüge breitgelagerte,
vielgegliederte, hochragende Gebirgsmassive, die ihrerseits wieder oben zu
Plateaus abgeplattet sind: so das Bámetáhochland, das
mächtige, zerklüftete Kumboplateau, das Banssohochland
und andere.
Einzelne erloschene Vulkane, wie der als abgestumpfte Pyramide in die
Landschaft hineinragende 3000 m hohe Muti bei Bamenda, Kraterseen und
Kraterhügel überragen das Plateau von Ngaundere, das noch immer
nicht ganz bekannt ist.
"Das Hochland", sagt Hutter, "soweit
es nicht Urwald deckt, ist die »rote Erde« Kameruns. Rötlich
schimmern die nackten Felswände, gleich großen roten
Dächern leuchten aus dem Braun der Hütten, dem saftigen
Grün der Bananenhaine
weithin die Versammlungsplätze in den
Dörfern; wie rote Bänder ziehen die schmalen Pfade durch die
verkohlten Flächen, wenn die Grasbrände über sie
hinweggegangen sind, oder durch das junge, frische Grün, mit dem die
tropenkräftige Natur sie bald wieder
schmückt."
Das Hochland wird von vielen sehr bedeutenden Flüssen durchzogen; der
Sanaga, zwischen Gebirgsschwellen gelegen, mit mehreren
Nebenflüssen, darunter der von Curt v. Morgen entdeckte
Mbam und der Djerem, sowie der Njong
verästeln sich über ein weites Gebiet. Außer dem Sanaga
entspringen hier der Benue, der Shari und der Ssanga.
Wenn auch der außerordentliche Wasserreichtum des Landes eine
ungewöhnliche Fruchtbarkeit garantiert, so trägt er doch wenig zur
Erschließung des Gebietes bei, da die Flüsse nur zum geringen Teil
schiffbar sind; der in dieser Beziehung wichtigste Fluß ist der Njong.
Der nördlichste Gipfel der Kolonie reicht in das sagenumwobene
afrikanische Binnenmeer hinein, in den Tschadsee. Aber der Ruf dieses
Gewässers, das lange Zeit als geographisches Problem gewertet wurde, ist
besser als die Wirklichkeit. Wir dürfen nicht bedauern, daß uns bei
der Grenzregulierung nicht mehr zugefallen ist. Denn dieser Überrest des
einstmals hier seine Wogen
schla- [139] genden tertiären
Meeres, dieser phantasieumwobene zentralafrikanische See, dieses Ziel der
geographischen Sehnsucht der Jahrhunderte, ist heute erst recht nur mehr das, was
ihn bereits vor 60 Jahren Barth genannt
hat: - "eine ungeheure Lache." Der Rückzugsprozeß vollzieht
sich mit großer Geschwindigkeit; der ehemalige deutsche Anteil am See ist
"eine kraut- und schilfbedeckte, von
1 - 2 m tiefen Wasserlachen durchsetzte Ebene." Einst hatten
verwegene Schwärmer Visionen von einer deutschen Handelsflotte auf dem
Tschadsee, die mit den Schätzen der reichen Uferländer beladen auf
dem "Binnenmeere des Sudans" einhersegelte. Nun, wir wären auch ohne
den Tschadsee glücklich, wenn wir nur Kamerun wieder hätten!
Die verwirrende Mannigfaltigkeit der Bodengestaltung, die vielen noch halb
unbekannten Gebirge, die komplizierten Stromsysteme, die verschiedenen
Formationen des großen Gesamtgebietes Kamerun bis ins einzelne
auseinanderzusetzen, würde den Rahmen dieses Buches
überschreiten und zudem den nicht geographisch und geologisch
ausgebildeten Leser ermüden. Das Bild der Gegend mag trotzdem in
großen Zügen vor dem geistigen Auge feststehen:
Mangrovendickicht, Urwald, Terrassenränder, Grasland, Hochplateaus,
Randgebirge mit vulkanischen und anderen grotesken Berggestaltungen; breite
Ströme, üppigste Fruchtbarkeit und die feuchte Hitze des
Treibhaustropenklimas; als höchste Erhebung der Kamerunberge nahe der
Küste, über dessen Bild vom Meere aus die begeisterte Schilderung
Hutters sagt:
"Ein gigantisches Eingangstor zum
Herzen Afrikas hat die Natur dort geschaffen, wo der Atlantik als Bai von Biafra
am tiefsten das westliche Gestade des dunklen Kontinents einbuchtet. Dem
Schiffe, das von Westen her sich naht, tut sich hier, an der Scheide zwischen
Ober- und Unterguinea ein Ausblick auf von überwältigender
Großartigkeit. Voraus im Osten taucht aus blauer Flut der scharf umrissene
duftige Gipfel des Kamerunberges auf;
Ost-Süd-Ost aus der Meerflut herauf der
Clarence-Pick oder O-Wassa auf der spanischen Insel Fernando Po.
Aufgerichtet zu beiden Seiten der nur 20 km breiten Straße ragen die
mächtigen Vulkangebilde hoch über die ihre Hänge
umlagernden Wolken. Ein weicher grüner Mantel, ein
großer herrlicher Wald, umhüllt den mächtigen
Südpfeiler des Naturportals. Die senkrechten Felsstreben, mit denen der in
der Tiefe gefestet ist, sind umsponnen von schaukelndem Netzwerk rankender
Gewächse, aus denen in leuchtenden Farben prächtige Blumen und
Blüten hinabhängen bis zur Brandung, die aufschäumend an
den einstigen Kraterwällen sich bricht. Drüben an der afrikanischen
Küste türmt, immer massiger nach Ost und West auslegend, der
Gebirgsstock des Kamerunberges sich auf, steil gegen die Küste abfallend,
an die, umsäumt mit dichtem Urwald, die weißen Kämme der
Wogen anbranden, um zurückprallend und rauschend in seinem oft
minutenlang sichtbar bleibendem Nebel zu zerstieben."
Von derselben Begeisterung über dieses schöne Stück Erde
zeugt eine neuere Schilderung (von Em. Kellerhals) aus dem
Jahre 1935:
"Zuerst steigt die Umrißlinie
durch den Urwald sanft hinan; dann gewinnt sie die erste Spitze, den
Kleinen Kamerunberg, immerhin schon mit 1774 Meter Höhe; die
weitere Steigerung erscheint dem Auge infolge der perspektivischen
Verkürzung nicht mehr bedeutend, beträgt aber noch volle 2300
Meter; endlich erreicht sie mit 4080 Meter den obersten Gipfel des
mächtigen Kegels.
[140]
Dieser Berg ist mehr als ein eindrucksvolles Stück Landschaft. Er ist
Sinnbild und Gleichnis.
Die Eingeborenen nennen ihn Mongo ma Loba. Wenn
dieser Name Stütze, Pfeiler des Himmels bedeutet, wird man verstehen,
warum sie dieses äußerste Bollwerk ihres Landes gegen das Meer,
wie einst die Griechen den Felsen von Gibraltar, die tragende Säule des
Himmelsgewölbes hießen."
Das Klima
Selten werden sich in einem Lande soviel unvermittelt sich
gegenüberstehende Gegensätze finden wie in Kamerun. Wie die
Bodengestaltung voller Kontraste ist, so bieten auch die meteorologischen und
klimatischen Verhältnisse Bilder von sehr verschiedener Art. Gerade das
Klima aber ist im äquatorialen Kamerun für den Europäer von
ausschlaggebender Bedeutung; es spielt also in Kamerun eine viel
größere Rolle als in dem zum größten Teil nicht mehr in
den Tropen liegenden Südwestafrika.
Wer das Klima der feuchten Tropen nicht kennt, muß sich vorstellen,
daß man dort eigentlich niemals so ganz trocken wird. Der
Feuchtigkeitsgehalt der Luft ist sehr groß: ein Stück Schokolade, das
offen auf dem Tisch liegengelassen wird, ist nach kurzer Zeit vollkommen
aufgeweicht. Zur Regenzeit wird die Hitze noch unerträglicher; wenn die
kompakte Wassermasse, die man dort "Regen" nennt, vom Himmel
gestürzt ist und die Wolken sich verziehen, dann dampft alles; dichte
Schwaden weißen Brodems ziehen durch das
Buschwerk - es kommt einem so vor, als sei in einem überheizten
Raum die Dampfheizung geplatzt. Aber schließlich ist alles Gewohnheit
und Sache der persönlichen Konstitution; man muß allerdings ein
gesundes Herz haben. Eine Entschädigung für alle
Mißhelligkeiten, die das feucht-heiße Klima mit sich bringt, liegt in
der geradezu unbegreiflich üppigen Vegetation (von der noch zu sprechen
sein wird), in den tausend Wundern der Natur, des
Pflanzen- und des Tierreiches, die uns auf Schritt und Tritt begegnen.
Für die Witterung ist die Erwärmung der Luft über dem
Erdboden und der Luftaustausch durch Wärmeströmung
maßgebend. Die durch den senkrechten Sonnenstand hoch erwärmte
Luft über der Gegend des Äquators steigt senkrecht in die
Höhe, während als Ersatz für die oben abströmende
Luft von Norden und Süden her kalte Luft zufließt. In dem Gebiet der
aufgelockerten Luft ist der Luftdruck niedrig. Es kommt zu reichlichen
Niederschlägen. In etwa 30° Breite steigt die aufgestiegene Luft
wieder ab und erwärmt sich dabei. Die sich hier stauende Luftmasse ist das
Gebiet der niederschlagslosen Roßbreiten. Sie bringen zwar hohe
Wärmegrade, aber trockene Hitze, die der Mensch leichter erträgt als
das Dampfbad der Tropen. Nördlich und südlich des Äquators
liegt also eine sich drehende Luftwalze, die mit dem Hinundherpendeln des
höchsten Sonnenstandes sich im Sommer nach dem Sudan, im Winter nach
der Kalahari [141] hin verschiebt. Die
Hitze im Kameruner Küstengebiet wird außerdem durch den
kühlen, bereits von Südwest her bekannten Benguëlastrom
zum Teil gemildert. Wenn nachmittags die "Seebrise" einsetzt, wird diese als
Wohltat dankbar begrüßt.
In den Tropen gruppiert sich die Regenzeit um die Tage, in denen die
Sonne im Zenit steht. Infolge der starken, gerade von oben kommenden
Erwärmung lockern und heben sich die über der Erde lagernden
Luftmassen, kühlen sich beim Steigen schnell ab und lassen den
Wasserdampf, den sie mit sich führen, als Regen niederfallen. Da nun in
den Äquatorgegenden die Sonne zweimal jährlich im Zenit steht, so
müßten sie eigentlich zwei Regenzeiten
besitzen - aber da der Sonnenhöchststand hin und her pendelt und
die Regenzeit ihm nachhinkt, verschmelzen in der Nähe des
Äquators beide Regenzeiten zu einer. Also gibt es im größeren
Teil von Kamerun nur zwei Jahreszeiten, die Regenzeit vom
Mai bis Oktober und eine trockene Zeit vom November bis April.
Schwankungen kommen natürlich bei der großen Ausdehnung des
Gebietes vor, aber im allgemeinen verläuft der Wechsel mit großer
Regelmäßigkeit. Die Regenzeit wird von einer etwa
2 - 4wöchigen "Tornado"-Periode
begrenzt - der Zeit der wilden Gewitterstürme.
Dem Klima Kameruns fehlt der einheitliche Charakter, da von Norden her der
Einfluß der Sahara spürbar wird, von Süden und
Südosten her das Kongogebiet klimatisch einstrahlt. So ändert sich
die Regenhöhe von der Guineaküste nach dem Innern zu in dem
Sinne, daß im inneren Winkel des Golfs nur eine, nach dem Kongogebiet zu
zwei Regenzeiten, nach Norden zu wieder auch nur eine Regenzeit eintritt. Die
Regenmengen sind ebenso unterschiedlich, es fallen vom Tschadsee bis zur
Südgrenze 500 - 3000 und 10 000 mm
Regen.
Eine Sonderstellung nimmt der Kamerunberg ein - wie er infolge seiner
hohen und plötzlichen Erhebung aus dem Meere alle Vegetationszonen auf
sich vereinigt, so hat er auch von allen klimatischen Erscheinungen etwas
mitbekommen. Bis zur Höhe von 900 m herrschen die gleichen
Verhältnisse wie im Urwald - die wir gleich genauer kennenlernen
werden; dann folgen die für das Grasland charakteristischen Erscheinungen.
Auf der Westseite des Berges nimmt der Regenreichtum außerordentlich zu;
das Kap Debundja ist die regenreichste Stelle in ganz Afrika, und mit
einer am Südhang des Himalaja gelegenen Station in Assam, Cherrapunji
genannt, der ganzen Erde. Es wird jährlich die enorme Menge von
12 000 mm oder 12 m Regenhöhe verzeichnet; die
normale Niederschlagsmenge beträgt etwa 300 cm. Kaum ein Tag
vergeht ohne Sintflut, und in der sogenannten trockenen Zeit gehört eine
Periode von sieben regenlosen Tagen zu den größten Seltenheiten.
Maßlosigkeit der tropischen Natur!
Im Küstenvorland sind bei immer gleichbleibender feuchter Hitze die
Temperaturschwankungen gering; in Duala hat der heißeste Monat, der
Februar, ein Mittel von 27,3°, der kälteste, der Juli, von 24,4°.
Das beobachtete Maximum ist 32° - was etwa einem Berliner, ganz zu
schweigen von einem Stuttgarter, [142] nicht weiter
imponieren kann, da wir ja Temperaturen bis 35°, auch 36° im
Sommer, häufig genug zu verzeichnen haben; da aber das Minimum
19° beträgt, so wird uns die fürchterliche Gleichheit der Hitze
doch Respekt einflößen.
Das Urwaldgebiet also hat seine eigenen Gesetze. Dr. Plehn
schildert sie von Duala aus mit folgenden Worten:
"Die Jahreswende bezeichnet den
Höhepunkt der heißen, regenlosen Zeit. Hinter dem
gleichmäßig trüben Dunst bleibt die aufsteigende Sonne lange
völlig verborgen. Die Gräser sind mit reichlichem Tau
getränkt, der bald nach dem Sichtbarwerden der Sonne verschwindet. Die
Landbrise, die die ganze Nacht hindurch mit einer Stärke von drei und
darüber geweht hat, flaut ab und ist schon gegen 8 Uhr morgens gar nicht
mehr spürbar. Damit und mit dem Vorkommen der Sonne beginnt die
unerträglichste Zeit des Kameruner Aufenthaltes. Das neblige dunstige
Grau über dem Flusse verschwindet auch bei dem Zutagetreten der Sonne
nicht, und der Kamerunberg bleibt hinter der dicken Dunstschicht viele Wochen
verborgen. Trotz der relativ verringerten Luftfeuchtigkeit ist die Luft am Mittag
mit ihren 30 - 31°C unerträglich drückend,
namentlich am Flußufer zur Ebbezeit. Gegen 1 Uhr nachmittags tritt die von
Südwest wehende Seebrise ein, meist ziemlich unvermittelt und mit
beträchtlicher Kraft, trotz der Hitze Erleichterung verschaffend. Sie bringt
auch reichlich geballtes Gewölk mit herauf, durch das die intensive
Sonnenbestrahlung wenigstens zeitweise gemildert wird. Regen fällt zu
dieser Zeit selten, manchmal 3 - 4 Wochen gar nicht. Trotzdem
läßt sich an der Vegetation äußerlich kaum
irgendwelcher Einfluß der verringerten Feuchtigkeit erkennen, häufig
sind gegen Abend ferner Donner und Wetterleuchten. Stärkere Gewitter
sind in dieser Zeit sehr selten. Bis gegen Abend weht die Seebrise. Von
besonderer Pracht sind der Sonnenuntergang und die
Dämmerungserscheinungen. Die Nächte sind meist wolkenlos; den
Mond umgibt nicht selten ein trüber
rötlich-gelber Hof. Nicht lange nach Sonnenuntergang schläft die
Seebrise ein, um dann nach wenigen Stunden der Landbrise Platz zu machen, die
bis gegen Morgen anhält.
Nur kurze Zeit zeigt sich hier das geschilderte Bild der
Trockenzeit rein; wochenlang vor ihrem Eintritt, wie auch vor ihrem
Übergang in die Tornadozeit des Frühlings wechseln Tage des
beschriebenen Charakters mit solchen, die durch reichliche Bewölkung
wolkenbruchartige plötzliche Regen sowie durch das zeitweise Auftreten
von Tornados völlig den Charakter der Tornadozeit zeigen. Gerade in
dieser Übergangszeit, in der heftige Regengüsse mit intensivem
Sonnenschein abwechseln, zeigen sich die heißen Tagesstunden, in denen
die hochstehende Sonne auf den durchfeuchteten Boden brennt, ganz besonders
unerträglich.
Je weiter die Übergangszeit vorrückt, um so
spärlicher werden die sonnigen Tage, und einen um so
gleichmäßigeren Charakter nimmt der Regenfall an. Die Tornados
werden selten und schwächer, schwächer die elektrischen
Entladungen. Die Sonnenuntergänge sind meist klar, ebenso die
Nächte, soweit nicht [143-144=Fotos] [145] Regengewölk sie verfinstert. Die Landbrise nimmt an
Heftigkeit ab, die Regen kommen größtenteils von der See her. So
vollzieht sich allmählich der Übergang in die eigentliche Regenzeit,
die ihre Höhe wechselnd zwischen Juli und August erreicht. Selten ist
nunmehr der Anblick der Sonne; unablässig fällt aus dem
trüben, gleichmäßig grauen Himmel der Regen herunter, bald
anschwellend, bald nachlassend, nachts mit größerer Intensität
als tagsüber. Alles ist in einen matten, wässrigen grauen Schleier
gehüllt, Tümpel und Pfützen entstehen, kleine ausgetrocknete
Wasserläufe schwellen zu reißenden Bächen, Bäche zu
Flußläufen an. Die Windbewegung ist abgeschwächt; trotzdem
und trotz der zunehmenden Feuchtigkeit, die alle Gegenstände mit
Schimmel überzieht, empfindet der Körper die namentlich
nächtlich niedrigere Temperatur und das Fehlen der intensiveren
Sonnenbestrahlung sehr wohltätig, und das zeitweise Hervorkommen der
Sonne ist nichts weniger als angenehm und hat meist vermehrte
Fiebererkrankungen zur Folge.
Mit Unterbrechung dauert die Regenzeit bis in den Herbst
hinein; dann beginnt langsam in umgekehrter Weise die Wende zur Trockenzeit.
Der Pflanzenwuchs hat in dieser Zeit, wo sich die Einwirkung der Sonne zu der
des mit Feuchtigkeit getränkten Erdreiches gesellt, seine höchste
Entwicklung erreicht - zugleich aber auch die Fiebersterblichkeit, die bis
gegen den Eintritt der trockenen Zeit ansteigt. Die Schwüle an den
heißen Vormittagen ist besonders groß, und zu den
Fiebererkrankungen gesellen sich auch wieder die Leiden der Trockenzeit in
Gestalt von zunehmender Nervosität, von Darm- und Hautleiden. So
vollzieht sich unter allmählichem Zunehmen der heißen Tage etwa
im November wieder der Übergang zur
Trockenzeit."
So der Verlauf der Jahreszeiten im Urwaldgebiet.
Sehr viel günstiger gestaltet sich das Klima auf dem
Hochlandplateau, vor allem auf den am höchsten gelegenen
Steppen im Norden der Kolonie; es steht in direktem Gegensatz zu dem, was wir
bis jetzt als Tropen- oder Kameruner Klima kennengelernt haben. Die Besserung
zeigt sich schon auf den höhergelegenen Stationen im Urwald; in Jaunde ist
zwar das Maximum noch 32°, aber das Minimum 12°, und die einstige
Station Baliburg hat die ideale Durchschnittstemperatur von 18°
aufzuweisen. Trotzdem aber zeigt sich hier der Vorteil der
äquatorialen Gleichmäßigkeit. Der Temperaturunterschied des
wärmsten und des kältesten Monats betrug in Baliburg
1,6 - 2,8°, d. h. daß es selten mehr als 21°,
selten weniger als 15° ist. Berlin hat mit seinen Julitemperaturen von
30 - 33° und seinen Februarkälten von
20 - 25° Unterschiede von über 50° (!). Auch
die Niederschlagsmengen sind in der Höhe geringer, in Bali etwa um die
Hälfte als im Küstengebiet - manchmal hagelt es zum
größten Entsetzen der Neger auch hier.
Ein Gegenstück zu Plehns Schilderung der Urwaldwitterung gibt
Hutter für das Hochland.
[146]
"Versetzen wir uns in den Oktober und damit in die das Ende der Regenzeit
ankündigende Tornadoperiode. Der Morgen ist bereits nicht selten klar und
schön nach einer sternenhellen Nacht angebrochen; bisweilen hüllt in
den ersten Frühstunden dichter Nebel noch die Landschaft ein. Reichlich
liegt der Tau auf den unendlichen Grasflächen. Eine leichte Brise aus Ost
oder Südost trägt das Rauschen eines nahen Wasserfalles an unser
Ohr. Langsam steigt die Temperatur, die nachts auf 13° oder 12°
gesunken war, gegen Mittag auf 22° und 24° an; mit ihr steigert sich
auch die Stärke des Windes, der meist von Ost nach Südwest
umspringt und angenehm erfrischend wirkt; aber im Laufe des Vormittags ziehen
sich in dieser Periode Tag für Tag Gewitterwolken zusammen, und
nachmittags bereits oder spätestens abends entladen sie sich in kurzen und
heftigen Stößen.
Aus einem kurzen Tornado Kameruns kann man gut vier
schwere deutsche Gewitter machen. Die Häufigkeit der Blitze
läßt sich am besten durch den treffenden Ausdruck
»Blitzregen« charakterisieren. Ist bei leichteren Gewittern
ein Zählen der einzelnen Entladungen noch möglich, so gibt man das
bei einem schweren Tornado sehr bald auf und überläßt sich
rücksichtslos dem großartigen Schauspiel der entfesselten
Naturgewalten.
Schon das Heraufziehen eines Sturms am
äußersten Horizont läßt das Gewaltige des nahenden
Elementarereignisses ahnen. Schwer und breit schieben sich die Wolkenschichten
schwarz und dunkelgrau übereinandergebaut höher und höher,
und der noch in reichem Blau sich wölbende Himmel verschärft den
Gegensatz. Bereits ist ein Drittel von ihm überzogen, und immer noch
steigt die Wetterwand, obgleich der sich verstärkende Wind dagegen
anzuprallen scheint. Endlich kommt seitliche Bewegung in die Massen;
waagerecht zucken die Blitze durch die Schichten, und unaufhörlich rollt
der ferne Donner. Durch drei Himmelsquadranten zieht die
Wolkenwand - nun im Süden ein kurzes Stillstehen: wie ein Leopard
über sein Opfer fällt es in immer steigender Geschwindigkeit
über die winzige Behausung der winzigen Menschen her. Heulend setzt die
Windsbraut ein, und im Nu liegen ganze Bananenreihen auf der Erde, und durch
die zerfetzten Blätter der stehengebliebenen pfeift der Sturm. Die
Häuser wanken und ächzen, von den Dächern fliegen in
Garben die Grasbüschel, dunkler und dunkler wird es ringsum; jetzt der
erste nahe Blitz und Donnerschlag zugleich, daß der Boden erzittert. Nun ist
der Bann gebrochen; Blitz auf Blitz und Schlag auf Schlag zuckt und kracht es
herunter, hinauf, nach allen Seiten. Ein Feuermeer, ein Feuerregen und
Getöse wie rollendes Schnellfeuer aus Hunderten von Geschützen.
Mit dem ersten Blitzstrahl fast brechen auch die Wassermassen herab; wie
Sturzbäche tosen sie hernieder, und der Sturm schleudert sie dahin und
dorthin.
Trotz der so außerordentlichen Heftigkeit der
elektrischen Entladungen und trotz der Häufigkeit der Gewitter sind
Blitzeinschläge verhältnismäßig selten, wenigstens im
Hochland; an der Küste wird von zahlreicheren berichtet, aber auch da
beschränken sie sich auf leblose Objekte: Flaggenmaste, Bäume und
der- [147] gleichen, am
häufigsten sollen Kokospalmen von ihnen getroffen werden. Von vom Blitz
erschlagenen Menschen berichtet keine Quelle.
Am nächsten Tage wiederholt sich das gleiche
Schauspiel. So naht die zweite Hälfte des November. Die elektrischen
Entladungen werden schwächer, und schwächer wird auch der
Regen: die Trockenzeit kündigt sich an. Von Nordost kommen bereits die
»schwarzen Schneeflocken«, d. h. die niederfallenden,
schwarzgebrannten Grasüberreste, die der Wind Hunderte von Kilometern
aus dem tiefen Innern herantreibend hier niederstieben läßt. Mitte
November nimmt mit einem letzten grollenden Donner die Regenzeit ihren
Abschluß. Nun beginnen die schönen Tage der Trockenzeit. Die
charakteristischen Merkmale ihrer ersten Hälfte sind fast gänzlicher
Mangel an Gewittererscheinungen und an Regen. Kühl, ja kalt sind die
Morgen, 8° und 7° sind nicht
selten - noch lagert Tau, aber nicht mehr so stark, auf Blatt und Gras, und
prächtig erhebt sich in wolkenloser Bläue der junge Tag. Rasch
steigert sich die Temperatur bis aufs drei-, ja vierfache der Morgenablesungen,
aber kräftig bläst ein tüchtiger Wind aus Ost oder
Südwest übers Land, und kein Tag kommt einem wirklich
heißen, schwülen Julisommertag in der Heimat nur annähernd
gleich. Abends kühlt es sich rasch wieder ab; meist herrscht vollkommene
Windstille. Die Tage ausgenommen, an denen der austrocknende Hamattan aus
Nordwest anweht, läßt sich der Beginn der echten, rechten
Trockenzeit vollkommen zutreffend mit einer langen Reihe schöner
Herbsttage im bayrischen Vorbergland vergleichen.
Die Schattenseite jeder Reihe von schönen Tagen
fehlt auch hier nicht. Mit dem Aufhören der tropischen Unwetter hört
auch jeder Regen auf, und eine äußerst lästige Folge der
langandauernden Trockenheit ist der Staub, der den ganzen Körper, der
Kleidungsstücke spottend, und alle Gegenstände täglich mit
einer dichten Schicht überzieht. Die abgebrannten weiten Flächen
lechzen nach Regen.
Endlich sind die langen Wochen steten Sonnenscheins,
steter Trockenheit vorbei; es ist Mitte Januar. Endlich rollt wieder der lange nicht
mehr vernommene Donner, Wetterleuchten flammt da und dort, da und dort
steigen dunkle Wolken auf, und um die Mitte des Januar herum rauscht der erste
Gewitterregen mit ununterbrochenen elektrischen Entladungen herunter. Die
Temperatur kühlt sich hierbei rasch so bedeutend ab, daß die
Wasserniederschläge nicht selten als Hagelkörner
herunterkommen.
Eine Tornadoperiode in der Trockenzeit hat ihren Anfang
genommen; bis Mitte März kracht es und gießt es in gleicher Weise
fast jeden Tag. Dann folgt wieder eine Pause, aber nicht von sehr langer Dauer.
Von Ende März bis Anfang Mai kommen in bald längeren, bald
kürzeren Zwischenräumen die Tornados an. Im übrigen
herrscht bis Mitte Mai Trockenzeitgepräge. Von da ab werden die Gewitter
seltener und schwächer, die Stürme legen sich, der Himmel
hüllt sich immer mehr und länger in graues Gewölk, die Nebel
breiten sich immer häufiger über das Land, die Temperaturen
verlieren die der Trockenzeit eigenen [148] bedeutenden
Tagesschwankungen und verflachen sich. Morgens ist es nicht mehr so sehr
kühl, mittags nicht mehr so sehr warm, den ganzen Tag über windig,
der Feuchtigkeitsgehalt der Luft nimmt wieder zu, der afrikanische Sommer ist
zum Herbst geworden, und nicht lange dauert es, so befinden wir uns in der
richtigen Regenzeit.
Dichter Nebel hüllt des Morgens die Landschaft
ein, und feiner Sprühregen rieselt durchkältend und
durchfröstelnd nieder, vergebens wartet man auf einen erwärmenden,
erhellenden Sonnenstrahl; wohl jagt der sich allmählich erhebende
Südwestwind die schweren Nebelmassen fort, doch nur, um nun schwere
Regenwolken heranzuführen, die, tief herniederhängend, ihre Wasser
in gleichem melancholischen Plätschern auf die regenschweren
Grasflächen senden. Die kleinsten Bäche werden zu reißenden
Strömen, und gegen Abend ballt der nimmer rastende naßkalte
Südwestwind neue Nebelmassen undurchdringlich aufs neue und leitet so
unter stetem Regen den grauen Tag in die Nacht hinüber, die den
regensendenden Tag in gleicher Weise ablöst.
Für die Monate Juni, Juli und August ist dieses Bild
völlig zutreffend. Im September beginnen wieder die ersten schwachen
Donner zu rollen, die Windstärken wechseln, und während in den
eigentlichen Regenmonaten Wind, Wolkenzug und Regenrichtung Tag für
Tag in eintöniger Übereinstimmung waren, lassen sich endlich
wieder wohltuende Verschiedenheiten feststellen. Dadurch gelingt es auch hier
und da einem Stückchen blauen Himmel hervorzulugen. Freudig
begrüßt man die immer häufiger werdenden elektrischen
Erscheinungen, endlich scheinen auch die Wasserquellen ab und zu wenigstens zu
versiegen, und die Tornadoperiode des Oktober naht: der Kreislauf des Jahres im
Hochland nordwärts des meteorologischen Äquators ist
geschlossen."
In dem Gebiet zwischen Nordadamaua und dem Tschadsee, dem entferntesten
Zipfel Kameruns, nimmt die Wärme zu (Tagestemperaturen bis 42°),
die Niederschlagsmenge ab, und die Thermometerschwankungen verringern sich.
Trotzdem ist infolge der verdunstenden Tschadseegewässer der
Feuchtigkeitsgehalt der Luft ein sehr hoher, so daß die klimatischen
Verhältnisse nicht gut sind. Nachtigal berichtet, daß sich
nicht einmal die eingeborenen Bornuneger einer guten Gesundheit erfreuen;
für den Europäer dürfte der längere Aufenthalt dort
nicht ganz empfehlenswert sein.
So durchläuft allerdings das Klima Kameruns die größten
Gegensätze: Niederungen von feuchter, malariabrütender Hitze;
Hochlande mit gesunder, reiner, manchmal nördlich kühler Luft;
monatelange Trockenheiten auf der einen, tägliche Regengüsse auf
der anderen Seite; Tornados mit Hagel und qualmende Nebel; ein verdunstendes
Meer in "feuchtheißer Flachbeckensenke" - ein Land der
geographischen Verschiedenheiten, die von keiner anderen Tropengegend
übertroffen werden.
[149]
Die Tier- und Pflanzenwelt
Die starken Verschiedenheiten, die für die Bodengestaltung und das Klima
Kameruns bezeichnend sind, bestimmen auch die Verteilung der
Tier- und Pflanzenwelt - oblgeich die frei lebenden Tiere hin und wieder
die Grenzen ihres eigentlichen Gebietes übertreten mögen.
Eine Dreiteilung der Pflanzenwelt ergibt sich sogleich aus der
Landesbeschaffenheit selber: die Vegetation der
Sumpf- und Brackwassergegend, des Urwaldes und des
Hochlandes. Auch die Tierwelt fügt sich in dieses
Schema ein. Der Kamerunberg bildet auch hier wieder ein Gebiet für sich,
das von allen Zonen einen Teil besitzt.
In den Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten wird eine Bootfahrt
auf dem Mungo beschrieben, während der das
mannigfach-bunte Leben der Brackwasserfauna
und -flora an uns vorüberzieht:
"Von der Joßplatte geht die
Fahrt hinüber über das
Kamerun-Ästuar zur Einmündung des
Mungo-Kriek. Massen von Seeschwalben huschen über die
schmutziggelben Wasser, und ein Geieradler zieht am Strande entlang, nach
einer vom Meer ausgeworfenen Beute spähend. Unter der Gunst der
Strömung biegen wir in den Krieg ein, und mühsam sucht sich das
Boot in dem Gewirr von Wasserarmen seinen Lauf. Die fast feierliche über
der Landschaft liegende Ruhe, die nur selten durch das Kreischen eines Papageis
unterbrochen wird, übt einen eigentümlichen Eindruck aus. Bald
jedoch nimmt die eigenartige Ufervegetation dieser Brackwasserzone unsere
Aufmerksamkeit in Anspruch. In erster Linie fällt die Mangrove
auf durch die besonders zur Ebbezeit sichtbaren bizarren Formen ihres
stelzenartigen Wurzelwerks sowohl wie durch die oft seilartig ausgespannten oder
frei herabhängenden Luftwurzeln und das einförmige, matte, an
Weiden erinnernde Grün ihrer blanken, lederartig festen Blätter: sie
bildet zum größten Teil die Pflanzendecke der Ufer. Im Wurzelwerk
kriechen und klettern zahllose kleine eigentümliche Fische mittels ihrer zu
einer Art von Armen umgebildeten Brustflossen, kleine Krabben verschwinden
bei Annäherung schnell in ihren Löchern, schwarz und weiß
gefärbte Eisvögel streifen hin und her, Reiher,
Sumpf- und Schattenvögel holen sich von den Fischen und Krabben, und
der graugrüne Bülbül huscht durch die Büsche der
Mangroven.
Die Fahrt geht weiter in dem enger und enger werdenden
Kriek, in dem eine fast unerträgliche Hitze herrscht. Jetzt zeigen sich
große Büsche eines der Brachwasserzone eigentümlichen
gewaltigen Farnkrautes, ferner dichte Horste der herrlichen Weinpalme und
stattliche, reich mit Früchten beladene Pandanus, mit deren stachligen
Blättern man bei der Enge und den vielen Windungen des Kriek, der
stellenweise eine Breite von nur
1 - 2 m hat, in recht unangenehme Berührung
kommt.
Festeres Schwemmland beginnt. Die Rhizophoren
(Mangroven) treten mehr und mehr zurück, häufiger wird die Raphia,
Scitamineen zeigen sich, und [150] endlich mündet
der Kriek in den eigentlichen Mungofluß ein. Die Brackwasserregion ist
durchfahren. Wohl machen sich Ebbe und Flut auch hier noch durch Sinken und
Steigen bemerkbar, doch schon ist ständiger Abstrom vorhanden und
infolgedessen süßes Wasser. Rasch wird die Vegetation jetzt
mannigfaltiger, der Mangrovenwald wird zum Buschwald. Hier und dort erhebt
sich riesenhafter Eriodendron, dessen gigantische Formen gerade in dieser
Umgebung besonders auffallen. Außerordentlich dicht ist das Unterholz,
das, mit europäischem Maßstab gemessen, immerhin die
Höhen eines mittleren Buchen- oder Nadelholzwaldes erreicht. Auf ihm
haust eine hellbraune Ameisenart; die Tiere lassen sich bei unvorsichtiger
Annäherung des Kanus massenhaft in das Boot fallen und peinigen durch
widerlichen Geruch und noch mehr durch ihren schmerzhaften Biß, der
schon manchen Mungofahrer Hals über Kopf ins Wasser springen
ließ, sich so von den Quälgeistern auf die rascheste Art zu befreien.
Endlich auch findet das durch das stete Graugrün ermüdete Auge
lebhafte Farben. In strahlendem Weiß schimmern Blüten,
Schlingpflanzen leuchten rot und gelb, faustgroße, scharlachrote
Schmetterlingsblüten winden sich um abgestorbene Stämme,
tiefviolette Trauben eines anderen Gewächses ranken sich hinauf bis zu den
Spitzen der hohen Urwaldriesen, während wieder andere ihre langen,
gurkenähnlichen Früchte bis tief zum Wasserspiegel
herabhängen lassen. Blüten und Früchte, frisches, junges und
welkes Laub am gleichen Stamm: das ist es, was in den Tropen jeden Unterschied
der Jahreszeit in unserem Sinne aufhebt. Nie findet man ganz entblätterten
Wald, nie solchen in frischem, jungem Grün prangen.
In der undurchdringlichen Uferwildnis schreien
Affenherden, und in Scharen, laut lärmend, ziehen oben Graupapageien. Ab
und zu hört man einen mächtig rauschenden, langsamen
Flügelschlag: man schaut auf, und über einen weg fliegt ein
Nashornvogel mit mißtönendem Geschrei. Da und dort ist in die
dichte grüne Ufermauer ein Loch gerissen, das Unterholz geknickt und eine
tiefe Furche in die Lehmsteinwand eingegraben. Da ist ein Elefant
durchgebrochen, der seinen mächtigen Körper in den Fluten erfrischt
hat.
Das Vegetationsbild zu beiden Seiten des Flusses hat sich
unterdessen nicht unwesentlich geändert: der Buschwald ist zum
Mischwald, dem Mittelglied zwischen Busch und Hochwald, geworden.
Graziöse Ölpalmen und hochstämmige Melonenbäume
mengen sich in die bisherige Pflanzenwelt; und zahlreicher recken sich die Riesen
des unberührten afrikanischen Hochwaldes in die Lüfte: wir sind in
den Kameruner Urwald eingetreten."
Es wird vielleicht nie ganz gelingen, den Urwaldzauber mit all seinen Farben,
Dunkelheiten, Überraschungen, Unheimlichkeiten, Freuden und Leiden
dem mit Worten ganz deutlich vor Augen zu führen, der ihn nicht kennt.
Leider vermag es auch das Lichtbild
nicht - denn auf ihm verschwindet die Einzelheit, die aus
tausendfältigem Wirrwarr hervorleuchtend die Wildnis ungeheuer lebendig
macht. Außerdem aber verschieben sich die
Größenverhältnisse, die Gliederungen
verschwinden - kurz, wo das Auge in der Nähe über den
größten Reichtum [151] an Formen,
Färbungen und Nüancen schweift, bleibt auf der Platte eine
einförmige und wenig imposante Undurchdringlichkeit zurück.
Immerhin ist im Urwald sozusagen etwas los; man schlägt z. B. im
Vorübergehen zufällig an einen Baum mit
schwarz-weißer Rinde, die sich plötzlich auflöst und wegfliegt:
es waren lauter Schmetterlinge, die auf dem Stamm saßen und Mimikry
machten. Oder wunderbare Blüten hängen von Schlingpflanzen
herunter, aber wenn man sie pflücken will, greift man in lauter unsichtbare
Dornen und läßt sie lieber in
Ruhe - was auch auf jeden Fall vernünftiger ist. Kleine Vögel
stehen in einem Sonnenstrahl über einer Blume und bewegen die
Flügel so schnell, daß man nur den winzigen Leib im Licht
schimmern sieht - einen lebendigen Edelstein. Nur eine Tiergattung sieht
man im Urwald nie: die "wilden" Leoparden, Elefanten, Löwen,
Panther - sie sind im undurchdringlichen Dickicht verborgen und denken
gar nicht daran, den Menschen anzugreifen, wenn sie nicht angeschossen, in die
Enge getrieben oder plötzlich erschreckt sind. In der Nacht hört man
sie heulen - aber das ist alles. Reisende können wochenlang den
Urwald durchstreifen, ohne mehr als die Fährten der "reißenden
Bestien" zu finden, wenn sie nicht das sich verbergende Wild auf dem Pirschgang
aufstöbern. Gefahr droht dem Menschen von "wilden" Tieren jedenfalls
nicht - auch von Schlangen kaum, wenn man nicht gerade auf eine
größere giftige trifft - was sich aber vermeiden
läßt. Kleinere sind für den Europäer mit seiner festen
Fußbekleidung, die sie nicht durchbeißen können,
ungefährlich.
Allerdings - es gibt eine Sorte von Tieren, die jeder Urwaldkenner fürchtet,
weil sie in der Tat gefährlich ist: das Ungeziefer, nämlich
Sandflöhe, Ameisen, Ratten, Fliegen und sonstiges greuliches und
unappetitliches Zeug, das kriecht, klettert, fliegt, springt und hüpft.
"Die Ratten fressen Stiefel und
Sandalen an und machen nächtliche Kletterübungen am
todmüden Schläfer; die Fliegen dringen in Augen, Mund und Nase,
zerstechen den Körper und setzen sich, eitererzeugend, in Wunden. Die
Ameisen überziehen im Nu den wehrlosen Wanderer, den ahnungslos
Rastenden zu Tausenden und martern ihn mit ihren Bissen; die Sandflöhe
bohren sich heimtückisch unter die Nägel der Zehen, erzeugen dort
Geschwüre und machen den Menschen oft für Wochen vollkommen
marschunfähig.
Das sind die von Wissenden wahrhaft gefürchteten
wilden Tiere der Wildnis!"
Die Flüsse im Küstenland sind reich an Krokodilen,
Flußpferden und Fischen.
Die Vegetation des Urwaldes ist, ganz abweichend von unseren aus
Nadel- oder Laubholz bestehenden, höchstens streckenweise eine
Vereinigung beider zeigenden Wälder, von einer außerordentlichen
Mannigfaltigkeit - an die hundert verschiedenen Arten finden sich oft auf
wenigen hundert Quadratmetern zusammengedrängt. Eine der besten
Urwaldschilderungen gibt uns Pechuël-Loesche;
"In weiter, grün
überwölbter Halle nimmt das Waldmeer den Eintretenden auf. Das
Laubdach ist durch unzählige, oft wunderlich geformte Säulen an
20 m über dem Erd- [152] boden gespannt.
Ungeheure Stämme, astlos, schnurgerade und walzenrund, verlieren sich
nach oben in den Blättermassen. Zu ihren Füßen wuchern in
üppigster Fülle Gesträuch und Gestrüpp. Lianenranken,
sich kreuzend, verschlingend, die einen dünn und glatt, die andern von der
Stärke eines Schenkels und mit scharfen Dornen bewehrt, kriechen in den
seltsamsten Windungen auf dem Boden entlang und liegen zusammengerollt um
die Stammenden der Urwaldriesen gehäuft; dann wieder umklammern sie
in den mannigfaltigsten Umschlingungen Stamm und Geäst, schwingen
sich in luftiger Höhe von Wipfel zu Wipfel, ranken sich erwürgend
an den Stämmen hinan, oder hängen in wüstem Gewirr herab
bis zum Boden, mit ihren erdrückten, erstickten Opfern niedergerissen.
Über all diesem Chaos und den dichten Laubmassen
entfalten - da und dort durch eine Lücke
sichtbar - frei und hoch die mächtigen Stämme, die das Auge
in den niedrigeren Wipfeln hat verschwinden sehen, in einer Höhe von 50
und 60 m breit ausgelegte Kronen: ein Wald über dem
Walde."
Aber auch Hutter hat die auffallenden Merkmale des Kameruner
Urwaldes klar erkannt und geschildert:
"So bietet sich der Urwald zu Anfang.
Bald aber wird man vertrauter mit ihm und in ihm, und bald unterscheidet man
sehr wohl zwei ausgeprägte, verschiedene Formen: Hochwald und
Buschwald. Da und dort trifft man auf zwei weitere Bedeckungsarten der
Urwaldzone: auf Parklandschaft und Morast.
Anknüpfend an die Schilderung des
Gesamteindruckes, läßt sich der Unterschied zwischen Hochwald und
Buschwald kurzgefaßt am besten in der Aufzählung der hier, bzw.
dort fehlenden Glieder zeichnen. Der Hochwald ist der »Wald
über dem Walde«. Gesträuch und Gestrüpp fehlen
größtenteils; an ihre Stelle treten blattpflanzenartige dichte
Bestände niederer Farne und Moose; der Boden ist meist sandig. Der
Buschwald ist der »Wald unter dem Walde«. Dichtes
Untergeholz, Lianen usw. füllen ihn im reichsten Wachstum.
Tief atmet man auf, wenn nach tagelanger Wanderung
durch dieses Waldmeer der Fuß wieder freie, lichte Gegenden betritt, das
Auge endlich wieder Sonne und Himmel schaut und ein frischer Windhauch weht
statt drückender Schwüle und Dunst des Urwaldes. Ab und zu
wenigstens sind solche ersehnte Unterbrechungen die Parklandschaften.
Aus Gras, Buschwald oder dem reinen Busch setzen sie sich zusammen in der
Form, daß die waldigen Partien inselartig im hohen Gras liegen.
Das tiefe Gras der Parklandschaft ist natürlich
grundverschieden von dem weichen Rasenteppich unserer Wiesen. Gräser,
1 - 2 m hoch, bilden die Hauptmasse. Größere
Flecken sind besetzt mit den starren Schiefhalmen des berüchtigten
Elefantengrases, das 3 - 7 m hoch wird, und mit dem
westafrikanischen Tropenunkraut, der Canna indica. Das frische satte
Grün unserer heimatlichen Gräser fehlt diesem offenen Bestandteil
der Parklandschaften. An Stelle der Blumen treten verstreute Einzelpflanzen, vom
Strauch bis zum mächtigen Baum.
Als gewaltigster Vertreter der letztgenannten sei der
Affenbrotbaum, der Baobab, genannt, das Wahrzeichen der
Parklandschaft. Er ist die Eiche der Tropen; mächtigen, knorrigen
Stammes, wie der deutsche Baum, sendet er
be- [153] reits in geringer
Höhe gewaltige dichtbelaubte Äste in den mannigfaltigsten
Verrenkungen waagerecht hinaus. Gleich dem Wollbaum ist auch er ein gern
gesehener und viel benutzter Biwakbaum. Bietet jener zwischen seinen
weitausholenden Tafelpfeilern natürliche Kammern, so hat der Baobab den
nicht zu unterschätzenden Vorteil eines riesigen Naturregenschirmes.
Schlangenartig sich auf dem Boden hinringelnde Wurzeln, aber fast von der
Stärke eines Mannes, strahlen auf 30 und 40 Schritt nach allen Seiten aus.
An fast meterlangen Stielen hängen die Früchte in Gestalt von
riesigen, gelbgrünen Gurken hernieder.
In der Parklandschaft findet man auch die nach
heimatlichen Begriffen in einer richtigen Tropenlandschaft unbedingt
notwendigen Palmen in größerer Zahl: die Ölpalme, die
Wein- und die Kokospalme, in Gruppen für sich und miteinander
vermischt. Auch der palmenähnliche Melonenbaum und
Fächerpalmen finden sich gleichfalls, büschelförmig stehend.
Das eigentliche Reich der Kokospalme ist die Nähe der See; weiter
einwärts tritt sie immer vereinzelter auf."
Die letzte ortseigentümliche Abwechslung, die die Urwaldregion bietet, ist
ebenso unerfreulich, als die Parklandschaft mit Vergnügen
begrüßt wird.
"Morastige Strecken, in den
Niederungen des Nordteils und in den ausgedehnten Gebieten des
Südkameruner Urwaldes, erschweren das Vorwärtskommen ganz
außerordentlich durch ihren Pflanzenwuchs, ebensosehr fast wie durch den
sumpfigen Boden selbst. Dschungelartig wachsen cannaähnliches Schilf
und Elefantengras hoch und dicht in Mengen.
Nässe- und sumpfliebende Stauden und Gestrüpp mengen sich
darunter, und der Pflanzenwuchs, aus Gräsern, Schilf und niederem Busch
bestehend, verfilzt sich förmlich. Dazu kommt, daß derartige Stellen
mit Vorliebe von Elefanten als Suhlen benutzt
werden - und welch metertiefes Gemisch von Schlamm und Sumpf und
Morast, zertrampeltem Schilf und Gras und Busch diese ungefügen
Dickhäuter dabei zu schaffen vermögen, kann nur der sich vorstellen,
der unter Verwünschungen durch den zähen, stinkenden Schmutz
und Schlammbrei sich durcharbeiten muß, in dem die Stiefel bei jedem Tritt
fast steckenbleiben!"
Den Reichtum der Insektenwelt, der so unwillkommen ist, haben wir schon
erwähnt; zu den Ameisen gesellen sich Termiten, die ihre Bauten
freistehend errichten oder an Bäume ankleben, unzählige Zikaden
bringen ein beinahe gellendes Zirpen hervor; Gespenstheuschrecken, die einem
trockenen Blatt, einem dürren Zweige gleichen, tauchen auf, rote,
glänzende Libellen schwirren über den Wasserläufen, und,
schönstes von allem, wunderbar gefärbte Schmetterlinge aller
Schattierungen und Zeichnungen von Schwarz bis zum schimmernden
Weiß, riesenhafte Tiere, größer als die ausgespannte
Männerhand, taumeln schweren Flügelschlages vorüber. Das
ist für den Neuling einer der merkwürdigsten Anblicke: der
majestätisch langsame Flug dieser großen Schmetterlinge, da wir das
unruhige Flattern unserer kleinen Falter gewohnt sind. Moskitos, die zu den
schlimmsten Quälgeistern der Menschen gehören, sind überall
da, wo es feucht und warm ist; im Kamerun kommt noch die Tsetsefliege hinzu,
die die gefährliche Eigenschaft [154] hat, die Schlafkrankeit
zu übertragen. Bunte Eidechsen, die Agama, häufig 50 cm
lang, schlüpfen über den Grund und beteiligen sich an der Vertilgung
des Ungeziefers - ohne daß eine sichtbare Abnahme der teuflischen
Flieger festzustellen wäre.
Charakteristisch für Westafrika sind die Vogelansiedelungen, deren
Mitglieder sich ganz bestimmte Baumsorten aussuchen und oft vollkommen
ruinieren. So zerzaust sind die Blätter, so kahl ist die Krone, daß sie
"wie ein Besenreis" in die Luft ragt. So ist z. B. die Ölpalme
häufig von den Nestern der kleinen Webervögel bedeckt,
die die Tierchen sich zu Hunderten auf einem Baume sehr kunstvoll aus
Reisern, Bastfastern und biegsamen Grashalmen bauen. Der
Nashornvogel, ausgezeichnet durch seinen mächtigen Schnabel,
kommt am häufigsten in Parklandschaften und im Hochwald
vor - auch er ein Tagesvogel, während der rabengroße, aber
blau-gelb-braun gefiederte Turako nur abends und morgens durch das
Holz streift, ebenso wie die Graupapageien, die besonders vor Sonnenuntergang
den Wald mit ihrem recht mißtönenden Geschrei erfüllen.
Wenn man die Papageien nennt, muß man auch der Affen Erwähnung
tun, dieser vierfüßigen Komiker im Busch; Brehms Wort, daß
der Papagei der gefiederte Affe ist, ist wohl berechtigt. Und wo man in Afrika
Papageien findet, sind auch die Affen nicht weit.
Da sind in erster Linie die verschiedenen Arten von Meerkatzen zu nennen;
Schimpansen sind häufig, und nicht selten ist jener gewaltige
Zweihänder, dessen Urheimat ja in Guinea liegt, der von einem
förmlichen Sagenkranz umwobene Gorilla. Am unteren Mbam
und in verschiedenen anderen Gegenden, wie westlich der Yaundestation, ist er
geradezu häufig. Das erwachsene Männchen, größer als
der Mensch (bis 2,40 m Höhe) und weit breitschultriger (bis
1 m), mit langen, ungemein kräftigen, muskulösen Armen und
gewaltigen Händen, mit kammartig gewölbtem Nacken, der breiten,
tiefdurchfurchten Nase, dem mächtigen, vorspringenden Maul, aus dem ein
furchtbares Gebiß mit scharfen Eckzähnen vorfletscht, der schwarzen
Behaarung, die sich auf dem Genick zu einer sich sträubenden
Mähne verlängert - bietet einen furchtbaren Anblick.
An kleineren Säugetieren kommen im Urwald Buschkatzen,
Stachelschweine, Antilopen, eine kleine rote Büffelart vor; ferner gibt es
natürlich Elefanten und Leoparden - alles Tiere, die auch auf der
Hochlandsteppe zu Hause sind. Von den Schlangenarten mögen die
größte und ganz harmlose, die Python, die bis zu 6 m lange
"Riesenschlange", und die kleinste, wenigstens für den unbekleideten
Eingeborenen gefährliche schwarze Natter erwähnt
werden - sie soll den in ihre Nähe kommenden Menschen anspringen
und mit ihrem Biß tödlich vergiften. Endlich existieren die
üblichen Nachttiere, wie Fledermäuse, fliegende Hunde und
dergleichen geisterhafte Unwesen, die sich nur durch klagendes Geschrei und
sonderbar weiches Vorübergleiten im Dunkel bemerkbar machen.
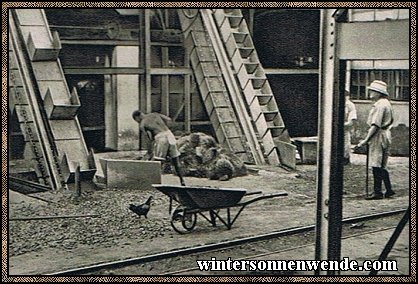
[144]
Kameruns Arbeiter befördern die Ölfrüchte
in den Sortierraum. Auf den Plantagen werden, soweit als möglich,
moderne Arbeitsmethoden angewandt.
|
Eine Anzahl von Nutzpflanzen war für unsere Kolonie
wichtig.
[155] Der Steilhang der
Hochplateaus, die Vorberge und Täler sind mit Waldungen von
Ölpalmen bedeckt:
"Die Gewinnung des Öles geht
in der Weise vor sich, daß die an den Fruchtständen
abgepflückten Palmnüsse, wie sie sind, in Wasser erhitzt und dann in
großen Trögen mit Stößeln oder den bloßen
Füßen ausgestampft werden. Bei reichlichem Zugießen von
Wasser schwimmt das aus dem Fruchtfleisch durch das Stampfen
herausgepreßte Öl oben, wird abgeschöpft und zur Reinigung
von anhaftenden Fasern durchgesiebt. Die Siebe der Eingeborenen bestehen aus
feinmaschigem Gitterwerk von Pflanzenfasern."
Das wertvollste Ausfuhrgut
Kameruns war der Kautschuk
(Gummi) - es gab Zeiten, in denen während der auf dem
Weltmarkt herrschenden Hausse das Kilo Kautschuk, das heute in England
weniger als einen Schilling kostet, mit neun, ja sogar mit achtundzwanzig Mark
bezahlt wurde. Eine "wilde Jagd" auf Kautschuk begann; "die ganze
arbeitsfähige Bevölkerung war in Bewegung geraten; die
Dörfer waren leer. Was nicht in den Wäldern Gummi zapfte, war als
Träger von und nach der Küste unterwegs", sagt Dr. Theodor
Seitz, der von 1907 - 1910 Gouverneur von Kamerun war.
Der im Urwald wildwachsende Gummibaum wird eingekerbt und die
herausträufelnde Flüssigkeit in Gefäßen aufgefangen.
Die Eingeborenen, denen nach dieser Methode die Gewinnung aber nicht schnell
genug ging, schlugen häufig die Bäume ab und erhielten den
gewünschten Stoff nun allerdings reichlicher und rascher; aber die
Bäume waren für immer vernichtet. Infolgedessen sah man sich trotz
der unermeßlich großen Bestände nach einem Ersatzbaum um
und fand diesen auch: die sogenannte Kixia elastica, deren Wurzel
Kautschuk liefert.
Reiche Ernten liefert vor allem der Kakaostrauch, sowie die in ganz Adamaua
wild wachsende Kolanuß und die überall als Farmpflanze gebaute
Erdnuß: die Kerne der ersten, von bitterem Geschmack, haben belebenden
Einfluß auf die erschlafften Nerven; die Erdnuß hat sich in den
Nachkriegsjahren als sehr wohlschmeckende und billige Näscherei bei uns
überall eingebürgert. Wie jeder, der sie gern ißt, weiß,
enthält sie einen hohen Ölgehalt.
Außer einer Reihe von Nutzholzarten finden sich manchmal auch
wildwachsend der Kaffeebaum, der Pfefferstrauch und andere
Gewürzträger, Baumwollpflanzen, Reis, die Indigopflanze und die
Tabakstaude; kurz, alles, was das Herz eines Kolonialwarenhändlers nur
begehren kann, ist aus der verlorenen Kolonie
herauszuholen, - dazu bietet Adamaua noch einen unendlichen
Überfluß an Mais und Hirse... Wieviel Menschen könnten dort
Beschäftigung erhalten, wieviel Konsumenten hier billig ihr Leben
angenehmer gestalten, wenn - nun: wir wissen eben, daß es eines
Tages anders werden muß!
Den Urwald des Küstengebietes und des höher gelegenen Landes
haben wir durchwandert; nun stehen wir am Rande der Steppe, auf dem
Hochplateau.
Zwei verschiedene Welten liegen vor den Augen des Forschers, wenn er, auf den
Höhen von Bali haltmachend, den Blick nach Süden und Norden
wendet. Rückwärts gegen Süden stürzen die
Hänge ab in Täler und Schluchten, und [156] Berg reiht sich an Berg,
mit Ölpalmen überdeckt, aus Tiefen von 500 und 1000 m
rauschen Wasser herauf - vorwärts nach Norden, Osten und Westen:
Hügelwelle auf Hügelwelle, dazwischen weite Täler, und wie
grüne Wogen schwanken in ungemessenen Flächen die hohen
Schilfgräser darüber hin.
Der erste Anblick dieser wogenden, grünen Meere ist
überwältigender fast als der der Urwaldmassen des Waldgebiets. Da
unten wirken die Ausmaße in der großen Höhe, hier oben die
maßlosen Flächen... Blumenschmuck ist reinen Grassteppen fremd,
nur verstreut wächst die mattrot oder gelbblühende Indigostaude.
Gespenstisch ragt ab und zu das knorrige, krüppelhafte Geäst einer
einzelnen Zwergakazie aus dem Halmenmeer empor. Die Rinde ist geborsten,
Stamm und Äste sind angekohlt von den jährlich wiederkehrenden
Grasbränden; doch unermüdlich sprossen bald wieder die
Blätter, unermüdlich ersetzt der zählebige Baum, was das
Feuer zerstört hat.
Doch entbehren auch die eigentlichen Grasgebiete durchaus nicht höherer
Vegetation. In den Mulden und Tälern längs der zahlreichen
quellfrischen Wasserläufe ziehen sich Waldstreifen hin: dichter Busch,
Buschwald und hohes Schilf auf feuchtgrundigem, streckenweise sogar
sumpfigem Boden. Diese Waldstreifen bleiben ewig grün und frisch. In
ihnen erinnert uns die Natur, daß wir eben doch mitten in den Tropen uns
befinden; als wollte sie uns für die sonst so einfachen Pflanzenformen
entschädigen, häuft sie in diese in die Talsohlen eingesprengte
Buschvegetation eine solche Überfülle der Lebenskraft, daß es
jeder Gesetzmäßigkeit zu spotten scheint. Hier treffen wir die meisten
Bekannten aus dem Buschwald der Waldlandstufe wieder.
In diesen Mulden und Tälern findet sich auch in langausgedehnten Hainen
die Raphia, diese dem reinen Grasland so recht eigene Palme. Ihre Bestände
treten nicht selten an Stelle der Buschwaldbäume; an anderen
Wasserläufen sind Laubbäume und Weinpalmen gemischt.
Ein so häufiger Baum auch die Raphia ist, das Auge erfreut sich doch
jedesmal wieder an dem Anblick dieser vollendet schön gebauten Palme.
Geradezu riesenhafte Gebilde bekommt man zu sehen. Der Wurzelstock oder
Stammstock hat einen Umfang von 3 m,
30 - 40 Wedel, jeder ist 15 - 20 m lang und am
untern Ende der Blattrippe fast schenkeldick: solche Palmen sind durchaus keine
Seltenheit.
Die Tierwelt des Hochlandes umfaßt außer den Arten, die
wir schon im Waldland kennengelernt haben, auch einige Schlangenarten; die
Rhinozerosschlange ist ziemlich gefürchtet. Schlimmer aber als alle
anderen Tiere können die Wanderheuschrecken werden, gegen die
der Mensch machtlos ist. Ein Bericht aus Baliburg sagt:
"Gegen 2 Uhr nachmittags kamen
vereinzelte Tiere aus Osten, gewissermaßen als Aufklärer voraus, und
nun auf einmal, 10 Minuten nach 2 Uhr, quollen zwischen zwei Hügeln, in
einer Breite von mehreren Kilometern, die dichtesten Wolken, so dicht und breit,
daß ein Durchsehen unmöglich war und buchstäblich
Dämmerung eintrat. Das Geräusch dieser [157] Tausende von
Milliarden gleicht dem entfernten Rauschen eines mächtigen Wasserfalles.
Im Augenblick war alles besetzt, Hütten, Wege, Geräte,
Bäume, Boden; alles so dicht, daß auch nicht das geringste des
bedeckten Gegenstandes mehr sichtbar war. Als der Schwarm nach Norden und
Nordwesten weiterzog und die Sonne von rückwärts in die Massen
hineinschien, glaubte man das dichteste Schneegestöber zu erblicken,
hervorgerufen von dem Glitzern der von den Sonnenstrahlen weißen
Flügeln der Tiere. Der Neger ißt sie roh oder in Palmöl
gebraten mit Leidenschaft..."
Der Elefant ist im Hochland ebenso häufig wie im Wald;
außerdem aber ist der Antilopenreichtum der Steppe bemerkenswert, die
viele verschiedene Arten, von der kleinen Zwergantilope bis zur riesigen
Kuhantilope, birgt. Auch Affen, Eichhörnchen, Baumratten, Schuppentiere,
wilde Katzen und schließlich als "Räuber" der Leopard: die ganze
Steppe scheint ein ausgedehnter zoologischer Garten zu sein. Noch weiter im
Innern, auf der Hochfläche von Ngaundere, gesellen sich Hyänen,
vereinzelt auch Löwen und ganz sporadisch auch Nashörner zu den
anderen Arten. Den größten Reichtum zeigt aber die Vogelwelt an
den vielen Hochlandflüssen - schwarze Störche und Reiher in
ungeheuren Massen, Ibisse, Enten, Trappen, Wildgänse, Bekassinen,
Rohrdommeln, Marabus: immer wieder der gigantische Überfluß, das
Überschwengliche der Tropen!
Die Bevölkerung
Wir treffen Sudan- und Bantustämme auf Kameruner Boden: die
Bantuneger im Küstenland, im Urwald und im Süden des
Kameruner Hochlandes, die Sudanneger im nördlichen Hochland,
in Adamaua und im Tschadseegebiet - wo auch die zu Nichtnegerrassen
gehörigen fremden Einwanderer wohnen. Alle drei Gruppen befanden sich
vor nicht allzu langer Zeit noch auf Wanderungen - wir erinnern uns,
daß die Hereros in Südwestafrika zu den Bantus
gehören - und sind erst in neuerer Zeit seßhaft geworden.
Einzelne Stämme mögen auch jetzt noch nicht zur Ruhe gekommen
sein.
Es würde den Rahmen dieser Darstellung überschreiten, wenn wir
die Geschichte der Negerwanderungen, die nach Kamerun führten, im
einzelnen verfolgen wollten. Es sei nur so viel gesagt, daß der
Sudan in den Verschiebungen der Völker Afrikas eine
große Rolle spielte und mit seinen Reichtümern, seiner Fruchtbarkeit,
seinen Wasserläufen die armen Wüstenvölker immer mit
großer Kraft anzog. Der Islam drang im Mittelalter bis tief in das Innere vor;
große Sudanreiche entstanden, wuchsen und
vergingen - wie der Staat Bornu -, neue Völker
erschienen, die "Fulbe" oder "Fulla", das heißt die
"Gelben", genannt wurden: Sie kamen aus Marokko und erschienen im 11.
Jahrhundert am Niger. Diese Gelben lebten nur als Geduldete unter den
Negerstämmen und hielten ihre Rasse rein, während ein anderes
Volk nordafrikanischen (hamitischen) Ursprungs dies nicht tat: die
Haussa, die große Staaten, wie Sokoto, gründeten,
sich stark mit den Negern vermischten und schließ- [158] lich zu dem heute sehr
ausgebreiteten Stamm wurden, der wenigstens seinen Namen bewahrt hat. Die
Fulbe erschienen auch in den Haussastaaten, aber wiederum hielten sie sich rein
und fachten im Anfang des 19. Jahrhunderts einen Aufstand aus religiösen
Gründen an, der die Haussastaaten beseitigte; nur das Bornureich konnte
sich behaupten.
Der Mahdiaufstand in Ägypten kostete ihm schließlich die Existenz:
der Sultan, Rabeh, dehnte seinen Eroberungszug bis an den Tschadsee
aus, zertrümmerte den Bornustaat Scheich Auars und beherrschte sein
riesiges, quer durch Afrika reichendes Gebiet von der Hauptstadt Dikoa
aus, die mehr als 100 000 Einwohner hatte. Aber auch diese letzte, blutige
und bei aller Orientromantik grausam-fanatische Herrschaft Afrikas mußte
der überlegenen europäischen Kriegstechnik, deren Waffen auch
wildester fanatischer Glaubenshaß nicht standzuhalten vermochte, weichen.
Die Franzosen rüsteten eine Anzahl von Expeditionen gegen den ohne
Frage imponierenden Despoten aus; am 22. April 1900 wurde Rabeh bei
Küsseri geschlagen und fiel: ein Mann außergewöhnlichen
Formates, der "Napoleon Zentralafrikas". Sein Reich wurde nun von den
europäischen Kolonialmächten aufgeteilt.
Die Fulbe aber dehnten die nunmehr in ihren Besitz gekommenen Haussareiche
weit aus - das heute Adamaua genannte Gebiet gehörte ihnen. Eine
ganze Reihe von Fulbestaaten wurde
errichtet - bis hinunter nach Ngaundere und Tibati, und
Außenposten wurden vorgeschoben bis tief in den Süden an die
Grenzen der großen Kongowälder. Die Haussa aber, die
durch ihre Vermischung mit den Negern viel Verschlagenheit und List geerbt,
wurden, was sie heute noch sind: die großen Handelsmänner des
Sudans und Mittelafrikas. Überall haben sie ihre Wohnstätten, von
der Küste Kameruns, von Senegal bis nach Kairo: ihre Karawanen
durchziehen die Länder, und Reichtümer wurden erworben. Ihre
Macht wuchs, wurde groß und besiegte schließlich die einstigen
Unterdrücker, die Fulbe, zwar nicht politisch, aber wirtschaftlich: die Fulbe
verarmten und den Haussas ging es gut.
In den Gebieten, die von den Fremden aus dem Norden Afrikas überrannt
wurden, saßen Sudanneger; die Fulbe betrachteten sie als
geeignete Objekte für die Sklavenjagd. So flüchteten die Neger zum
Teil, andere wurden verkauft, vernichtet; aber es gelang auch manchem, sich in
Adamauas Felsnestern zu halten, gegen die die gute, vermutlich
beduinenmäßige Reiterei der Fulbe nichts ausrichten konnte. Im
ganzen aber schoben sich die Sudanneger nach Süden, trafen auf andere
ihres Stammes, neuer Kampf um Land und Wohnsitz entspann sich; aber
schließlich kam das unruhige Wesen doch zum Stillstand, und zwar an einer
Grenze, die mitten durch Kamerun hinläuft: der Hochlandrand im
nördlichen Teil, das Sanagaufer im südlichen Teil bezeichnen sie.
Hier begann und beginnt das Gebiet der Bantuneger. Geschichtliche
Überlieferungen fehlen diesem reinen Negerstamm: die Geschichte der
islamischen Reiche ist von der hohen alten arabischen Kultur der
Eroberervölker aufgezeichnet worden.
[159] Es ist wahrscheinlich,
daß die Küstenländer und die Waldzone von einer heute wohl
so gut wie ausgestorbenen Urbevölkerung bewohnt waren; ihre
letzten Reste haben sich in den tiefsten Urwald
zurückgezogen - Zwerge, wie sie auch in anderen
Wäldern Afrikas angetroffen und sogar gefilmt worden sind.
An der Völkergrenze zwischen Sudan- und Bantunegern aber setzten sich
die blutigen Kämpfe fort, die erst allmählich aufhörten, als die
Europäer ins Land gekommen waren. - Die Stationen, die
eingerichtet wurden, "stehen wie Felsburgen inmitten der Völkerbrandung.
So kurzen Bestand sie auch haben, so gewährleisten sie doch den
gegenwärtigen Stand und Sitz der Stämme und vermindern die
Fehden, die die Bruderstämme in unbegreiflicher Verblendung gegenseitig
führen, so ihren Erbfeinden in die Hände arbeitend. Sie garantieren
stabile Verhältnisse, wenigstens hinsichtlich größerer
umwälzender Verschiebungen."
Eine Unzahl von Namen klingen auf, wenn wir die Stammliste der Neger von
Adamaua bis Tibesti verfolgen - die Batta, die Musgu, die Baia im Norden,
die Bakundu, die Duala, die Bakoko, die Maka im
Süden - um nur ein paar von ihnen zu nennen. Ein anderer
Bantustamm ist erst in verhältnismäßig junger Zeit in die
Waldgebiete eingewandert - die Fang- oder Pangwe. Alle diese
Negerstämme sind einander ziemlich ähnlich; die Verschiedenheiten
der Sprache enthalten wohl die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale.
Natürlich sind auch die Anlagen und Neigungen der einzelnen
Völker nach ihrer Art voneinander abweichend.
Von den Zwergvölkern sagt Curt v. Morgen (aber wir
dürfen nicht vergessen, daß die Worte Zeiten der neunziger Jahre
beschreiben):
"An dem unbewohnten
Urwaldgürtel dicht östlich von Kribi verkünden hin und
wieder Pfiffe und einige für den Europäer unartikulierte Zurufe das
Vorhandensein von Menschen, von denen schon Forscher im innersten Afrika
berichtet haben, und die hier, ohne festen Wohnsitz, lediglich der Jagd obliegen.
Zum Schutz gegen Regen und Kälte bauen sie sich auf ihren
Lagerplätzen kleine Hütten, befinden sich jedoch am Tage mit ihren
Familien stets auf der Wanderung, um dem Wild
nachzustellen."
Dr. Plehn macht einige Angaben über das
Äußere:
"Stirn niedrig, unterer Gesichtsteil von
der Nasenwurzel ab vorgeschoben, Nase kolossal breit, plattgedrückt, mit
gewaltigen fleischigen Flügeln; Gesicht besonders um den Mund herum
faltig; Lippen dünn, stark behaarter Oberkörper, Farbe heller als bei
den übrigen Negern, kupferig und mit erdigem
Ton."
Ganz anders beschaffen ist der Bantuneger, den Passarge
folgendermaßen beschreibt:
"Die Hautfarbe wechselt sehr.
Hellbraune bis rotbraune Leute, ja ganze Stämme sind nicht selten. Ihrer
Physiognomie nach sind sie durchweg echte Neger. Der Schädel ist rund
und plump, das Haar wollig, die Stirn im allgemeinen mittelhoch und meist
zurücktretend. Das Gesicht ist rund und breit, die Nasenwurzel gleichfalls
rund und flach, die Nasenflügel stark aufgebläht, die Nasenspitze
stumpf und oft aufgestülpt. Die Lippen sind dick, wulstig und
geschwungen, alle Fleischteile meist massig entwickelt. Der Körper ist
gewöhnlich plump und knochig und hat ein reichlich entwickeltes
Fettpolster."
[160] Der
Sudanneger bildet den Übergang von
Mittel- zum Nordafrikaner. Einwandfreie körperliche Rassenunterschiede
zwischen Sudan- und Bantunegern sind nicht vorhanden.
Ebenso stellt der Haussa infolge seines Mischblutes eine
Übergangsform in seiner Erscheinung dar.
"Im allgemeinen kann man sagen,
daß sie zwischen dem Typus der Saharabewohner einerseits, dem des
Bantu-, sowie des Sudannegers andererseits stehen und bald nach dieser, bald
nach jener Seite hin die mannigfaltigsten Übergänge und
Kombinationen in Körperform und Gesichtsbildung aufweisen: hier ein
plumper, knochiger, zur Fettbildung geneigter Körper, dort eine schlanke,
magere und doch kräftige Gestalt; hier ein langes Gesicht mit schmaler,
sogar gebogener Nase, hoher Nasenwurzel und dünnen Lippen; oder sehr
häufig eine Mischung der Typen, wie lange hagere Gesichter, aber plumpe
flache Nasen nebst dicken Lippen, oder runde Gesichter mit geringer Entwicklung
der Weichteile, lange, aber flache und aufgestülpte Nasen; kurz alle nur
denkbaren Variationen der Formen sind zu beobachten, doch sind gerade die
Extreme eine Ausnahme, Mischung der Charaktere die Regel. Alle aber haben die
dunkle Hautfarbe und echtes Negerwollhaar, wenn vielleicht auch nicht ganz so
dicht wie bei den Negern reiner Rasse" (Passarge).
Die Fulbe drangen als friedliche Hirten in die Haussastaaten ein, die sie in einem
blutigen Aufstand durch ihre Reiter eroberten. Sie sitzen im Hinterland von
Kamerun, in Adamaua, und sind Mohammedaner.
"Bei den hellsten Fulben ist die Haut
sehr hellgelb, wie helles Leder, aber stets mit einem Stich ins Rote. Was den
Fulbe vom Neger unterscheidet, ist der schlanke, feinknochige, sehr magere und
doch sehnige Körper. Oftmals haben wir über diese mageren,
scheinbar verhungerten Windhundgestalten unsere Beobachtungen angestellt, die
trotz der scheinbaren Schwächlichkeit bei spärlicher Nahrung
große körperliche Anstrengungen, besonders unglaubliche
Marschleistungen vollführen können, ganz wie die
Wüstenstämme. Der Schädel ist meist mittellang, die Stirn
hoch, das Gesicht lang und schmal, die Nase lang und gerade, Wurzel und
Rücken schmal und hoch, die Flügel zart und klein, desgleichen die
Lippen. Das Haar ist schwarz, wellig und zeigt keine Spur der Negerwolle. Bei
den Frauen erreicht es einen halben Meter und mehr Länge. Die Frauen
sind, solange jung, z. T. große Schönheiten; nur ihre Magerkeit
wirkt häufig störend. So mancher und manche Fullah würde
als Marmorbüste wohl eher für einen Hermes oder eine Diana, als
für einen afrikanischen Typus gehalten werden."
Trotz der günstigen Lebensbedingungen der Tropen waren die
Gesundheitsverhältnisse naturgemäß nicht die besten; alt
wurden und werden die "Naturneger" nicht, durchschnittlich etwa 40 Jahre. Auf
dem Hochland sind Lungenkrankheiten, im Waldland Lepra und Pocken nicht
selten; außerdem setzt auch die Malaria den Eingeborenen zu.
[161-162=Fotos] [163] Aber - der Naturneger werden immer weniger. Die alten
religiös-magischen Vorstellungen und Begriffe sind verschwunden, die
neuen Gedanken noch nicht richtig aufgekommen - so daß die in
vieler Hinsicht ihnen gefährliche Zivilisation im großen ganzen nur
Unheil angerichtet hat. Das gemeinsame Ziel der Mission und
der Kolonialbehörden, Erziehung zu freier, geordneter Arbeit, zu
der kein deutsches Kapital nötig ist und die den Neger auf sich selbst stellt,
verlangt Charakterschulung und Ertüchtigung von Hand und Verstand. Nur
sie können die Zerstörung der Stammessitten auf die Dauer
aufhalten.
So hat es eine immer stärker werdende Strömung in der
Mission gegeben, die auf die Erhaltung der alten Kultur Wert
gelegt hat; es ist ihr in den letzten Jahren auch gelungen, ihre Absichten an
einigen Stellen durchzusetzen. Der Umschwung der Geistesrichtung, der uns aus
der vollkommen kommerziellen Äußerlichkeit des 19. Jahrhunderts
auf den Weg der seelischen Erfassung geführt hat, verbreitet sich
von Deutschland aus über die Welt: es ist nicht unmöglich, daß
der neue Geist auch einmal in den "dunklen" Erdteil
übergreift - der immer dunkler wurde, je mehr das Licht der
"Zivilisation" leuchtete - und aus Karikaturen, aus "Hosenniggern", wieder
echte Neger macht; Errungenschaften auf gesundheitlichem Gebiet
werden dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.
Das Unheil selbst liegt in der Zersetzung, Auflösung und
allmählichen Zerstörung der urtümlich afrikanischen
Lebensgemeinschaften, in der Zertrümmerung der Sitten, der
völkischen Einheiten, die Mutterboden und Halt ihrer Kultur, ihrer
Sittlichkeit, ihrer Religion sind (Ludwig Weichert). Von der Hörigkeit
wurden die Afrikaner befreit, um als Sklaven auf den Kriegstheatern elende
Statistenrollen zu mimen. Dafür durften sie sterben. Ach, allzu teuer ist
dieser Tod! Denn sie opfern dazu noch ihre Unschuld (Leo Frobenius).
Interessant ist das verschiedene Urteil der Forscher über die ethischen
Qualitäten der reinen Naturneger. Eine gewisse Charakterlosigkeit, ein
völliges Hingeben an den Augenblick werden ihm zum Vorwurf gemacht
und mit dem Fehlen des kräftigenden Daseinskampfes entschuldigt.
Schlauheit und Pfiffigkeit unterstützen seinen starken
Handelssinn - er wird eine "ausgesprochene Schachernatur" mit allen
unschönen Folgerungen genannt. Aber auch dafür findet der gerecht
Denkende die Erklärung: der Neger ist jahrhundertelang von
Eroberervölkern aller Art unterdrückt, verjagt, übervorteilt
und - verkauft worden; seine einzige Waffe war die List. "Daß er",
sagt Hutter mit sehr erkenntnisreichen Worten, "auch uns Europäern
gegenüber von keiner besonderen Dankbarkeit erfüllt sein
kann - nun: dafür haben wir durch den jahrhundertelangen
Sklavenhandel und durch stete Übervorteilung bis zur Stunde gesorgt."
Der Fulbe steht natürlich auch charakterlich in scharfem
Gegensatz zum Neger.
"Der Charakter der Fulbe ist ein abgeschwächter Berbercharakter. Sie sind
als rinderhütende Nomaden eine ritterliche Nation. Arbeit, Handel und
Industrie sind nicht ihr Fall, Jagd, Krieg und Viehzucht dagegen ihre
Lieblings- [164] beschäftigung.
Der Fulbe ist wesentlich ernster und ruhiger, weniger geschwätzig und
leichtlebig als der Neger. Unzweifelhaft besitzt er mehr Selbstbeherrschung und
Selbstüberwindung" - nicht nur mehr als der Neger, fügt
Hutter, der die Stelle aus Passarge zitiert, hinzu, sondern auch
mehr - als wir...
"Energie, Stolz und Ehrgefühl
fehlen ihm nicht. Er kann auch wirklich
hassen - und mehr: überlegte Hinterlist ist ihm sicherlich zuzutrauen.
Er ist der größere Charakter, aber auch im gegebenen Moment der
größere Schurke, jedenfalls der gefährlichere Feind.
Bezeichnend ist es, daß er allein religiös fanatisch ist, der Neger nie.
Dafür ist er aber im Verkehr viel angenehmer, zurückhaltender,
weniger bettelhaft, kurz, von vornehmerer Gesinnung. Geldgierig und
habsüchtig ist er wohl in demselben Grad wie jener, aber er kann sich
bezwingen und zeigt es weniger."
Die Sudanneger, an erster Stelle die mit ihnen ja durch Vermischung
nahe verwandten Haussa, nehmen auch in ethischer Beziehung eine vermittelnde
Stellung ein: sie besitzen eine Reihe von Eigenschaften, die den
Wüstenvölkern eigentümlich sind und ihnen die
Überlegenheit über die Bantu sichern.
Eine soziale Gliederung findet sich bei den mohammedanischen
Völkern in sehr ausgeprägter Weise, wie ja schon aus den
Gründungen der erwähnten großen Staaten hervorgeht: die
Organisation dieser und auch der kleineren Sultanate war die der mittelalterlichen
Feudalstaaten mit absoluter Herrschergewalt des Fürsten. Aber auch bei
einigen Stämmen der Sudanneger in Adamaua sind manche
ähnliche staatliche Einrichtungen in ihren Anfängen
vorhanden - bei den Bamum z. B. gab es "Ortsvorsteher" und ein
ganz genau vorgeschriebenes Hofzeremoniell. Das alles gibt es bei den
Bantunegern nicht: die soziale Gliederung heißt hier nur Häuptling
und Volk, Freie und Sklaven.
"Kann ein Lamidoreich in Adamaua",
sagt Hutter, "mit seinem Hof- und Beamtenapparat, bei dessen Betrachtung wir
vollkommen vergessen, daß wir uns in Afrika bei den
»Wilden« befinden, überhaupt nicht mit einem Bantustamm
verglichen werden, so ist auch schon zwischen einem solchen und dem kleinsten
Sudannegerstamm der Kontrast ein außerordentlich großer; dort der
erbärmliche, von seinen Dorfuntertanen geprügelte
Dorfschulze - hier die 1000köpfige Menge, die lautlos den Gesetzen
lauscht, die der Herrscher nach beendeter Ratsversammlung seinen Untertanen
verkünden läßt, hier die ehrfurchtsvoll dem Häuptling
nahende Gesandtschaft, der ihr in würdevoller Haltung, in seine Tobe
gehüllt, Audienz erteilt - dort der mit seinem alten Zylinder und einer
knallroten Husarenjacke angetane »King,« der jeden Träger
einer Expedition um ein paar Blätter Tabak
anbettelt..."
Ehe und soziale
Verhältnisse

[161]
Kameruner Familienidyll,
das sich meist im Freien abspielt.
|
Das interne soziale Leben baut sich, wie überall auf der Erde, auch bei den
Negern auf der Familie auf - deren Bestand wiederum vom
Verhältnis der beiden Geschlechter zueinander abhängig ist. Dieses
Verhältnis aber wird weniger von der Zugehörigkeit zu dem einen
oder anderen Volksstamm, sondern vom [165] religiösen
Bekenntnis bestimmt - allerdings mit Einschränkungen und
Unterschieden. Bei den Mohammedanern regelt der Koran mit seinen
Vorschriften über Familienrecht, Vielweiberei, Stellung der
Frau usw. das Eheleben, das Verhältnis der Eltern zu den Kindern
und umgekehrt; indessen zeigt sich bei den Mohammedanern des Sudans (und den
aus diesen Gebieten kommenden) eine viel größere Freiheit der Frau
als in der arabischen Welt.
Bei den heidnischen Sudan- und Bantunegern spielt sich das
Ehe- und Familienleben einfacher ab. Der Mann ist der Herrscher, die Frau hat
für ihn zu arbeiten, gilt als das tiefer stehende Wesen, das im übrigen
nur Kinder zu gebären hat.
"Die heidnische Auffassung von der
Frau ist eine niedrige; denn sie ist religiös bei den meisten Stämmen
ohne Wert, auch bei den Konde. Sie kann kein Opfer bringen. Wie manche
Araberstämme leugnen, daß die Frau eine Seele habe, so beurteilen
auch viele afrikanische Völker die Frau schlechthin als minderwertig. In
Ufipa am Tanganjikasee sagen die Männer halb im Scherz, halb im Ernst:
Die Frauen haben keinen Verstand, sie sind fast wie die Ziegen.
Das Verhältnis der Geschlechter zueinander bei den
»Negern« wird von vielen Europäern für ein durchaus
willkürliches und ungeregeltes und der Sinnlichkeit unterworfenes
gehalten. »Neger« und »Ehe«, das scheint unvereinbar
zu sein. Sie haben etwas von der Vielweiberei gehört, und mit dieser
Vielweiberei der »Neger« verbinden sich die unglaublichsten
Vorstellungen" (Weichert).
Da sei zunächst einmal erklärt, daß manche Afrikaforscher zu
der Überzeugung gelangt sind, daß die Monogamie als die
älteste Form der afrikanischen Ehe anzusehen ist,
die - abgesehen von dem Fall der
Kinderlosigkeit - erst durch Mehrung des Besitzes und der Macht in der
Hand einzelner zur Vielweiberei geworden ist. Professor Carl Meinhof,
einer der besten Kenner der afrikanischen Volkskunde, schreibt hierzu:
"Wo die Kinderlosigkeit der
ersten Frau den Mann veranlaßt, sich eine zweite Frau zu nehmen, wird das
nicht eigentlich als Polygamie aufgefaßt. Der Zweck der Ehe ist nach der
Vorstellung des Afrikaners die Erzeugung von Kindern. Die Ehe wird also nicht
als vollständig angesehen, wo Kinder fehlen. Es kommt noch die
religiöse Vorstellung hinzu, daß nur der Sohn die Gebete und Opfer
für die Ahnen darbringen kann. Es kann vorkommen, daß die Frau
selbst den Mann veranlaßt, dem Mangel abzuhelfen durch eine zweite
Frau...
Abgesehen von dieser Form der Vielehe, die in den Augen
des Afrikaners keine ist, steht die Polygamie in engstem Zusammenhang
mit dem Erwerbsleben, dem Hackbau und der Viehzucht. Sie ist eine
Besitzfrage und um deswillen eine Begleiterscheinung einer gehobenen
Kulturstufe. Die Vielweiberei hat also - da nur ein geringer
Überschuß von Frauen vorhanden
ist - zur Voraussetzung, daß einige bevorzugte Männer
mehrere Frauen bekommen und andere Männer keine. Das ist aber nur
möglich, wo das soziale und wirtschaftliche Übergewicht von
einzelnen sich geltend gemacht hat. Die Vielweiberei ist also nicht eine
ursprüngliche Einrichtung, sondern eine Sitte, die durch den Besitz
und die Häuptlingsschaft hervorgebracht wird... Das Volk im ganzen kann
sich schon aus wirtschaftlichen Gründen nicht daran beteiligen. Das alles
spricht gegen das Alter der Polygamie."
[166] Der Kampf gegen die
Polygamie ist vom sittlichen, religiösen und volkswirtschaftlichen
Standpunkt mit allen Mitteln zu führen. Durch die
Polygamie - so schreibt D. Ludwig Weichert in seinem Buch
Kehre wieder, Afrika - werden viele Männer einfach zur
Ehelosigkeit verdammt. Nur der vermögende Konde kann sich eine dritte
und vierte und fünfte Frau erwerben. Aber meistens sind nur die
älteren Männer reich genug dazu. Regelmäßig "kaufen"
sich dann die älteren Männer junge und ganz junge Mädchen.
Dem jungen Mann bleiben nur ältere und alte Frauen, vielfach Witwen
übrig, so daß der Mann auf den Stolz der Nachkommenschaft
verzichten muß. Daß diese Verhältnisse zum Ehebruch
führen, ist klar.
Ein anderer Kenner des afrikanischen Volkslebens, Heinrich Norden, hat
seine Erlebnisse und Erfahrungen als Arzt, Lehrer und Missionar in seinem Buch
Als Urwalddoktor in Kamerun niedergelegt und ergreifende Bilder der
durch diese falschen Verhältnisse gegebenen Not der Frauen und Kinder, ja
des gesamten Volkslebens, gegeben. Seinem Buche entnehmen wir einige von
ihm zusammengestellte besonders eindringliche Beispiele über die
ungleiche Verteilung beider Geschlechter durch die ungesunde und unsoziale
Vielweiberei. Norden hat in ganz verschiedenen Gegenden unserer Kolonie
Kamerun die reichsten Polygamisten und die Zahl ihrer Weiber feststellen lassen.
Seine Übersicht zeigt:
| Ort |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Bagom |
100 |
70 |
15 |
12 |
10 |
| Bamum |
500 |
170 |
80 |
75 |
75 |
| Bali |
150 |
60 |
40 |
30 |
27 |
| Banzum |
150 |
70 |
40 |
30 |
30 |
| Sakbayeme |
80 |
70 |
65 |
50 |
30 |
| Duala |
25 |
20 |
8 |
|
4 |
| Bakosi |
40 |
20 |
15 |
10 |
10 |
| Edea |
30 |
28 |
24 |
24 |
20 |
|
|
1075 |
508 |
287 |
231 |
206 |
Also haben die acht reichsten Männer in diesen acht verschiedenen
Gegenden zusammen 1075 Frauen. Die acht zweitreichsten Männer 508
und diese 40 Männer zusammen 2307 Weiber, und viele hundert
arme, aber junge gesunde Männer sind ohne Frauen.
Und nach einer anderen genauen Statistik haben 2547 Männer 8374 Frauen,
das sind durchschnittlich auf einen Mann drei Frauen.
"Eine Folge dieser unerträglich
ungesunden Zustände sind die Kinderverlobungen. Die jungen
Männer sind gezwungen, um sich rechtzeitig eine junge Frau zu sichern,
das Mädchen schon als Kind von den Eltern zu kaufen. Wieviel
Unglück daraus entsteht, ist oben schon angedeutet worden. Der
Ein- [167] druck davon wird noch
verstärkt, wenn man sich darauf besinnt, daß bei der endlichen
Eheschließung der dann vorhandene Altersunterschied wieder zu den eben
geschilderten Mißständen führen
muß."
Die deutsche Kolonialverwaltung hat in der Vielweiberei eine Ursache der
geringen Bevölkerungsziffer in Kamerun erkannt. Gouverneur Dr.
Seitz sagte 1909 in einem Vortrag: "Es steht fest, daß die
Bevölkerung bei Vielweiberei abnehme. Das Übel müsse von
innen heraus geheilt werden. Wenn es den christlichen Missionaren
gelänge, die Neger zu der idealen Auffassung der Einehe zu erziehen und
die moralische und soziale Stellung der Frau zu heben, so würden sie damit
dem Land und Volk einen Dienst leisten, der nicht hoch genug geschätzt
werden könne."
Heinrich Norden macht in seinem Buch aus seinen Beobachtungen im
gegenwärtigen Kamerun verschiedene Vorschläge, die geeignet
erscheinen, die Vielweiberei innerhalb
15 - 20 Jahren gänzlich auszurotten. Er fordert eine steigende
Besteuerung der Polygamisten. Damit träfe man zuerst die allerreichsten
"Frauenbesitzer", denn der Frauenbesitz ist ein Fluch des afrikanischen
Kapitalismus. Weiter schlägt er vor, den Besitz von Weibern vielleicht
ganz allgemein so zu besteuern, daß es unmöglich würde, eine
vierte oder fünfte oder weitere Frau zu kaufen.
Die durch die Vielehe verursachte Kinderarmut findet ihren Ausdruck in
folgenden Tabellen (nach Norden). Sie zeigen, daß die Vielehen nicht allein
weniger Geburten aufzuzeigen haben, sondern daß auch die
Kindersterblichkeit viel höher ist als bei den Einehen, besonders bei den
christlichen.
Tabelle 1: Vielehen mit mehr als 30 Frauen in 3 Kameruner
Gebieten.
Ergebnis: 2351 Frauen, 561 lebende
Kinder, 866 tote Kinder. Also 0,23 lebende Kinder pro Weib, Kindersterblichkeit
60%.
Tabelle 2: Vielehen aus 11 Kameruner Bezirken mit mehr als
11 Frauen.
Ergebnis: 3014 Frauen, 2297
lebende Kinder, 2707 tote Kinder. Also 0,76 lebende Kinder pro Weib,
Kindersterblichkeit 53%.
Tabelle 3: Vielehen aus 9 Kameruner Bezirken mit weniger als
11 Frauen.
Ergebnis: 2510 Frauen, 3201
lebende Kinder, 3349 tote Kinder. Also 1,27 lebende Kinder pro Weib,
Kindersterblichkeit 51%.
Tabelle 4: Heidnische Einehen aus 8 Kameruner Bezirken.
Ergebnis: 310 Frauen, 518 lebende
Kinder, 443 tote Kinder. Also 1,67 lebende Kinder pro Weib, Kindersterblichkeit
45%.
Tabelle 5: Christliche Einehen aus 7 Kameruner Bezirken.
Ergebnis: 361 Frauen, 794 lebende
Kinder, 551 tote Kinder. Also 2,19 lebende Kinder pro Weib, Kindersterblichkeit
nur 40%.
Die Mission ist sicher auf diesem Gebiet der bedeutendste
Kolonisationsfaktor.
Über dies dunkle Kapitel im Leben der Eingeborenen kann hier nicht mehr
gesagt werden. Es wird nach Weicherts Urteil jahrhundertelanger
Erziehung bedürfen, bis der Afrikaner ein streng sittliches Leben
führen wird. Aus seiner Willensschwäche und einer stark
entwickelten Sinnlichkeit erklären sich auch die [168] Zuchtlosigkeit und
Maßlosigkeit des geschlechtlichen Lebens, um so mehr, als es an einer
sexuellen Jugenderziehung völlig fehlt.
Die geschlechtliche Freiheit wird nur dem Mann zugebilligt. Von der Frau wird in
der Ehe vollkommene Treue verlangt. Ehebruch wurde bei den Kondenegern mit
dem Tode bestraft. Es sind nicht viel
Dinge - so urteilt D. L. Weichert - die mit der
Herrschaft des weißen Mannes den Konde so verbittert hatten, als gerade
dies, daß er bei Ehebruch auf sein natürliches Recht verzichten soll.
Und er verzichtet auch nicht so ohne weiteres auf sein Recht. Es ist seltener
geworden, aber es geschieht noch immer wieder, daß der Ehebrecher von
dem Betrogenen getötet wird. Der beteiligten Frau wurden zum mindesten
die Ohren abgeschnitten.
Das Erbrecht ist im monogamen Sinn geregelt - also nur die Kinder der
Hauptfrau kommen als Erben in Frage. Die Verwandtschaft schließt sich zu
einer Sippe zusammen; das älteste männliche Mitglied ist
ihr anerkanntes Oberhaupt mit weitgehenden
Rechtsbefugnissen - also auch hier wieder Anklänge an alte
europäische Verhältnisse. Kindererziehung fehlt
völlig - wenn die Kleinen, die lange,
2 - 3 Jahre, von der Mutter gestillt werden, einigermaßen
imstande sind, zu arbeiten, werden sie auf Farmen, zum Lastenschleppen und
anderen Diensten verwendet.
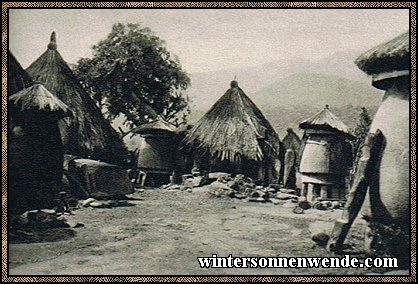
[287]
Dorfstraße in Djale, Kamerun.
|
In den Behausungen und Siedlungen der Stämme
prägt sich die Verschiedenheit der Rassen ebenfalls aus: Viereck und
Rundung stellen die Gegensätze dar, das erste in Form eines rechteckigen
Lehmhauses bei den Bantu, das zweite als Kegeldachhaus bei den
Sudannegern - zwischen beiden finden sich Übergangsformen.
Baumstämme und Lehm bilden das Material der Wände, deren
vordere von einer Haustür durchbrochen ist. Die Firsthöhe
beträgt 4 - 5 m, die Länge des Rechtecks
6 - 8 m, die Breite 3 - 4 m. Die
Dächer werden aus demselben Gitterwerk hergestellt wie die
Hauswände, die Türen sind hübsche, aus Palmblattrippen
gefertigte dichte Schiebematten. Im Innern erheben sich ganz behagliche
Lehmsitze, die Wände schmücken ornamentale Malereien in
Schwarz, Weiß, Rot. Alle Einrichtungsgegenstände, besonders die
Hausgeräte, sind sehr sorgfältig gearbeitet und zeigen
künstlerische Gestaltungskraft.
Einiges über Negerkunst sei hier eingefügt. Leo
Frobenius schreibt in seinem Werk Sterbendes Afrika:
"Nie sah ich in Innerafrika eine
eingeborene Stillosigkeit. Der Bauer trägt nie das Kleid des Städters,
der Farmer imitiert nie die Wohnstätte des Handwerkers. Und wo von
außen her ein neuer Gedanke in Tracht oder Bauweise eindringt, da findet er
sogleich eine neue, dem neuen Raume entsprechende Form. Das geht soweit,
daß, wenn mehrere Völker verschiedener Kulturzugehörigkeit
durcheinander wohnen, ein jedes seine eigene Art beibehält und sich nicht
etwa der anderen anpaßt. Im Gebiete des alten Kororofa haben die
feldbauenden Jukum, die handwerktreibenden Haussa, die viehzüchtenden
Fulbe und die der Fischerei nachgehenden Wurbo eigene Architektur, eigene
Tracht, eigenen Schmuck. Wenige Kilometer landeinwärts wohnen die
gartenbauenden Muntschi; sie haben mit den Vorerwähnten die gleichen
Märkte; es wird ihnen aber nie einfallen, aus ihrem Lebensstil
herauszutreten und die Tracht der anderen nachzuahmen.
[169]
Stets ist die Tracht ein Schmuck. - Und wie in der
Tracht und in der Wohnung, so ergießt sich auf allen Gebieten das wirkende
Leben bildend und schmückend über das zweckdienlich Geformte
und arbeitsgemäß Verwendete. Eine liebenswürdige
Launenhaftigkeit, die ganz der in der natürlichen Umwelt uns als solche
erscheinenden entspricht, läßt steigende und fallende Freude oder
Lust in besonderer Beachtung gewahren. Hier ist ein Völkchen, das wird
plötzlich dazu angeregt, seinen Töpfen eine betonende Sorgfalt zu
widmen. Da werden dann die alten Schnörkel aus Großvaters Zeiten,
die lange vernachlässigt wurden, wieder lebendig. Sie werden aber nicht
etwa stumpfsinnig kopiert und unverständig zusammengepackt. Solche
Sünden kennt nur der zweckbewußte Europäer. Dort
drüben geht das anders vor sich. Sowie sich ein solches Lüstchen an
reicherem Schmuck einstellt, fließt aus dem von praktischer Handhabung
geleiteten Werke die Formsprache ganz natürlich und ungezwungen heraus.
Die neue Gestaltung wächst, genau wie eine Pflanze wächst.
Über Nacht hat sich ein neues Blütchen am Stamm der Stilarten
entfaltet. An dem erfreuen sich nun seine Betrachter und hätscheln und
liebkosen es eine Zeitlang und tun sich darin wohl, bis das Interesse sich eines
Tages von ihm abwendet und nun vielleicht einer neuen Art von
Mattenflechtkunst oder von Löffelformen oder was es auch immer ist
zusteuert. - Bei diesem Volke finde ich besonderen Schmuck in
Gesichtsschnitten. Bei jenem dort eigenartige Haarpfeile. Bei jenem
merkwürdige Plüschlendenstoffe. Bei jenem einen großen
Reichtum an Trommelformen. Bei jenem allerfröhlichste Gestalten von
Schemeln. Das steigert sich hier zu imposanten Holzschnitzereien, die ganze
Häuser überziehen, und schrumpft dann wieder zusammen zu
kleinen Schnörkelchen am Hüftband. Aber das Wesen ist immer das
gleiche, ob im tropisch üppigen und hypertrophischen oder im senil,
kraftlos abtastenden Sinne. Niemals hört die Pflanze Kultur auf, sich zu
verwandeln. Immer ist Arbeit gleich Leben und Schmuck gleich
Sein. - Wenn man von den Ausdrucksformen der Kultur sehr wohl sagen
kann, daß man über schön und häßlich streiten
kann - denn das ist eine Angelegenheit des nach Person und Zeit stets
schwankenden Geschmacks - so wird doch niemand an ihnen eine
Stillosigkeit nachweisen können. Das ist das Großartige und
Bedeutende. Und der Grund hierfür liegt eben in der Tatsache, daß
das alles aus freier Auswirkung des tätigen Lebens heraus erwächst
und nicht verstandesgemäß betrieben wird. Darin liegt die
natürliche Begrenzung."
Ebenso verschieden wie die Hausformen sind die Dorfformen
der Bantu- und Sudanneger: das Straßendorf der ersten, das
Haufendorf der zweiten; allerdings bringt es der Bantu kaum zu einer
größeren Ansiedlung, da gewöhnlich nur eine der
erwähnten Sippen zusammen lebt. Es mag der Vollständigkeit halber
erwähnt sein, daß der Reinlichkeitssinn der Neger entschieden
ausgeprägt ist, wie auch das Tier seinen Wohnbezirk aus natürlichem
Selbsterhaltungstrieb heraus sauber zu halten pflegt. An verschiedenen Stellen
beim Dorf führen Schneisen in den Wald, an deren Ende
Gabelbänke, wie Dr. Mansfeld von den
Croßfluß- (Bantu-) Negern berichtet, sogar richtige Sitzbänke
mit tiefen Gruben darunter aufgestellt sind, eine Anlage, die allen alten Soldaten
wohlbekannt sein dürfte.
In Adamaua, wie auch in anderen Gegenden, z. B. in Ngaundere haben die
größeren Niederlassungen oft bedeutende Befestigungsanlagen,
Palisaden, auch Lehmmauern mit Türmen und Gräben.
Passarge schildert eine solche Befestigung in Ngaundere wie folgt:
"Im Innern läuft der Mauer
entlang ein breiter Weg und eine Stufe, auf die sich die Verteidiger stellen, um
durch Scharten zu schießen. In dem von Mauern umschlossenen [170] Stadtraum steht Hof an
Hof, getrennt durch Lehmmauern oder Mattenzäune oder schmale
Gänge. Außer wenigen Hauptstraßen sind die Wege eng. Die
Mauern sind fahl, grau oder bemalt, reiterhoch; Dracänen und die
Dächer der Häuser unterbrechen angenehm die einförmigen
Linien..."
Das war im Jahre 1894; heute ist der Platz zerfallen, eine Lehmruinenstadt mit
wenigen Einwohnern...
Die Lebensweise der Neger richtet sich nach der Jahreszeit und dem Stand der
Farmarbeiten: die trockene Hälfte gehört dem Ackerbau und wurde
außerdem früher für die Stammesfehden benutzt; die
Regenperiode wird zu Hause bei der Beschäftigung mit den verschiedenen
Hausindustrien verbracht.
Die Speisekarte der Bantu- und Sudanneger ist bei der Fülle der
Nahrungsmittel eine sehr reichhaltige, obgleich die Hauptplatten in Mais und
Hirse bestehen.
Die Speisen werden meist in stark gepfefferter Palmölbrühe gekocht,
Mais und Hirse in Knödelform geknetet, mit der Hand in die heiße
Brühe getaucht und daraus verspeist. Das sehr begehrte Salz, zum Teil da
und dort im Lande gewonnen, ist ein wichtiger Handelsartikel. Fleisch wird
gebraten oder gekocht. Ziemlich gleichgültig ist der Zustand und der
Frischgrad des Fleisches. Kleinwild, wie Vögel, Ratten, Mäuse,
Schlangen, Eidechsen und Schnecken werden ebenfalls verzehrt; ganz besondere
Delikatessen bilden Raupen, Puppen und Engerlinge, Termiten und Ameisen.
Diese allerdings werden mit Palmöl, Pfeffer usw. lecker zubereitet und mit
großem Appetit verspeist. Bei dem Sudanneger treten als weitere
Delikatesse hinzu die Heuschrecke und die
Kola- oder Guronuß.
Auch der Palmwein, von der Weinpalme, eigentlich Getränk, muß bei
einigen Sudanstämmen schon mehr zu den Genußmitteln
gezählt werden, so leidenschaftlich gern und in solchen Quantitäten
wird er vertilgt. Er wird stets in frischem Zustande, also ungegoren getrunken und

[162]
Eingeborener in Kamerun führt sein Pinselohrschwein an der
Leine.
|
meist gewärmt. Beinahe ebenso beliebt ist im Sudan eine Art Bier, aus
Mais und Hirse unter Zusatz von Honig gewonnen und stets kalt genossen. Es ist
eine "braune, trübe, angenehm säuerliche Flüssigkeit, durch
wiederholtes Kochen der Körner, Abseihen und Gärenlassen
zubereitet" (Hutter).
Geraucht wird überall heftig - von Frauen und Männern und
Kindern.
Den heidnischen Negern sind Lesen und Schreiben unbekannte Dinge; der
Herrscher der Bamum erfand eine eigene, den ägyptischen
Hieroglyphen verwandte Bilderschrift - ein weiterer Beweis für die
Bildsamkeit der "Wilden".
Wie in dieser Beziehung, so trennt auch das religiöse Moment
Mohammedaner und Heiden: allerdings hält sich der mohammedanische
Neger nicht wie die Fulbe und Araber an die Lehren des Korans, sondern
schließt sich den Gebräuchen seiner heidnischen Volksgenossen an.
Zum Islam bekennen sich eine ganze [171] Anzahl der im Norden
des Kamerungebietes lebenden Stämme, wie die Kanuri, die Makari, die
Musgu, sowie die in den Familien der Fulbe lebenden Sklaven und Hörigen
aus den Sudannegerstämmen. Auch in der Bekleidung spricht sich der
Unterschied der Religionen aus; die Heiden beiderlei Geschlechts behelfen sich
mit der primitivsten Verhüllung - "man ist nur schwarz und damit
gut", wie Wilhelm Busch
sehr richtig sagt - und reiben sich den
Körper mit Rotholz ein, während der Glaube an Allah und seinen
Propheten Bekleidung des Leibes und Bedeckung des Hauptes verlangt. Die
malerische und bunte Tracht der arabischen Völker ist jedem bekannt, der
die Südküste des Mittelländischen Meeres berührt hat:
ein "Tobe" oder Burnus aus rotem, blauem oder weißem Stoff, weite
gestreifte Hosen, ein farbiger Turban und gelbe oder rote Schuhe oder Reitstiefel.
Alle möglichen Putz- und Verschönerungsmittel, verschiedenartiger
Schmuck, Ringe, Frisuren, groteske Verzerrungen der Lippen, wie bei den
Musgufrauen, betonen das den Negern wie den anderen Menschen auch
angeborene Schmuckbedürfnis - es ist leicht, über diese
primitiven Äußerungen einer uns fremden Ästhetik zu
lächeln, aber man darf nicht vergessen, daß das
Schmuckbedürfnis bei allen Völkern und Rassen der Erde in mehr
oder minder ausgeprägter Form vorhanden und durchaus nicht auf die
primitivsten unter ihnen beschränkt ist.
Der Neger ist ein großer Freund von Festen, die bei jeder sich
bietenden Gelegenheit gefeiert werden. Familien- und Kultfeierlichkeiten spielen
eine große Rolle. Die zweitgenannten sind gewöhnlich mit der Natur
verbunden, Saat- oder Erntefeste, oder sie richten sich nach dem Monde, der wie
bei allen Naturvölkern seine magische Wirkung auch bei den Negern nicht
verfehlt: "bei Mondfinsternissen herrscht große Aufregung, und gleich den
Kelten und Germanen kommen sie dem Mond mit Lärm und Geschrei und
Schießen zu Hilfe" (Hutter). Leider sind die schönen Waffenfeste der
Sudanneger, de viel prächtiger waren als die "Dorftanzereien" der Bantu, in
ihrer ursprünglichen Form europäischer Gleichmacherei im
großen ganzen zum Opfer gefallen und werden wohl nur noch gegen
Honorar für den Film vor der alles verzehrenden und verschlechternden
Kamera aufgeführt. In feierlicher Form wurde und wird wohl noch die
Blutsbrüderschaft, auch mit Weißen, abgeschlossen; sie
vertritt vom sozialen und religiösen Standpunkt aus unsere Eidesleistung
und verpflichtet zur Bundes- und Waffentreue bis zum Tode.
Der heidnische Glaube der Neger dreht sich naturgemäß, wie alle
primitiven Gedanken, um "das Unbekannte", um den Tod; die
Leichenfeierlichkeiten werden infolgedessen mit großem Zeremoniell
begangen, das noch bei Lebzeiten des Hinübergehenden beginnt, wie wohl
bei manchen Stämmen unserer ländlichen Bevölkerung auch.
"In dem Augenblicke, in dem die Seele den Leib verläßt,
verstärken sich Lärm, Geschrei und Klagen zu einem
ohrenzerreißenden Getöse. Die Totenklagen werden auch noch
fortgesetzt, wenn der Kranke verschieden ist." Merkwürdiger Aberglauben
spielt eine große Rolle: man stirbt nur, wenn man verzaubert oder vergiftet
wird - wir werden noch einige "praktische
Anwendun- [172] gen" derartiger
Überzeugung kennenlernen. Die Sudanneger sind in dieser Beziehung
aufgeklärter; alle Stämme, Sudan und Bantu, besitzen übrigens
gewisse ärztliche Kenntnisse und eine Anzahl ganz wirksamer Hausmittel
gegen die häufig vorkommenden Fiebererkrankungen,
Unterleibs- und Geschlechtsleiden. Auf die Leichenbestattung, die auf sehr
verschiedene Weise, aber immer in der Erde erfolgt, wird viel Wert gelegt und
oft große Pietät verwandt - die Furcht vor den Toten, die wir
nicht nur bei den Naturvölkern, sondern auch in anderen Erdteilen
antreffen, spielt hierbei eine wichtige Rolle. Häufig werden Speisen mit ins
Grab gegeben - auch dies ist eine weitverbreitete Sitte, der auch die
klassischen Ägypter ergeben waren; bei ihnen waren auch Menschenopfer
beliebt - Sklaven und Sklavinnen wurden dem Toten zur Begleitung mit ins
Felsengrab eingemauert: bei einigen westlich des Mbam lebenden Stämmen
war dies ebenfalls Brauch.
Fast alle Bantustämme und eine ganze Reihe der Sudanvölker waren
und sind wohl gelegentlich noch
Menschenfresser - schon vor dem Weltkrieg war indessen die Sitte des
"Kannibalismus" im Rückgang begriffen. Die Duala haben noch
zur Zeit der Besitzergreifung Kameruns durch die Deutschen, 1884, ihm ganz
ungescheut gehuldigt... Die Maka, ein Bantustamm, mästen geradezu
Menschen für diese Mahlzeiten; der gleiche Stamm verkauft sogar zu
diesem Zweck die Eltern, wenn sie alt und arbeitsunfähig geworden sind.
Ngita, der Häuptling der Wuti, von dem auch Morgen berichtet,
ließ, wie Dominik schreibt, bisweilen über den
Mißerfolg eines Sklavenzuges ergrimmt, Hunderten von
Haussahändlern die Köpfe abschlagen und seinen Leuten das Fleisch
der Ermordeten zum Festmahl vorsetzen.
Aus dem Aberglauben-, Sagen-, Märchen- und Naturwirrwarr, der die
religiösen Vorstellungen der heidnischen Neger bildet, können wir
erkennen, daß ein höheres, übernatürliches Wesen
für sie existiert, ein Geist, der bald der "Gute", bald der "Böse", bald
der "Verstorbene" ist - der Glaube an ein Leben nach dem Tode war und ist
wohl allen heidnischen Völkern gemeinsam, daher auch der eifrig
betriebene Ahnenkult.
Dieses übernatürliche Etwas kann durch Zeremonien, Anbetung von
Fetischen (die oben beschriebenen "Kunstwerke"), Opfer und der gleichen
versöhnt oder bedankt werden.
"Für den guten und den
bösen Geist aber hat der Mensch als Modell gedient: Gott oder guter Geist
ist der verbesserte, Teufel oder böser Geist der verschlechterte Mensch,
d. h. der Mensch mit übermenschlich gedachten positiven bzw.
negativen Kräften und Leidenschaften.
Daß bei den Naturvölkern Kameruns
überwiegend das böse Prinzip in der Vorstellung herrscht und der
Kult, soweit von einem solchen die Rede sein kann, sich mit Abwendung seiner
schädigenden Einwirkungen beschäftigt, ist psychologisch aus ihrem
kindlichen Begriffsvermögen erklärlich, ja selbstverständlich.
Seien wir ehrlich: unsere Bitten haben, streng genommen, alle den
unausgesprochenen Nachsatz: und verschone uns vor dem
Übel."
[173]
Die Erforschung und
Erschließung
Als Deutschland im Jahre 1884 vom Kameruner Gebiet Besitz ergriff,
gehörte dieses Land zu den unbekannten Gegenden Afrikas: außer
einem schmalen Küstenstreifen war es so gut wie nicht erforscht, in das
Innere war noch kein Europäer gekommen, und die Karte zeigte
hauptsächlich weiße Stellen.
"Der fatale »weiße
Fleck« reichte an der Küste landeinwärts im Norden bis
Benuë, genauer bis zu einer mit ihm gleichlaufenden Linie
Donga - Kontsha - Ngaundere; im Osten lagerte er sich breit
bis zum Wasserlauf des Ssanga, im Süden breitete er sich ein gut
Stück über die kartographische Abgrenzungslinie aus. Nicht einmal
die Westgrenze der Kolonie, der Küstenstreifen, war im Zusammenhang
und genügender Zuverlässigkeit der Angaben bekannt"
(Hutter).
Die Berliner Kolonialkonferenz von 1884 hatte die Schiffahrt auf dem Niger und
dem Kongo mit allen Nebenflüssen für alle Nationen freigegeben;
der Afrikaforscher Flegel, der schon auf zwei Reisen
1880 - 1882 nach Adamaua vorgedrungen war, die Quellen des
Benuë und andere Flüsse entdeckt hatte, erkannte sogleich die
Wichtigkeit dieser Bestimmung für die noch ganz unbestimmten
Kamerungrenzen im Inneren; er trat außerdem mit Eifer für die
Gewinnung Adamauas als Hinterland der jungen Kolonie ein. Der deutsche
Kolonialverein nahm sich der Pläne des Forschers mit Eifer
an - aber das Tempo war damals in Deutschland noch ein allzu behagliches,
so daß einige Zeit verging, bis Flegel seine dritte Reise nach "Kamerun und
Umgegend" antreten konnte. Er hatte die Aufgabe, "unter Begründung von
Stationen den Niger und den Benuë aufwärts zu gehen, sowie
Verträge in Adamaua abzuschließen, um dann südwärts
bis zur Küste durchzudringen."
Aber das englische Tempo war dem deutschen überlegen gewesen: am 5.
Juni 1885 traf in Berlin die Mitteilung ein, daß die Küstengebiete von
Lagos, die Gebiete auf beiden Niger- und Benuëufern unter englische
Schutzherrschaft gestellt seien. Erst am 5. Oktober legte Flegel eine Station am
Benuë an, wurde dann aber am weiteren Vordringen von den
Engländern gehindert, "die behaupteten, durch 200 Verträge das
ganze Ufergebiet des Niger und Benuë bis Yola erworben zu haben".
Die Aufgaben, die Flegel gestellt worden waren, konnten nicht gelöst
werden - die Expedition endete tragisch mit dem Tode des Forschers, der
zu Akassa an der Nigermündung starb.
1886 begann mit den Reisen Dr. Eugen Zintgraffs
(† 1897 an der Malaria zu Teneriffa) die Erforschung Kameruns
durch das Reich: Zintgraff war
1886 - 1892, Hutter von
1891 - 1893 im Norden des Gebietes tätig. Es sollte mit
Anlage von Stationen gegen Norden vorgedrungen und das Hinterland für
die Dauer erschlossen werden. Am 28. Mai 1889 war mit Zintgraffs Einzug in
Donga die Aufgabe gelöst: er hatte als erster Europäer Adamaua vom
[174] Golf von Guinea aus
erreicht. Der Anschluß an Flegels Reisen war gewonnen und das deutsche
Gebiet bis zu der Station Baliburg, d. i. etwa bis zum 6. Grad
nördl. Breite, ausgedehnt.
Die Unternehmung hatte bald (1891) eine schwere Gefährdung zu
überstehen: eine Expedition gegen zwei große feindliche
Stämme, die Bafut und die Bandeng, wurde infolge Abfall und
Verräterei einiger für treu gehaltener Dörfer zu einer
verlustreichen Niederlage; 4 Europäer, 170 Mann der Expedition und
mehrere hundert Bali - in deren Gebiet die letzte Station
lag - fielen, so daß das Hochland zunächst geräumt
werden mußte. Aber bereits nach vier Monaten befand sich Zintgraff wieder
im Besitz der verlorenen Gebiete, und nun festigten sich das deutsche Ansehen
und der deutsche Einfluß mit großer Schnelligkeit, so daß alles
auf das beste zu gedeihen schien.
Aber die Wege der deutschen Kolonialverwaltung von damals waren
unerforschlich...
Am 1. Januar 1893 kam der unerwartete Neujahrsbefehl, die
"Nordexpedition sei aufgelöst und der Rückzug an die Küste
anzutreten"... Man kann sich die Empfindung Zintgraffs und seiner Leute ohne
große Mühe vorstellen!
Es war alles umsonst gewesen, alle Opfer, alle Kosten, aller seelische und
körperliche Mut waren am grünen Tisch von Berlin zunichte
geworden: im Sommer 1893 hatte die Nordexpedition aufgehört zu
existieren, das ganze Land war wieder verloren und verschlossen. Der Eindruck,
den das Verfahren der Regierung auf die Eingeborenen machen mußte,
untergrub erneut das Ansehen Deutschlands.
"Die kolonialpolitische Strömung war in Totwasser geraten", sagt Hutter
sehr treffend.
Im Süden der Kolonie war von 1888 - 1889 eine andere
Regierungsexpedition unter Hauptmann Kund und Leutnant
Tappenbeck tätig: sie drangen den Sanaga aufwärts bis zu
den Nachtigalstromschnellen vor und legten die Station Yaunde an. Aber
Tappenbeck starb; Kund war schwer verwundet und litt außerdem heftig
unter den Unbilden des Klimas.
Als Nachfolger Tappenbecks wurde der Leutnant Curt Morgen
ausersehen, der sich eigentlich für die Wissmanntruppe in Ostafrika
gemeldet hatte und am orientalischen Seminar einen Kursus in Negersprachen
absolvierte, als er vom Auswärtigen Amt die Kommandierung nach dem
Kamerungebiet erhielt. 1889 übernahm er an Stelle Kunds selbst das
Expeditionskommando und durchquerte bis zum Jahre 1891 die Kolonie von
Süden nach Norden; teils folgte er den Wegen seiner Vorgänger, teils
aber erforschte er noch ganz unbekannte Gebiete, entdeckte z. B. den
Mbam, hatte schwere Kämpfe mit den Eingeborenen zu bestehen und
erreichte endlich Ibi am Benuë. Die ungewöhnliche Tatkraft des
jungen Offiziers unterwarf große Strecken des bis dahin nur dem Namen
nach [175] deutschen Landes
vollkommen, so daß Curt Morgen zu den bedeutendsten Pionieren
Kameruns zu zählen ist; seine spätere Laufbahn zeigt seine
Bedeutung auch im politisch-militärischen Sinn. Nach seiner Heimkehr
wurde er bald Flügeladjutant Kaiser Wilhelms II. und
Militärattaché in Konstantinopel: während jener Zeit einer
der wichtigsten Auslandsposten. Er erkannte die Gefahr, die uns von
Rußland drohte, klar und machte sich mit seiner politischen
Betätigung bei manchen Leuten der kaiserlichen Umgebung höchst
unbeliebt, so daß auch Wilhelm II., der ihm sehr zugetan war, ihn
nicht zu halten vermochte. Er wurde abberufen, bekam das Münsterer
Infanterieregiment und ging als General in den Weltkrieg. Er
führte eine Armee in Frankreich und auf dem Balkan zu den
berühmten glänzenden Siegen, die seinen Namen den bekanntesten
der Kriegsführer hinzugefügt haben. Derselbe Schneid, der ihn mit
rücksichtsloser Energie durch Kameruns Steppen und Wälder trieb,
beseelte ihn auch im europäischen Kriege. Er ist im Jahre 1928 einer
Grippe erlegen, nachdem er seine ganze Kraft der Organisation der
vaterländischen Verbände gewidmet hatte. In seinem Werk Durch
Kamerun von Süd nach Nord hat er seine Erlebnisse auf das
anschaulichste geschildert.
Als Nachfolger Morgens im Kommando der in Kamerun verbliebenen
Streitkräfte sind Hauptmann v. Gravenreuth, der aber schon
1891 am Kamerunberge im Kampf gegen die Bakwiri fiel, und Rittmeister
v. Stetten zu nennen. Nun kümmerte sich das Reich wieder
einmal geraume Zeit nicht mehr um die Kolonie - die
Forschungsexpeditionen hatten ein Ende. Die vom Reichstag zur
Verfügung gestellten Mittel waren so gering, daß der Verwaltung des
Schutzgebietes in der Erschließung des Landes die Hände gebunden
waren. Ein tragisches Ende fand infolge des Unverstandes der leitenden
Heimatstellen der Stationschef der Balingastation, nahe am
Zusammenfluß des Mbam und des Sanaga, Leutnant
v. Volckamer; man ließ ihn monatelang ohne jede
Unterstützung von der Küste aus: "Im Kampf der Balinga gegen die
Barrongo hat er wohl einen martervollen Tod gefunden; Bestimmtes
darüber hat man nie in Erfahrung gebracht." Welch ein grausiges
Geheimnis liegt in der kurzen Mitteilung...
Energischer als die deutsche Regierung betrieben die
Franzosen - es war allerdings nicht allzu
schwer - die Ausdehnung ihrer Herrschaft im Hinterlande ihrer Kolonie des
französischen Kongo, zu dem ihnen die Wasserstraße des
mächtigen Flusses einen bequemen Zugang bot. Dieser Tätigkeit
stand auf deutscher Seite nur der Unternehmungsgeist von Privatleuten
gegenüber: Konsul Ernst Vohsen rief das Kamerunkomitee
zusammen, das die Mittel zu einer Adamauaexpedition sicherstellte. Es gelang
den Forschern v. Uechtritz und Dr. Passarge, einer
französischen Expedition unter dem berühmten Reisenden
Mizon zuvorzukommen und bindende Verträge mit den
mächtigen Sultanen abzuschließen, so daß Land für
Deutschland gerettet wurde, das sonst auch an die Franzosen gefallen wäre.
1893/94 wurden die Grenzen der Kolonie durch genaue Verträge mit
Frankreich und England festgesetzt.
[176] Die nächsten
Jahre bis 1910 brachten ebenfalls nur private Forscherarbeit; das Reich
hüllte sich in Schweigen... Botaniker, wie Dr. Preuß, Geologen, wie
Dr. Esch, trugen zur Erforschung des Landes bei, ebenso wie Leutnant
v. Carnap, der in der Südostecke den Dschafluß
entdeckte. Dann aber, im neuen Jahrhundert, wachte man in Deutschland ein
wenig auf, vielleicht nicht ganz von selber; aber die Gefahr, die vom Mahdi und
seinen glaubensfanatisierten Armeen drohte, konnte nicht übersehen
werden. Eine Schutztruppe war geschaffen worden, die im Anschluß an die
Kämpfe der Franzosen mit dem Mahdi und der Engländer mit dem
Sultan von Yola eine ganze Reihe von kriegerischen Ereignissen in Mandara,
Marua, Ngaundere und Buhendjidda unter Hauptmann Dominik zu
bestehen hatte. Die Schutztruppe zog bis zum Tschadsee, um dort den
Engländern und den Franzosen die deutsche Flagge zu zeigen. In Adamaua
wurden Residenzen und Stationen angelegt, ebenso setzte man sich im Baliland
von neuem fest. Die Befriedung der Kolonie kostete noch viel Blut, und
militärischen wie wissenschaftlichen Führern ist gleichzeitig ein
großer Teil der Erforschung des Landes zu danken. Die zahlreichen
Unruhen der Eingeborenen wurden in den Jahren
1900 - 1904 von der Schutztruppe niedergeschlagen. Bis zum
Ausbruch des Krieges war das ganze Gebiet der 1911 erweiterten Kolonie
vollkommen erforscht und unterworfen. Zwei Bahnstrecken, die
Nord- und die Mittellandbahn, wurden teilstreckenweise eröffnet und
schufen ganz neue Möglichkeiten der Ausbeutung; auch die
Flußschiffahrt hatte sich bedeutend entwickelt. Während der Monate
Juli bis Oktober können Dampfer bis 800 Tonnen den Benuë hinauf
bis Garua, dem Hauptplatz Adamauas, kommen, doppelt so lange bis zum
englischen Yola in Nigeria; auch die mittleren und südlicheren
Flüsse, der Mungo und Wuri, der Sanaga und Njong bieten die
Möglichkeit für den Warentransport zu Wasser. Schon 1908/09
passierten fast 1400 große Handelskanus die Station Akonolinga und
beförderten 26 515 Lasten.
Kamerun ist, wie Hutter es ausdrückt, "unsere am wenigsten fixierte
Kolonie" gewesen. Das kann auch gar nicht anders sein. Bei der Erwerbung dieses
Landes, das etwa so groß ist wie das Deutsche Reich von 1914, reichte das
unbekannte Afrika gerade hier bis dicht an die Küste, dann kamen sieben
Jahre Stillstand, und der dritte wohl am schwersten wiegende Grund: fast an
keiner Stelle zeigte Afrika, die schwarze Schöne, ein so ernstes, finsteres
Antlitz, drohend abschreckend! Fast an keiner Stelle Afrikas stellten sich dem
Eindringling bereits auf der Schwelle Hemmnisse entgegen wie gerade in
Kamerun.
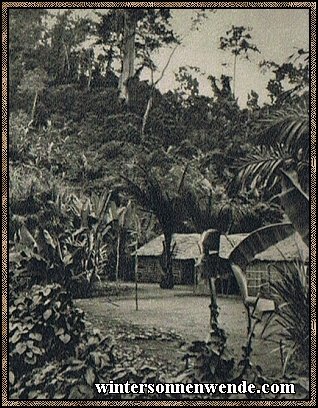
[414]
Eine Arbeiterwohnung in einer Ölplantage in Kamerun.
|
"Man ist sich in Kamerun lange
darüber im unklaren gewesen", sagt Paul Rohrbach, "welche
Wege für die Entwicklung der Kolonie eingeschlagen werden sollten.
Für den Anfang war es günstig, daß die guten Böden am
Kamerunberg, dicht an der Küste, zur Anlegung von
Pflanzungskulturen bequem lagen. Zunächst versprach
Kakao das meiste. Wilde Ölpalmenbestände
waren reichlich vorhanden. Den größten wirtschaftlichen Ertrag gab
jahrelang der im Südkameruner Urwald gewonnene
Wildkautschuk. Sollte aber aus
der Kolonie [177] mehr werden als ein
Sammelgebiet für dies Produkt, allenfalls noch mit Hinzunahme von
Palmkernen und Palmöl und den Plantagenprodukten
am Kamerunberg, so mußte man mit Bahnbauten ins Innere
gehen."
Mit solchen Bahnbauten wurde infolge des mangelnden
Verständnisses der Heimat viel zu spät begonnen. Nur eine
schnelle Erschließung der Innengebiete versprach hohe
kolonialwirtschaftliche Ausbeuten. Straßen für den
Kraftwagenverkehr gab es nur wenige. Die waren aber zu leicht gebaut, um
schwere Lastautos zu tragen. So blieben neben der Schiffahrt auf dem Njong,
Mungo und Wuri die Trägertransporte, die jedoch der geregelten
Feldarbeit im Wege standen und obendrein seit 1910 zur Verschleppung der
Schlafkrankheit beitrugen, als einzige Beförderungsmöglichkeiten
dem Handel zur Verfügung und ließen zuletzt immer geringere
Überschüsse zu.
Es würde zu weit führen, hier darzulegen, wie im einzelnen die
Erschließung und Entwicklung in den letzten beiden Jahrzehnten vor
Ausbruch des Weltkrieges vor sich ging. - Viel Blut ist geflossen, denn die
Zerrissenheit des Geländes und der Eigenwille einer tapferen
Bevölkerung, die sich ohne militärische Machtmittel nicht
zähmen ließ, erforderten zahlreiche Einzelkampfhandlungen. In
zähem Ringen hat unsere tapfere Schutztruppe Schritt für Schritt das
Land befriedet und anschließend getreulich mitgearbeitet, das Land auch
wirtschaftlich zu erschließen. - Die Fortschritte in der Entwicklung
Kameruns während des letzten Jahrzehnts vor dem Weltkrieg waren so
vielversprechend, daß wir getrost in die Zukunft schauen konnten in
gläubiger Zuversicht, dem Vaterlande ein wertvolles Stück
afrikanischer Erde erschlossen zu haben.
|