
 Bd. 7: Die Organisationen der Kriegführung,
Zweiter Teil:
Bd. 7: Die Organisationen der Kriegführung,
Zweiter Teil:
Die Organisationen für die Versorgung des
Heeres
Kapitel 1: Die
Heeresverpflegung (Forts.)
Ministerialrat Konrad Lau

6. Die Bewirtschaftung der einzelnen
Verpflegungsmittel.
Brot.
Die Sorge um das Durchhalten in der Brotversorgung stand im Vordergrund der
heimischen Ernährungsfragen. Daß bei Aufrechterhaltung des im
Frieden üblichen Brotverbrauchs die heimischen Ernteerzeugnisse auch
unter Zurechnung der noch aus dem neutralen Auslande hereinkommenden
Einfuhren den Bedarf nicht decken konnten, war bekannt, und bereits im Oktober
1914 wurde in Erörterungen der
Reichs- und Landesbehörden über die Möglichkeit des
Durchhaltens bis zur neuen Ernte Zahlenmaterial gegeben, das keine Zweifel
darüber ließ, daß äußerste Beschränkung des
Verbrauchs an Brotgetreide geboten war.
Die Brotportion für das Feldheer war auf 750 g festgesetzt (540 g
Backmehl) und berechnet für Leute, die großen Anstrengungen
ausgesetzt und an Aufnahme reichlicher, massiger Nahrung gewöhnt waren.
Für Leute in ruhiger Tätigkeit, die es ja nach Beginn des
Stellungskrieges und an den rückwärtigen Verbindungen sowie im
Etappengebiet vielfach gab, war sie neben der vollen sonstigen
Verpflegungsportion recht reichlich. Den individuellen Bedürfnissen
konnte aber bei Festsetzung der Brotration nicht Rechnung getragen werden; es
erschien auch unerwünscht, Abstufungen in der Portionsbemessung
vorzunehmen. Der Mann im Schützengraben war zwar in erhöhtem
Maße in Lebensgefahr, war aber körperlich nicht so angestrengt, wie
der Schwerarbeiter in den Wirtschaftsbetrieben der Etappe; trotzdem wäre
es nicht verstanden worden, wenn er etwa schlechter als der Etappensoldat gestellt
wäre. Der Schreiber oder Fernsprecher bei der höheren
Kommandobehörde, der Tag und Nacht auf dem Posten sein und auch in
der Nacht einen Imbiß zu sich nehmen mußte, hatte die höhere
Brotportion genau so nötig wie der Frontsoldat, der aber in ihm einen
Faulenzer hinter dem warmen Ofen und unnötigen Esser sah. Ein gerechter
Tarif, der in der Truppe als solcher anerkannt wurde, war nicht zu finden; und
doch mußte der Versuch gemacht werden, unter Beachtung der
Truppenstimmung. Im Februar 1915 wurde die Brotportion für das
Generalgouvernement Belgien und die Etappen auf 600 g herabgesetzt. Im
März 1917 [47] wurde die Grundportion
allgemein auf 500 g festgesetzt und Erhöhungen durch die
Armee-Oberkommandos zugelassen für Formationen im Gebirge
über 1000 m Höhe auf 1000 g, ferner auf 750 g
für die im Kampf befindlichen Truppen vorderer Linie, für die aus
einem solchen Kampf zurückgezogenen Truppen auf 10 Tage, und auf
600 g für sonst besonders angestrengte Truppen.
Allgemein wurde die Grundportion als zu niedrig empfunden, deshalb wurde sie
mit Beginn der neuen Ernte (Ende Juni 1917) auf 600 g erhöht.
Allmählich wurden Stimmen aus der Front laut, die zugaben, daß
nicht während des Großkampfes eine erhöhte Verpflegung
nötig sei, sondern vorher und nachher; auch an ruhigen Fronten mit
vermehrtem Arbeitsdienst sei bessere Verpflegung erforderlich.
Den Wünschen wurde nach Möglichkeit Rechnung getragen bei
einer Neuregelung im Februar 1918. Die in diesem Zeitpunkt geplanten
Operationen konnten nur glücken, wenn sie mit gut ernährten
Truppen unternommen wurden. In der damaligen Verpflegungslage konnte eine
Besserung der Ernährung nur durch Erhöhung der Brotportion
bewirkt werden. Die der Truppe oft unverständliche feine Gliederung des
Portionstarifs hatte ermöglicht, so viel Ersparnisse im Mehlverbrauch zu
erzielen, daß ohne Erhöhung der dem Feldheer insgesamt
zugesprochenen Mengen die Grundportion auf 700 g festgesetzt werden
konnte. Staffelungen nach oben auf 1000 g für Truppen im Gebirge,
auf 833 g (500 g Soldatenbrot und 333 g Weißbrot)
für Ballonbeobachter und Flieger, 750 g für Jugendliche und
Mannschaften von über 42 Lebensjahren wurden zugelassen, nach unten
auf 600 g für Etappenformationen angeordnet, die nicht im
Zusammenhange mit größeren Kampfhandlungen besonders
angestrengt tätig waren, und für die Besatzungstruppen im
Generalgouvernement Belgien, auf 500 g für das
Geschäftszimmerpersonal und Heeresangehörige ohne sonderliche
Anstrengungen. Außerdem waren gewisse Härteausgleiche durch die
Armeeoberkommandos erlaubt.
Daß eine gleichartige Abfindung aller Soldaten zur Brotvergeudung an
einzelnen Stellen führen mußte, war auch in der Truppe
frühzeitig anerkannt. Von verschiedenen Stellen war daher der Vorschlag
gemacht, die Brotkarte mit der Maßgabe einzuführen, daß jeder
innerhalb gewisser Höchstgrenzen Brot empfangen, für nicht
empfangenes aber in Geld entschädigt werden könnte. Angestellte
Versuche haben die Unzweckmäßigkeit dieses Verfahrens für
das Feldheer gezeigt. In vorderster Linie war es nicht anwendbar. Zwischen
vorderster Linie und Ruhestellung war aber ein reger Wechsel. Die Gefahr,
daß Leute, um das Geld für nicht benutzte Karten zu erlangen, sich
nicht hinreichend ernährten, war nicht von der Hand zu weisen. Die
Versorgung der vielen abkommandierten Mannschaften machte die Ausstattung
mit Brotkarten schwierig und bot reiche Gelegenheit zu Doppelempfängen.
Kontrolle durch Ausweise war unzulänglich, da man die Leute bei
angeblichem Verlust [48] der Ausweise nicht
hungern lassen konnte. Noch mancherlei andere Gründe sprachen gegen die
Einführung der Brotkarte. An einzelnen größeren Orten mit
regem Durchgangsverkehr hat sich die Ausgabe an vorübergehend sich dort
Aufhaltende bewährt.
Trotz aller Sparmaßnahmen blieb der der Heimat zur Last fallende
Mehlbedarf noch recht groß. Das in den besetzten Gebieten geerntete
Brotgetreide mußte zur Versorgung der Bevölkerung voll verbraucht
werden; zum Teil reichte es dazu nicht einmal. Wenn es auch wegen Mangels an
geeigneten Mühlen teilweise zur Vermahlung nach Deutschland
zurückgeführt wurde, so ist doch an die Bevölkerung
mindestens so viel Mehl ausgegeben worden, als aus der Landesernte ermahlen
werden konnte.
Durchschnittlich 100 000 t monatlich blieben auch nach allen
Einschränkungen des Verbrauchs aus der Heimat zu liefern. Das war eine
gewaltige Anforderung, der die Heimat nur unter größter
Selbstbeschränkung nachkommen konnte; und mehr als einmal schien der
Zusammenbruch der Mehlversorgung vor der Tür zu stehen. Zur
Verhütung des Äußersten mußte im Sommer 1918 der
planmäßige Nachschubweg verlassen werden, um das in den
heimischen Mühlen aus den ersten
Frühdrusch-Anlieferungen ermahlene Mehl möglichst schnell zu den
Armeen gelangen zu lassen, bei denen Reserven nicht mehr vorhanden waren. Der
Generalintendant erhielt von der Zentralstelle für Heeresbeschaffungen die
in den Mühlen in den nächsten Tagen bereiten Mehlmengen
telegraphisch mitgeteilt und verteilte sie auf die Armeen, und die telegraphisch
oder telephonisch benachrichtigten Etappenintendanturen mußten die der
Armee zugeteilten Mengen unmittelbar von den Mühlen abrufen. Nur so
gelang es, ohne Stockung der Brotversorgung in das Erntejahr 1918
hinüberzukommen.
Die Güte des im Felde erbackenen Brotes mußte der
Abwärtsbewegung derjenigen des heimischen folgen, wenn auch so viele
Streckungsmittel wie in der Heimat im Felde nicht zur Verfügung standen.
Die durch die Not erzwungene Verwendung von 94%igem Mehl statt des im
Frieden gebräuchlichen 82%igem verminderte die Haltbarkeit des Brotes
und vergrößerte die Gefahr des Verschimmelns, da die Brote infolge
des hohen Kleiegehaltes, wenn sie nicht sehr scharf ausgebacken wurden, innen
feucht blieben. Das war ein großer Übelstand, denn das Brot konnte
in den Feldmagazinen nicht immer, erst recht aber nicht bei der Truppe, vor
Feuchtigkeit geschützt werden und war dadurch schon der
Schimmelbildung besonders ausgesetzt. Erhebliche Verluste ließen sich
nicht vermeiden. Der große Kleiegehalt des Brotes hatte auch sonst noch
manche erheblichen Nachteile, und nur die auf das äußerste
gesteigerte Not kann die Verwendung solchen Mehls im Felde rechtfertigen.
Als Brotbestandteil für die eisernen Portionen war ein aus Weizenmehl und
Eiern hergestellter Eierzwieback eingeführt. Obwohl er ein nahrhaftes
[49] Gebäck war und
sich vor allem eignete, jeweils in kleinen Mengen genossen, das
Hungergefühl zu vertreiben, hat er sich als Ersatz für Brot bei der
Truppe nie eingebürgert. Wenn er im Frieden bei den Herbstübungen
weggeworfen wurde und am Boden liegend noch nach Tagen die
Biwaksplätze erkennen ließ, so hatte man geglaubt, das darauf
zurückführen zu sollen, daß die Truppe ihn zu wenig kannte,
auch an dem einen Tag, wo er statt Brot ausgegeben wurde, ohne ihn nicht
Mangel litt. Im Kriege sind aber die gleichen Erfahrungen gemacht. Der Zwieback
wurde vom Mann, der ihn ja dauernd mit sich führte, allmählich
aufgeknabbert, noch häufiger als unnötiger Ballast fortgeworfen; in
den Verpflegungsdepots der Truppen bildete er aber ein besonderes
Anziehungsmittel für die Ratten. Jedenfalls erfüllte er nicht in der
erhofften Weise seinen Zweck, das Brot in Notfällen zu ersetzen. Von
verschiedenen Seiten wurde schließlich der Vorschlag gemacht, den
Zwieback durch kleine, sehr scharf ausgebackene Brote, die lagerbeständig
waren, zu ersetzen. Aus rein wirtschaftlichen Gründen, da einerseits ganz
außerordentlich große Bestände an Zwieback vorhanden waren,
andererseits Mehl knapp war, ist es zu einer Einführung solcher Brote nicht
mehr gekommen.

Fleisch.
An Fleisch bestand zunächst kein Mangel. Die Truppen fanden in
unmittelbarer Nähe ihrer Unterkunft fast überall Schlachtvieh, und
die Feldküchen erleichterten die Verwendung des frisch geschlachteten
Fleisches. Ja, Vieh war in so reicher Menge vorhanden, daß gegen Ende
August 1914 der Generalintendant beim Kriegsministerium eine Verringerung der
für den Nachschub bereitgestellten
Dauerfleisch- und Schlachtviehbestände anregen konnte. Aus besonders
viehreichen Gegenden konnte noch Vieh in die heimischen Konservenfabriken
zurückgeführt werden. Die Truppe stand sich recht gut bei dem
Versorgungsverfahren, bei dem die Portionen nicht peinlich genau zugewogen
wurden.
Das Verfahren, das Schlachtvieh wahllos dem Lande dort zu entnehmen, wo es
gerade gebraucht wurde, war bequem, mußte aber, in derselben Gegend
längere Zeit betrieben, zu einer Vernichtung des Viehbestandes
führen und damit zu einer schweren Schädigung der Truppe.
Die Verwaltung mußte deshalb darauf Bedacht nehmen, überall
sobald als möglich eine ordnungsmäßige Viehwirtschaft
einzuführen und aus dieser nur so viel Schlachtvieh herauszuziehen, wie
eine zweckmäßige Wirtschaft gestattete. Die Viehbestände
erholten sich unter der sorgsamen Obhut landwirtschaftlicher
Sachverständiger allmählich, und die von den verantwortlichen
Feldstellen trotz mancher scharfen Kritik zielbewußt durchgeführte
pflegliche Behandlung der Viehbestände hat sich glänzend
bewährt. Es wurde nicht nur erreicht, daß Molkereien eingerichtet
werden konnten, die die Truppen in nicht zu unterschätzendem Umfange
mit Butter versorgten und dadurch die Heimat [50] ganz erheblich
entlasteten, sondern es wurde auch in den Viehbeständen eine
Schlachtviehreserve bei den Armeen geschaffen, auf die in Fällen des
Versagens des Nachschubs - und diese Fälle waren leider nicht
selten - zurückgegriffen werden konnte, oder dann, wenn es galt, der
Heimat über besonders große Schwierigkeiten in der
Viehaufbringung hinwegzuhelfen. Wiederholt ist in solchen Augenblicken mit
dem Abschlachten bis an die äußerste Grenze des Erträglichen
gegangen und so die Versorgung des Feldheeres ermöglicht worden, ohne
in der Heimat die Fleischversorgung ganz lahm zu legen.
Der Viehbestand wurde zeitweilig noch dadurch verstärkt, daß zur
Ausnutzung der Weiden in den besetzten Gebieten Magervieh aus Deutschland
eingeführt wurde, das später als Schlachtvieh Verwendung fand. Die
Truppen auf dem östlichen Kriegsschauplatz konnten infolge der
zweckmäßig betriebenen Viehwirtschaft im letzten Jahre nach ihrer
Verringerung ganz auf die Versorgung aus dem Lande verwiesen werden, und
darüber hinaus konnte von dort noch Vieh an die heimischen
Konservenfabriken usw. für die Versorgung des westlichen
Kriegsschauplatzes abgegeben werden.
Mit allen Mitteln wurde auch die Schweinemast auf dem Kriegsschauplatz -
vornehmlich bei der Truppe - selbst unter Ausnutzung der
Küchenabfälle gefordert, nachdem das große
Schweineabschlachten in der Heimat im Frühjahr 1915, an dem sich auch
das Feldheer durch vermehrtes Heranziehen von Schweinen aus der Heimat
teilweise bis zum Überdruß der Truppe hatte beteiligen
müssen, beendet und das Schwein zu einer Seltenheit geworden war. Durch
Gewährung von Aufzucht- und Mastprämien wurde das Interesse der
Truppen an der Mästung von Schweinen gefördert. Die Truppe
bekam zum Teil Läuferschweine geliefert; zum Teil (bodenständige
Formationen) trieb sie auch Schweinezucht. Auch auf das Halten von Kaninchen
wurde ihr Augenmerk gelenkt.
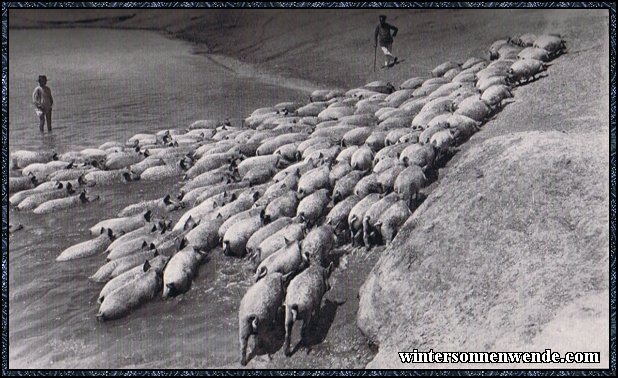
[48a]
Schweinezucht in Crajova
(Rumänien).
|
Mit dem Nachlassen der Viehentnahme aus dem Lande bei Einführung
einer geordneten Viehwirtschaft, hatte der Nachschub an Schlachtvieh aus der
Heimat verstärkt werden müssen und aus einer gelegentlichen
Aushilfe war eine fortlaufende Zuführung geworden; die Ersatzviehdepots
wurden aufgelöst und die Viehtransporte nach Weisung der Zentralstelle
zur Beschaffung von Heeresverpflegung, ohne die Sammelstationen zu
berühren, von den Abnahmestellen in den Lieferbezirken unmittelbar zur
Etappe durchgeführt. Damit waren manche Übelstände
ausgeschaltet, wie unnötiges Ein- und Ausladen, Seuchengefahr durch
Ansammeln von viel Vieh an einer Stelle usw. Die Transportdauer und die
mit dem Transport und dem vorübergehenden Aufhalten in den Depots
verbundenen Gewichtsverluste waren erheblich eingeschränkt. Es bedurfte
aber einer großen Beweglichkeit der Zentralstelle im Disponieren, um den
stark schwankenden Bedarf und den sich deshalb oft ändernden
Anforderungen der Armeen Rechnung tragen zu können. Trotz [51] ganz
außerordentlicher Schwierigkeiten (Abhängigkeit von den
Viehhandelsverbänden, sehr unregelmäßige Lieferungen der
einzelnen Bezirke, Transportschwierigkeiten usw.) ist ihr das aber in
Grenzen des damals Möglichen gelungen.
Lange konnte die durch die Verpflegungsvorschrift festgesetzte volle
Fleischportion gegeben werden. Als aber der Mangel in der Heimat dazu zwang,
den Verbrauch durch Verordnungen einzuschränken, wurde im März
1916 auch beim Feldheer die Fleischportion von 375 g auf 300 g und
die Dauerfleischportion von 200 g auf 150 g herabgesetzt, und schon
im April mußte zur weiteren Einschränkung des Verbrauchs ein
fleischloser Tag eingeführt werden. Doch auch der so
ermäßigte Bedarf konnte nicht gedeckt werden. Im Mai 1916 wurde
bestimmt, daß an den sechs Fleischtagen nur je 250 g von den
Armeen angefordert werden dürften, die so zu verteilen wären,
daß die kämpfenden Truppen in vorderster Linie 300 g, die
übrigen Truppen einschließlich Etappenformationen entsprechend
weniger erhalten sollten. Als Ersatz für das ausgefallene Fleisch wurde ein
Speisemehlzuschuß von 75 g bewilligt, Zulagebewilligungen an
Fleisch wurden verboten.
In den Generalgouvernements waren die Portionen schon im Frühjahr 1916
auf 250 g herabgesetzt. In Rumänien wurden vom Frühjahr
1917 an zwei fleischlose Tage eingeführt, an den fünf Fleischtagen
nur noch je 200 g gewährt, um mit dem aus dem Lande
aufkommenden Schlachtvieh zu reichen; im Osten wurde die Portion auf
250 g im Operationsgebiet und 200 g bei der Etappe gesenkt. Gegen
das immer wieder aus der Heimat ergehende Drängen, im Hinblick auf die
außerordentlich geringen Fleischportionen, die daheim nur noch gegeben
werden konnten, wo schon fleischlose Wochen hatten eingeführt werden
müssen, mußte im Interesse der Schlagfertigerhaltung der Truppe
Widerstand geleistet werden, mußte doch damit gerechnet werden,
daß sie ohnehin wegen Stockens des Nachschubs, besonderer
Gefechtslage usw. nicht immer die vollen Verpflegungsportionen
bekam.
Ein Teil des Bedarfs an Fleisch wurde durch Konserven und Dauerfleisch
gedeckt.
Im Frieden hatten nur zwei Armeekonservenfabriken (Mainz und Spandau)
Fleischkonserven für den Heeresbedarf an eisernen Portionen (in
Ein- und Zweiportionspackungen) hergestellt. Im Laufe des Krieges war eine
ganze Reihe von leistungsfähigen und zuverlässigen Privatfabriken
zu Heereslieferungen herangezogen, und zugleich war die Herstellung der
verschiedensten Arten von Dauerfleisch in Auftrag gegeben. Solange das Feldheer
noch reichlich frisches Fleisch aus dem Lande nehmen konnte, hatten sich seine
Anforderungen an Dauerfleisch im wesentlichen auf Ersatzanforderungen
für verbrauchte eiserne Portionen beschränkt. Bald aber ergaben sich
Lagen, in denen der Truppe allein Dauerfleisch verabfolgt werden konnte;
allerdings konnten häufig in solchen Lagen große Packungen,
Konserven in großen Büchsen,
Pökel- [52] fleisch in
Fässern usw. nichts nutzen. Dauerfleisch wurde weiter dringend
benötigt zur Niederlegung einer jederzeit verwendbaren Reserve. In
welchem Umfange Dauerfleisch, in welcher Zahl Schlachtvieh
nachzuführen war, hatte sich entsprechend den allgemeingültigen
Nachschubgrundsätzen nach den von den Armeen an die Zentralstelle zu
stellenden Anforderungen zu richten. Diese gab die Anforderungen an
Dauerfleisch an die stellvertretende Intendantur in Altona weiter, von der die
Herstellung von Dauerfleisch und seine Verteilung geleitet wurden.
Die Schwierigkeiten in der Aufbringung des Viehs wurden indessen immer
großer; immer beschränkter wurden die Beschaffungsstellen in der
Freiheit ihrer Entschlüsse, immer mehr schrieb die Not das Gesetz vor. Die
Wünsche der Armeen, ja ihre dringendsten Interessen mußten immer
mehr in den Hintergrund treten gegenüber der wichtigsten Forderung, die
Möglichkeit des Durchhaltens einer auch noch so knappen
Fleischversorgung zu sichern. Ansammlungen von Fleischreserven über ein
ganz geringes Maß hinaus konnten den Armeen, selbst vor bevorstehenden
Großkampfhandlungen, nicht mehr gestattet werden. Wieviel Schlachtvieh
sie bekommen konnten, richtete sich allein nach den
Aufbringungsmöglichkeiten. Dabei sank das Schlachtgewicht immer mehr
und entsprach nicht annähernd mehr dem von der Reichsfleischstelle bei
der Verteilung zugrunde gelegten Durchschnitt. Dieses war zuletzt zwar nur noch
auf 160 kg für Rinder angenommen, erreichte aber oft nicht mehr
120 kg, nachdem es im Juni 1916 schon auf 200 kg (für
Schweine auf 70 kg, Schafe 20 kg) gesunken war.8 Strebte der Generalintendant, der die
knappen Belieferungen schließlich einheitlich in engster Zusammenarbeit
mit der Zentralstelle auf die Armeen verteilen mußte, auch immer noch
Versorgung mit einem Drittel in lebendem Vieh an, so wurde dieser Satz bei
Armeen, die auf schlechte Lieferbezirke angewiesen waren,
oft - selbst unter erheblichen Eingriffen in die
Landesviehbestände - nicht erreicht.
Auch in der Dauerfleisch- (Konserven-) Herstellung wurden äußere
Umstände für die Verwaltung immer mehr ohne Rücksicht auf
den Bedarf bestimmend. Gewisse ihr zugewiesene Viehmengen konnten nur zu
Konserven verarbeitet werden. So konnte das aus dem Verwaltungsgebiet des
Oberbefehlshabers Ost gelieferte Vieh nicht lebend nach dem Westen gefahren
werden; es mußte, ebenso wie anderes eingeführte Vieh, zu
Dauerfleisch verarbeitet werden. Traten Zeiten des Überangebots an Vieh
in der Heimat, z. B. bei Verminderung der Weidemöglichkeiten ein,
so mußte die Heeresverwaltung helfend einspringen und das
überschießende Fleisch einstweilen einfrieren und später zu
Konserven verarbeiten. In gefrorenem Zustande konnte es nicht an die über
72 Stunden entfernt gelegenen Frontteile geschickt werden. Auch an näher
gelegenen [53] Teilen war es schwer
verwendbar, da keine Gewähr bestand, daß es unmittelbar nach dem
Auftauen zubereitet werden konnte.
Andererseits wurde die Konservenherstellung aber durch den allgemeinen Mangel
an Weißblech begrenzt. Versuche in der Herstellung anderer
Konservenbehälter waren angestellt, aber erst kurz vor Kriegsende
abgeschlossen.
Ein teilweiser Ersatz des Fleisches durch frische Fische war nur da
möglich, wo solche im besetzten Gebiet selbst gefangen wurden. Das
beschränkte sich aber auf Ausnahmefälle. Allein die Heeresgruppe
Mackensen konnte in Rumänien ihren Bedarf voll durch eigenen Fang
decken. Im Gebiet des Oberbefehlshabers Ost wurde eine teilweise Versorgung
durch Fischereiabteilungen in Libau (Fangergebnis etwa 500 t monatlich in
günstiger Jahreszeit) und später in Riga und auf Ösel
durchgeführt. Auch Süßwasserfische wurden an der Ostfront
gefangen und an die Truppen ausgegeben; es konnten damit aber immer nur Teile
der Truppen beliefert werden. An der Westfront bot sich keine Gelegenheit zu
einem lohnenden Fischfang. An der flandrischen Küste wurden von
Ostende und Zeebrügge aus zwar mit wachfreien Vorpostenbooten
Versuche gemacht, die aber nur ein geringes Ergebnis hatten und die Einrichtung
eines regelrechten Seefischereibetriebes, wozu mindestens sechs
Hochseefischdampfer nötig gewesen wären, nicht lohnend
erscheinen ließen, da auch sie nur innerhalb des Küstenschutzes
hätten betätigt werden können. Alle Bemühungen, einen
größeren Nachschub von frischen Fischen einzurichten, sind daran
gescheitert, daß die heimische Seefischerei daniederlag und nicht einmal die
heimische Bevölkerung einigermaßen ausreichend versorgen konnte.
Der Nachschub mußte sich deshalb auf Salzfische und getrockneten
Klippfisch beschränken. Zwar wurden überall Kochkurse
eingerichtet, in denen die sachgemäße Zubereitung von Klippfisch
gelehrt wurde, um die seiner Einführung bei der Truppe entgegenstehenden
Widerstände zu überwinden; großer Beliebtheit hatte er sich
aber kaum irgendwo zu erfreuen.
Auch Eier wurden als Ersatz für Fleisch (ein Ei gleich 50 g Fleisch) in
kleinem Umfange an solchen Frontteilen (Osten und Rumänien) verwendet,
wo sie unmittelbar im Truppenbereich anfielen und nicht in die Heimat
zurückbeordert werden konnten, als Ersatz für die von der
Reichsverteilungsstelle für die Herstellung von Eierzwieback
überwiesenen.
Auf die Zweckmäßigkeit der Verwendung des Fleisches der ja in
allzu großer Zahl abgehenden Pferde wurde von vielen Stellen aus der
Truppe hingewiesen. Obgleich dieses Fleisch unbedenklich für die
Truppenverpflegung hätte nutzbar gemacht werden
können - und freiwillig auch gegessen
ist -, wurde von einer entsprechenden Anordnung hauptsächlich
deswegen Abstand genommen, um der feindlichen Auslandspropaganda nicht
erwünschte Nahrung zu geben, Deutschlands baldigen Zusammenbruch
wegen Hungers überzeugend in Aussicht zu stellen.
[54] Kartoffeln und
Gemüse.
Neben Brot und Fleisch ist für die große Masse der Deutschen die
Kartoffel das Hauptnahrungsmittel. Im Frieden an reichlichen
Kartoffelgenuß gewöhnt, mochte auch im Felde selbst der
anspruchloseste deutsche Soldat die Kartoffel nicht entbehren. Damit war
gerechnet, aber angenommen, daß auf jedem europäischen
Kriegsschauplatz Kartoffeln in so hinreichender Menge geerntet werden
würden, daß an diesem Nahrungsmittel die Truppe nie Mangel leiden
würde. Die Notwendigkeit eines dauernden Nachschubs war schon
deswegen gar nicht in den Kreis der Betrachtungen gezogen worden, weil er
wegen des großen Gewichts der Kartoffeln ausgeschlossen
erschien - wog doch die Kartoffelportion allein mehr als eine volle
Verpflegungsportion einschließlich Brot und Fleisch.
Tatsächlich fand auch die Truppe während des Bewegungskrieges
namentlich nach der Kartoffelreife genügend Kartoffeln im Lande. In Ost
und West stand im Herbst 1914 noch die Ernte aus der letzten Friedensbestellung
zur Verfügung. Im Osten lagen die Hauptkartoffelquellen Deutschlands
unmittelbar hinter der Front, und im Westen konnte das an Kartoffeln reiche
Belgien bei eintretendem Mangel Aushilfen liefern. Mit allen Mitteln versuchte
die Verwaltung auch weiterhin den Kartoffelanbau auf dem Kriegsschauplatze zu
fördern; allein schon der Mangel an Arbeitskräften setzte diesem
Bestreben Grenzen, und viel mehr als durchschnittlich ein Drittel des Bedarfs
konnte in späteren Jahren im Westen nicht aus dem Lande gedeckt werden.
Im Osten erschwerten die ungünstigen
Wege- und Transportverhältnisse das Zusammenbringen der auf den
zerstreut liegenden Ländereien geernteten Mengen, und auch hier deckte
die Landesernte den Truppenbedarf nicht mehr. Weit hinter den Erwartungen der
heimischen Ernährungsbehörden blieben die Aushilfen aus dem
Generalgouvernement Warschau zurück. Wie im Gebiet des
Oberbefehlshabers Ost fehlte es an Transportmitteln und Personal, die über
die für den Verbrauch der Bevölkerung festgesetzten Mengen hinaus
im Lande geernteten Kartoffeln zu sammeln. Selbst das von der
Reichskartoffelstelle als unfehlbar empfohlene Mittel, die jüdischen
Händler, versagte. Auch auf dem rumänischen und dem serbischen
Kriegsschauplatz fehlte es an Kartoffeln. Ein ständiger Kartoffelnachschub
mußte deshalb einsetzen.
Zunächst gingen Aufbringung und Nachschub auf dem üblichen
Wege glatt vor sich. Als aber der Kartoffelmangel in der Heimat
größer wurde, besonders nach der Mißernte 1916, und als auch
die Eisenbahntransportlage immer ungünstiger wurde, stand die Leitung des
Verpflegungsdienstes in der Kartoffelversorgung allen den ungeheuren
Schwierigkeiten in erhöhtem Maße gegenüber, die die
großen heimischen Gemeinwesen während der Jahre der
Kartoffelzwangsbewirtschaftung in so reichem Maße kennengelernt haben,
und deren Folgen weite Kreise der deutschen Bevölkerung haben am
eigenen Leibe spüren müssen.
[55] Den stellvertretenden
Intendanturen, die die Proviantdepots der Sammelstationen zu versorgen hatten,
waren - wie den Zivilbedarfsverbänden - bestimmte
Lieferbezirke zugewiesen, aus denen sie die Kartoffeln nach den
allgemeingültigen Verordnungen über den Verkehr mit Kartoffeln zu
beschaffen hatten. Irgendein Mittel, die Aufbringung zu fördern, hatten sie
nicht. Vielfach hatten sie sogar unter dem Wettbewerb der anderen Verbraucher
zu leiden, die leichter als Behörden sich über lästige
Bestimmungen hinwegsetzen konnten und auch sonst beim Ankauf mehr
Bewegungsfreiheit hatten als diese. Die vom Reich zur Regelung der
Kartoffelversorgung erlassenen Verordnungen (Festsetzungen von
Höchstpreisen, Verfütterungsverbote, Beschränkung der
Brennereien, teilweise Beschlagnahmungen usw.) sicherten nicht die
pünktliche Aufbringung der umgelegten Mengen. Ob andere
Maßnahmen besseren Erfolg gehabt hätten, kann hier nicht untersucht
werden: die Heeresverwaltung hatte nicht das Recht, solche zu ergreifen. Selbst
die Entsendung von Beauftragten der Armeen unmittelbar in die
Aufbringungsbezirke, die zeitweilig die Lieferungen beschleunigten, wurde als
Störung der Gesamtaufbringung verboten.
Untrennbar von der Beschaffungsfrage war die Transportfrage; denn oft riefen in
Zeiten, wo der Ankauf flott vor sich ging, Schwierigkeiten im Abtransport und
unzureichende Wagengestellungen Stockungen in der Anlieferung hervor.
Um Verstopfungen auf den ohnehin auf das äußerste
überlasteten Bahnen zu vermeiden, hatte der Feldeisenbahnchef die
Anordnung getroffen, daß den Einladestationen Wagen nur dann zur
Verfügung gestellt wurden, wenn die Proviantdepots ihrem Bedarf und der
Transportlage vorwärts der Sammelstationen entsprechend Lieferungen
abriefen. Das erschwerte für die Landwirte, die diesen Augenblick nicht
absehen konnten, die Anlieferung sehr, führte auch dazu, daß die
Kartoffeln durch vergebliches Anfahren zur Bahn, Herumstehen bei den
Landwirten bei ungünstigem Wetter schon vor dem Verladen empfindlich
litten oder auch, um sie vor gänzlichem Verderben zu schützen, im
eigenen Betrieb verbraucht wurden und dem Feldheer verlorengingen.
Ganz besonders ungünstig war die Lage für die westlichen
Proviantdepots nördlich Koblenz, die den Nordteil der Westfront zu
versorgen hatten und aus dem Osten Deutschlands, vorwiegend aus
Ost- und Westpreußen sowie Posen beliefert werden mußten. Von
hier mußten auch die Kartoffeln für die Industriezentren jener
Gegend, deren Bedarf während des Krieges besonders groß war,
angefahren werden; denn die Kartoffelerzeugung der Rheinprovinz und
Westfalens hatte schon im Frieden nicht den Bedarf der dichten
Bevölkerung aufbringen können, die übliche Einfuhr aus
Holland fiel aber jetzt fort. Die Größe der der Eisenbahn dadurch
gestellten Transportaufgabe kann man nur in Kenntnis der sonstigen
Anforderungen beurteilen. Immerhin lassen die zu [56] befördernden
Kartoffelmengen allein einige Schlüsse zu. Für die Zeit vom 15.
September 1917 bis 3. August 1918 z. B. betrug die Gesamtanforderung
des Feldheeres an Kartoffeln 2 200 000 t (einschließlich
Futterkartoffeln). Von den darin enthaltenen rund 1 000 000 t
Speisekartoffeln waren allein 700 000 t für die Westfront
bestimmt; davon mußte wenigstens die Hälfte in der kurzen Zeit vom
Beginn der Hauptkartoffelernte bis zum Einsetzen des Frostwetters gefahren
werden. Die Zeit verkürzte sich noch dadurch, daß die Anlieferungen
im großen wegen Mangels an Gespannen erst nach der Herbstbestellung
einsetzten, im Osten, dem Hauptlieferbezirk, also besonders spät.
Für die Ernte 1918 war im Zusammenhang mit einer Neuorganisation der
Lebensmitteltransporte für die Bevölkerung des westlichen
Deutschlands eine Neuregelung für den aus dem Osten belieferten
Nordflügel des Westheeres dahin getroffen, daß die im Osten
eingelieferten Kartoffeln ohne weiteres verladen, auf Sammelbahnhöfen in
die Verpflegungszüge eingestellt werden sollten, die für die
Zivilbevölkerung des Westens bestimmt waren. Diese wurden an
Übergangsbahnhöfe geleitet, wo Kartoffelsammelstellen nach
Weisung der Kartoffelnachschubleitung die vorgemeldeten Kartoffelwaggons
für die einzelnen Armeen zu Zügen zusammenstellen und diesen
unmittelbar zuleiten sollten. Aufgabe der Kartoffelnachschubleitung war es, sich
dauernd über den Bedarf der Armeen und über die Transportlage zu
unterrichten. Sendungen, die nicht von den Kartoffelsammelstellen sofort zum
Feldheere weitergeleitet werden konnten, sollten an heimische Verbraucher
umgeleitet werden.
Die Ereignisse haben verhindert, abschließende Erfahrungen mit dieser
Zuführungsart zu sammeln; sie hätte aber zweifellos eine
Hauptquelle der Übelstände in der Kartoffelversorgung beseitigt, da
auf diese Weise die angelieferten Kartoffeln sofort verladen und auf schnellstem
Wege den Armeen zugeführt werden konnten. Auch hätten die
Lieferungen gleichmäßiger auf die Armeen verteilt und so eine
gewisse Stetigkeit in der Belieferung erzielt werden können.
Das war von ganz besonderer Bedeutung für die beim Feldheer zu
überwinternden Kartoffeln; hier waren sehr trübe Erfahrungen
gesammelt. Unter Zuziehung landwirtschaftlicher Sachverständiger und
peinlichster Beachtung aller Vorsichtsmaßregeln waren alle Vorbereitungen
für die Einmietung oder Einkellerung mit größter Umsicht
getroffen. Die zur Überwinterung bestimmten Kartoffeln trafen aber oft in
einem solchen Zustande ein, daß sie auch bei fachkundigster Einmietung
hätten nicht erhalten werden können. Beim Erzeuger nicht verlesen,
vielfach bei schlechtem Wetter verladen, auf dem langen Transport in offenen
Wagen verregnet, zum Teil angefroren, war nur ein Teil zur Einmietung leidlich
geeignet, ein großer Teil, oft bis 50%, mußte sofort als Futterkartoffel
ausgegeben oder ganz verworfen werden. Dazu kamen die Transporte ganz
unregelmäßig an und häuften sich zeitweise so, daß sie
nicht sofort aufgearbeitet werden konnten. Diese Übelstände aber
ließen sich durch keine Für- [57] sorge der Verwaltung
beseitigen; sie hatte keine Möglichkeit, erhebliche Verluste zu verhindern,
die bei dem allgemeinen Mangel an Kartoffeln nicht ersetzt werden konnten.
Der Gedanke, die im Lande geernteten Kartoffeln vorwiegend einzumieten, lag
angesichts dieser Umstände nahe. Die Truppe aber, die in den letzten
Monaten vor der neuen Ernte die Kartoffeln regelmäßig hatte
entbehren müssen, verlangte mit Recht, daß sie alsbald nach Reife
der neuen Landesernte aus dieser versorgt würde. Bis zum Einsetzen der
Nachschubtransporte gegen Ende Oktober war dann ein großer Teil der
Landesernte verbraucht. Die Versuche, Frühkartoffeln ins Feld
nachzuführen, müssen nach den ganz außerordentlich
schlechten Erfahrungen als gescheitert bezeichnet werden. Selbst gut ausgereifte
Frühkartoffeln können den langen Transport nicht vertragen;
versandt wurden aber recht oft unreife Spätkartoffeln, die vollständig
verdorben bei der Truppe ankamen. Nur die nahe der heimischen Grenze
stehenden Frontteile wurden daher in den letzten Jahren mit Frühkartoffeln
beliefert, leider zum Teil aus dem Osten Deutschlands.
In den Reichsverordnungen über die Kartoffelversorgung war zwar
Bestimmung getroffen, daß die Erzeuger zur Aufbewahrung der erst im
Frühjahr benötigten Kartoffeln verpflichtet wären, so
daß es also genügt hätte, wenn beim Feldheere selbst nur die
für die Wintermonate erforderlichen Kartoffeln eingelagert worden
wären. Leider erwies sich diese Aufbewahrungsart als recht
unzuverlässig, und vergeblich bemühten sich die Intendanturen im
Frühjahr, die am Gesamtlieferungssoll der Lieferungsbezirke noch
fehlenden Mengen herauszubekommen.
So ist nach der Mißernte von 1916 eine befriedigende Versorgung des
Feldheeres mit Kartoffeln nicht mehr gelungen, während 1915 noch
Kartoffeln zur Brotstreckung zur Verfügung standen. 1917/18 schien nach
sehr reichlicher Ernte eine ausreichende Versorgung gewährleistet zu sein;
man glaubte noch Kartoffeln in großer Menge an die Pferde
verfüttern zu können. Im Frühjahr 1918 war aber die Lage
nicht besser als im Jahre vorher. Schon berichteten die Mannschaften nach Haus,
daß sie voll Neid den Pferden beim Kartoffelfressen zuschauten, da sie
selbst Kartoffeln nicht mehr bekämen. Die Verfütterung wurde
eingestellt und doch reichten die Vorräte nur knapp bis durchschnittlich
Ende Juni.
Eine recht wirksame Abhilfe hätte eine regelmäßige
Versorgung mit Kartoffelpräparaten, insbesondere Kartoffelwalzmehl
bringen können. Kartoffelflocken und Dörrkartoffeln waren zwar bei
der Truppe nicht beliebt; sie hätte sich aber daran gewöhnt und sie
mangels frischer Kartoffeln gern genommen, wenn sie gut hergestellt gewesen
wären. Vor allem aber hätten zu Futterzwecken vorwiegend
Trockenkartoffeln geliefert werden können, wodurch der Nachschub
hätte ganz erheblich entlastet werden können.
[58] Die Frage der
Herstellung von Kartoffelpräparaten in größerem Umfange
für die Volksernährung war zwar vor dem Kriege erörtert
worden, Maßnahmen waren aber noch nicht ergriffen. Auch 1915 war die
Leistungsfähigkeit der Trockenverwertungsanstalten noch so gering,
daß das Reichsamt des Innern eine Belieferung des Feldheeres mit
Trockenkartoffeln ablehnen mußte. Später sind dann zwar
Trockenkartoffeln verschiedener Art geliefert, aber nur unzureichend und ganz
unregelmäßig, da die Hauptmenge der Erzeugnisse zur Brotstreckung
in der Heimat verwendet werden mußte. Nicht einmal die entlegenen
Kriegsschauplätze konnten planmäßig mit Trockenkartoffeln
versehen werden; selbst nach dem Balkan und in die Karpathen mußten
frische Kartoffeln nachgeschoben werden, was im Winter aber ganz
ausgeschlossen war. Im Gebirge konnten im Winter auch die bei der Truppe
eingemieteten nicht verwendet werden, da sie von der Miete bis zum
Verwendungsort erfroren wären. Hier machte sich der
Trockenkartoffelmangel besonders empfindlich geltend.
Alle Bemühungen der Heeresstellen, die Herstellung von
Kartoffelpräparaten zu fördern, waren vergeblich; auch ein vom
Generalintendanten besonders mit Pflege dieses Versorgungszweiges beauftragter
Sachverständiger konnte wirksame Abhilfe nicht erreichen. In hohem
Grade hemmend wirkte der Kohlenmangel.
Die tatsächlich verabfolgten Kartoffelportionssätze haben
geschwankt. Den Bedarfsberechnungen war der Tagessatz von 500 g
zugrunde gelegt. Abgesehen davon, daß es oft wochenlang gar keine
Kartoffeln gab, ist auch der Satz von 300 g lange Zeit nicht
überschritten worden, während die nach den
Verpflegungsvorschriften zuständige Portion 1500 g (ohne sonstiges
Gemüse) betragen sollte.
Insoweit er nicht erreicht wurde, wurden andere Gemüse geliefert, wie
Hülsenfrüchte, Reis, Graupen, Grieß, Grütze, Nudeln,
Dörrgemüse, Speiserüben, frischer Kohl, Sauerkohl,
Salzgemüse, Backobst und Speisemehl; für die eiserne Portion
wurden in den Armeekonservenfabriken Spandau und Mainz
Gemüsekonserven aus Hülsenfrüchten oder
Fleischgemüsekonserven aus Hülsenfrüchten und Fleisch
hergestellt.
Von den Dauergemüsen, die, abgesehen von dem in Fässern
verpackten Sauerkohl und Salzgemüse, zum Nachschub ganz besonders
geeignet waren, stand Reis nur in den aus dem Auslande hereingebrachten
Mengen zur Verfügung; allerdings hatte sich das Kriegsministerium gut
eingedeckt. Hülsenfrüchte, die ohnehin nicht überreichlich
geerntet wurden, mußten in erster Linie zur Herstellung eiserner Portionen
verwendet werden. Nudeln, Graupen, Grieß, Grützen (auch
Haferflocken) konnten nur in sehr knapper Menge hergestellt werden, da an den
Getreidesorten, aus denen sie gewonnen werden, großer Mangel herrschte.
Die Herstellung von Backobst entzog der wichtigen Marmeladenerzeugung Obst,
mußte also auch eingeschränkt werden.
Salz- [59] gemüse
einschließlich Sauerkraut konnten nur in der kühleren Jahreszeit ins
Feld geschickt werden. Dörrgemüse setzt bei der Zubereitung langes
Einwässern und auch sonst eine Behandlung voraus, die ihm bei der
Feldtruppe nicht zuteil werden konnte. Gegen Dörrgemüse bestand
deshalb eine ganz offensichtliche Abneigung, insbesondere gegen das gemischte,
dessen Bestandteile (Kohl, Rüben) verschieden schnell weichkochten.
Getrocknete Einzelgemüse fanden allmählich mehr Anklang. Das
Speisemehl sollte zur Herstellung von Suppen dienen, aber auch zum Dicken
anderer Gemüse namentlich in Zeiten des Kartoffelmangels. Oft war
allerdings das Mehl gerade für den Zweck nicht brauchbar.
Büchsenkonserven konnten nur in beschränkter Menge als
Marketenderware ausgegeben werden.
So waren auch in der Versorgung mit Gemüse recht enge Grenzen gezogen.
Vom Kriegsministerium wurden je nach Verfügbarkeit der
Gemüsearten für den Nachschub Pläne aufgestellt, die der
Truppe die Möglichkeit geben sollten, Abwechslung in ihre Speisezettel zu
bringen. Beispielsweise wurde im Januar 1918 folgender Monatsplan
bestimmt:
| 1½ |
Portionen |
Reis (je 125 g), |
| 1½ |
" |
Hülsenfrüchte (je 250 g), |
| 4½ |
" |
Graupen, Grütze, Flocken (je 125 g), |
| 2 |
" |
Nudeln (je 200 g), |
| 4 |
" |
Dörrgemüse (je 60 g), |
| 1 |
" |
Backobst (je 125 g), |
| 1 |
" |
Faßbohnen oder Salzgemüse (je 200 g), |
| 6 - 7 |
" |
Speisemehl (je 250 g), |
| 8 |
" |
Kartoffeln (je 1500 g), |
|
|
| rund 30 Portionen. |
|
Hätte die Truppe das Gemüse tatsächlich in dieser
Zusammenstellung erhalten, so hätte sich bei ihr stets eine
auskömmliche und abwechslungsreiche Gemüsekost herstellen
lassen. In Wirklichkeit war es aber selbst im Stellungskrieg gar nicht
möglich, den Nachschub so zu regeln, daß in den einzelnen
Feldmagazinen die verschiedenen Gemüsearten vorhanden waren und eine
solche Abwechslung erreicht wurde. Das hätte zum mindesten eine
grundsätzliche Entladung der Verpflegungszüge in den
Etappenmagazinen zur Voraussetzung gehabt und eine Neuverladung nach einem
solchen Plan. Das war ausgeschlossen. Die Truppen empfingen aber auch nicht
dauernd bei demselben Magazin, und die Empfangsstärken bei den
einzelnen Magazinen schwankten. Es war auch unvermeidlich, daß, solange
reichlich Vorräte vorhanden waren, die beliebteren Gemüse
vorwiegend empfangen wurden und daß dann Zeiten kamen, in denen
Dörrgemüse den Speisezettel beherrschte. Weiter wurde die
Gemüseversorgung, wie schon dargelegt ist, dadurch wesentlich
verschlechtert, daß es [60] oft nicht möglich
war, für den Monat 12 kg Kartoffeln auf den Kopf auszugeben.
Dringend erwünscht wäre eine Ergänzung des Speisezettels
durch Verabfolgung von frischem Gemüse gewesen. Wo dem Truppenteil
die Möglichkeit gegeben war, Gemüse selbst zu bauen, nutzte er sie
aus, und überall gab es Gärten, die mit großer Liebe gehegt
wurden. Fronttruppen, die viel hin und her geworfen wurden, konnten so nicht
für sich sorgen. Gerade ihnen war aber zu gönnen, daß sie nach
der besonders einförmigen Grabenverpflegung in den Ruhestellungen
frisches Gemüse erhielten. Für den Großanbau kamen fast nur
Speiserüben und Kohl in Frage. Ihr Anbau erforderte aber viel
Arbeitskräfte, und es war schon ein günstiges Ergebnis, wenn
wenigstens in den Sommermonaten für zwei bis drei Tage im Monat
frisches Gemüse aus dem Lande geliefert werden konnte. Auch im
Nachschubwege kam kaum anderes Frischgemüse wie Rüben und
Kohl an die Front; Versuche, frischen Spargel zu liefern, haben kein
günstiges Ergebnis gehabt. Für die große Masse der Truppen
konnte deshalb frisches Gemüse nur in bescheidenem Umfange gegeben
werden.

Fett, Zucker, Getreide, Tabak.
Ursprünglich enthielt die Feldkostportion keine besondere Fettportion. Als
Fett sollte den Truppen das beim Selbstschlachten gewonnene Fett verbleiben,
oder bei Magazinempfängen sollten zu jeder Fleischportion 60 g des
beim Schlachten gewonnenen Fettes ausgegeben werden, soweit es reichte.
Der Generalintendant erkannte bald, daß damit eine ausreichende
Fettversorgung nicht zu erzielen wäre, daß es vor allem nicht zu
erreichen wäre, dem Manne irgendein Aufstrichmittel für das Brot zu
geben. Nach wiederholten Bemühungen wurde im November 1914 die
Einführung einer Fettportion von 65 g Butter oder Schmalz
durchgesetzt. Die anfänglich geäußerten Befürchtungen,
daß die Butter sich nicht halten würde, haben sich nicht als
begründet erwiesen. Es gelang, sie in der Heimat so aufzubewahren und zu
verpacken, daß sie frisch zur Truppe kam. Die Beschaffung der Fettportion
aber machte bei zunehmendem Fettmangel außerordentliche
Schwierigkeiten. Im besetzten Gebiet wurde, wie schon erwähnt, mit
größtem Nachdruck auf Selbstgewinnung von Butter hingewirkt.
Über den Verbrauch der im Lande erzeugten Butter wurde eine strenge
Kontrolle ausgeübt, und der Generalintendant ordnete einen Ausgleich
zwischen den einzelnen Armeen an. Insgesamt sind auf dem westlichen
Kriegsschauplatz (außer Generalgouvernement Belgien) z. B. in dem
Halbjahr 1. Oktober 1917 bis 30. April 1918 4800 t Butter und
4700 t Käse für die Truppenversorgung gewonnen. Trotzdem
blieben noch große Mengen aus der Heimat zu liefern. Anfangs gelang es
noch, Schmalz aus dem Auslande einzuführen, bald aber mußte zu
Ersatzmitteln gegriffen werden. Schweinefleisch in Würfeln geschnitten,
mit Schwarten und Sehnen [61] als Bindemittel
eingekocht, gewährte vollen Ersatz, auch Wurstkonserven (125 g,
später 90 g), vorübergehend auch Halberstädter
Würstchen und Käse (125 g) mußten als Fettportion
aushelfen. Auch ein Gemisch von Talg, Speiseöl und Schmalz wurde als
Speisefett ausgegeben.
Im Mai 1915 wurde die Verwendung von Marmelade (200 g, später 125 g)
an Stelle von Fett eingeführt, die infolge ihres hohen Zuckergehalts an
Nährwert zwar einen gewissen Ersatz bieten konnte, da sie aber oft
tagelang mit Brot die einzige Abendkost war, nur als ein äußerster
Notbehelf angesehen werden muß, an dem sich die Kritik der Soldaten mit
bitterstem Galgenhumor betätigte. Immerhin mußte alles getan
werden, wenigstens diesen Notbehelf sicherzustellen, deshalb wurden
überall im besetzten Gebiet Marmeladenfabriken zur Verarbeitung des dort
geernteten Obstes eingerichtet. Frühzeitig wurde im Osten damit begonnen;
die dort gewonnenen Erfahrungen wurden dann auch für den Westen
nutzbar gemacht. Die Erzeugung wurde außerordentlich
gesteigert.
Im allgemeinen konnte aus den verschiedenen Fett- und Fettersatzsorten der Mann
mit ausreichenden Brotaufstrichmitteln versehen werden. Der
Monatsversorgungsplan hat geschwankt; er stellte sich im allgemeinen auf:
| 3 |
Portionen |
Butter (55 g und statt weiterer 10 g = 30 g Marmelade), |
| 12 |
" |
Schmalz oder fettes Schweinefleisch in Büchsen (Portionssatz wie
bei Butter), |
| 10 |
" |
Wurstkonserven (120 g), |
| 5 - 6 |
" |
Marmelade (125 g), |
|
|
| 30 - 31 Portionen. |
|
Infolge immer mehr zunehmenden Fettmangels verschlechterte sich die
Fettversorgung erheblich, und zwar so, daß ab Mai 1918 die fechtenden
Truppen an mindestens 15 Tagen, die Etappenformationen an 20 Tagen statt mit
Fett mit Marmelade oder Kunsthonig beliefert werden mußten. Im Osten
fand zu dieser Zeit bei dieser Art der Portionsbemessung eine
Übererzeugung an Butter statt, die von der Zentralvermittlungsstelle
für die Einkäufe im besetzten Gebiet zur Rückführung
und Einlagerung größerer Buttermengen in Königsberg
für die Winterversorgung ausgenutzt wurde. Da auch das Schlachtvieh
immer fettarmer und minderwertiger wurde und kaum noch Fett abwarf, war die
Truppe bei so geringer Belieferung mit Fettportionen, von denen ein Teil noch in
Wurstkonserven und Käse bestand, außerordentlich knapp
gestellt.
Auch eine besondere Zuckerportion fehlte in der Feldkost, ihre Einführung
wurde zwar 1915 angeregt, von den Armeen aber als entbehrlich bezeichnet. Zur
Teeportion gab es 17 g, ferner konnten die
Armee-Oberkommandos bei besonderen Anstrengungen Zuckerzulagen
genehmigen. Soweit die Leute darüber hinaus noch Zucker
benötigten, mußten sie ihn in den Marketendereien [62] kaufen. Vom
Frühjahr 1918 an waren die dem Feldheer zufließenden
Zuckermengen so beschränkt, daß eine Kontingentierung stattfinden
mußte. Auf Grund der vom Kriegsministerium dem Generalintendanten
allmonatlich mitgeteilten insgesamt zur Verfügung stehenden Mengen
bestimmte er die Kopfquote für den Monat, die zwischen 35 und
39 g für den Tag schwankte. Aus ihr mußte der gesamte
Zuckerbedarf gedeckt werden. Allein zur Herstellung von Marmelade wurde noch
besonders Zucker bewilligt.
Als Getränkportion kam in erster Linie Bohnenkaffee in Betracht, und zwar
25 g. Im Juli 1916 wurde die Portion auf 19 g herabgesetzt, daneben
wurden 6 g Zichorie verabreicht, die aus dem Gebiete der 4. Armee
(Flandern) geliefert wurde. Schon im Oktober 1916 war eine weitere
Herabsetzung auf 15 g nötig. Schließlich mußte der
Bohnenkaffee durch Malz- und Gerstenkaffee dergestalt gestreckt werden,
daß für 5 g Bohnenkaffee 10 g
Malz- und Gerstenkaffee traten.
An Stelle des Kaffees oder neben ihm als zweite Getränkeportion konnten
3 g Tee ausgegeben werden. Tee war zwar in großer Menge
vorrätig; im Mai 1917 mußte aber auch hier an eine Streckung
gedacht werden. Die Portion wurde auf 2 g bemessen, als zweite Portion
war ein zweiter Aufguß unter Zusatz eines weiteren Grammes gestattet.
Versuche zeigten, daß aus diesen Teemengen durch
5 - 10 Minuten langes Kochen selbst noch dritte und vierte
Aufgüsse bereitet werden konnten. Im Frühjahr 1918 mußte
die Portion auf 1 g bemessen und daneben die Verwendung
selbstgesammelten Ersatztees empfohlen werden.
Als zweite Getränkeportion konnte auch, wo es Witterung und
Trinkwasserverhältnisse erforderten, eine Branntweinportion von
0,1 l, später ab Ende 1917 0,05 l gegeben werden. Zur
Vermeidung von Mißbräuchen war bestimmt, daß die Portion
nur von Tag zu Tag ausgegeben werden dürfte, und zwar nur an solche
Leute, die den Branntwein selbst verzehrten. Gegen eine allzulange fortlaufende
Gewährung wurde ärztlicherseits Einspruch erhoben. Die knappen
Mengen an Trinkbranntwein geboten größte Einschränkung;
der Verkauf von Trinkbranntwein außer
Obst- und Kornbranntwein in den Marketendereien mußte verboten
werden.
Wein wurde außer in Lazaretten als Zuschuß bei besonderen
Anstrengungen, Seuchengefahr und ungünstigen klimatischen
Verhältnissen von den Armee-Oberkommandos bewilligt. Solange er
unbegrenzt dem Lande entnommen werden konnte, machten die Armeen freigebig
Gebrauch davon. Um für spätere Zeiten vorzusorgen,
beschlagnahmte aber der Generalintendant alle im Westen vorgefundenen
Weinbestände. Insbesondere kam es darauf an, den Bedarf der Lazarette an
Rotwein zu sichern, da zu befürchten war, daß infolge der Sperrung
der Einfuhr Mangel an Rotweinen eintreten würde. Aus den so gewonnenen
Vorräten gab der Generalintendant in Bedarfsfällen Wein frei.
[63] Große Mengen an
Wein, auch aus Ungarn, wurden vom Kriegsministerium angekauft, reichen
Nachschub lieferte Rumänien. Der rumänische Wein mußte
allerdings erst in Deutschland behandelt werden, so daß sich seine
Versendung ins Feld verzögerte. Neben diesem Feldkostwein stellten die
Großmarketendereien Weißwein, zum Teil in anerkannt vortrefflicher
Güte, zum Ankauf bereit.
Besonders geregelt war die Versorgung mit Bier. Anfangs wurde dieses von den
Etappenintendanturen, zum Teil auch von den Truppen bei großen
Brauereien bestellt. Bald ergaben sich ganz auffallende Preisunterschiede; auch
stellte sich heraus, daß nur Geschäftskundige in der Lage waren, bei
Abschluß der Verträge erhebliche Übervorteilungen der
Truppen auszuschließen. Im Mai 1916 regte deshalb der Generalintendant
eine einheitliche Bierbeschaffung beim Kriegsministerium an nach dem Vorgang
in Bayern, wo schon die Beschaffung durch die stellvertretende Intendantur des I.
bayerischen Armeekorps erfolgte. Mit dem 1. August 1915 wurde die gesamte
Versorgung des Feldheeres mit Bier, außer mit bayerischem, einer
kaufmännischen Zentrale, der Biereinkaufszentrale der Heeresverwaltung,
unter Kontrolle der stellvertretenden Intendantur des III. Armeekorps in Berlin
übertragen. Bei ihr waren die von den Etappenintendanturen angeforderten
Mengen von den Proviantdepots zu bestellen. Zur Vereinfachung des
Abrechnungsverkehrs wurde bei den Armeen eine Bierverteilungsstelle
eingerichtet. Bayerisches Bier wurde nur an bayerische Formationen geliefert und
kam nur auf Umwegen über diese ausnahmsweise einmal an
nichtbayerische Truppen.
Güte und Menge des Bieres wurden immer geringer, je mehr die Gerste zur
menschlichen Ernährung und zu Futterzwecken unbedingt gebraucht
wurde. Ganz verzichtet werden konnte auf Bier nicht; es war ein unentbehrliches
Genußmittel; aber nur mit schweren Kämpfen konnten die
nötigen Gerstenmengen beim Kriegsernährungsamt erstritten
werden, sie mußten aufs äußerste gestreckt werden. Im Mai
1916 standen noch rund 6 l auf Kopf und Monat zur Verfügung,
später sank der Satz auf 4,3 l. Im Frühjahr 1918 drohte eine
gänzliche Einstellung der Bierversorgung wegen Gerstenmangels. Nur mit
größter Mühe gelang es im letzten Augenblick, die
allernotwendigsten Gerstenmengen frei zu bekommen.
Im besetzten Gebiet waren verschiedene Brauereien eingerichtet, und zwar Ende
1917 an der Westfront 15 mit zusammen rund 23 000 hl
Leistungsfähigkeit monatlich, im Osten 4 mit 6000 hl,
außerdem je 1 in Konstanza, Bukarest und Braila mit zusammen
13 000 hl. Während in der Heimat Bier mit nur 3%
Stammwürze hergestellt wurde, konnten diese Brauereien nur solches mit
6 - 8% fertigen; um so schwerer wurde es dem Generalintendanten,
ihnen die erforderliche Gerste freizugeben.
Besondere Schwierigkeiten machte die Sicherstellung der Flaschen und Gebinde.
Zwar wurden Sammelprämien bei der Rücklieferung von Leergut
[64] gewährt; trotzdem
ging aber viel verloren, und am Mangel an Flaschen und Fässern drohte
wiederholt der Nachschub zu scheitern.
Sehr viel war für die Versorgung mit Mineralwasser geschehen, wonach in
der heißen Zeit große Nachfrage war, die allerdings mit Eintritt
kühlen Wetters sofort erheblich nachließ, so daß die
Versorgung nicht leicht zu regeln war. Große Mengen blieben oft liegen und
drohten im Winter bei Frost mit samt dem immer wertvoller werdenden
Flaschenmaterial verlorenzugehen. Die Kosten mußten aus
Marketendereifonds und sonstigen besonderen Mitteln aufgebracht werden,
Reichsmittel standen nicht zur Verfügung. Neben dem Nachschub von
bekannten heimischen Mineralwässern wurde künstliches
Mineralwasser im besetzten Gebiet hergestellt. Schon im Juni 1915 waren an der
Westfront rund 90 Fabriken im Gange, die täglich rund 275 000
Flaschen herstellen konnten; die Anlagen sind später erheblich erweitert
worden.
Auch Fruchtsäfte wurden vielfach hergestellt. Leider waren die
Vorräte an Zitronensäure nur sehr gering, Weinsäure wurde
viel verwendet, aber auch Saft aus selbstgeerntetem Obst.
Einem dringenden Bedürfnis der Truppen Rechnung tragend, wurde im
Februar 1915 eine Tabakportion, zur Feldkost gehörig, eingeführt,
bestehend aus 2 Zigarren und 2 Zigaretten oder 30 g Rauchtabak oder
5 g Schnupftabak. Vom 1. Mai 1916 ab wurden Offiziere, Beamte,
Offizierstellvertreter und sonstige Gehalt empfangende Unteroffizierklassen von
dem Empfang der Tabakportion ausgeschlossen. Sie mußten sich ihren
Tabak selbst aus Marketendereien beschaffen. Da hierzu nicht immer Gelegenheit
war, litten sie oft Mangel, während die anderen Unteroffiziere und die
Mannschaften durch die Feldkostportionen versorgt waren. Ab 1. Februar 1918
wurde in dieser Portion eine Zigarre durch zwei Zigaretten ersetzt wegen Mangel
an Zigarren.
Die Aufbringung der erforderlichen Tabakwaren war der "Deutschen Zentrale
für Kriegslieferungen von Tabakfabrikaten" in Minden übertragen,
deren sozialer Zweck die Aufrechterhaltung der Tabakindustrie unter
möglichst gleichmäßiger Heranziehung der einzelnen Firmen
je nach ihrer Leistungsfähigkeit war. In Rücksicht auf diese soziale
Aufgabe mußte den Truppen jeder selbständige Ankauf von
Tabakwaren bei einzelnen Firmen untersagt werden. Die Zentrale hat auch ihre
Aufgabe so erfüllt, wie es unter den obwaltenden Umständen
möglich war. Viele Klagen, die aus dem Felde laut wurden, waren
irrtümlich gegen die Zentrale gerichtet. So erregten die Zigaretten mit
Mundstück, die nur ganz wenig Tabak enthielten, den Unwillen der Truppe.
Auch hier wie in so vielen anderen Dingen mußte das Feldheer sich den
dem Mangel Rechnung tragenden einschränkenden heimischen
Bestimmungen fügen. Sie setzten die zu den einzelnen Zigaretten zu
verarbeitenden Tabakmengen immer mehr herab. Für das Feldheer
entstanden dadurch ganz unwirtschaftliche Transporte, da mit den
Zigaretten-Nachschubsendungen, die ohnehin viel Platz [65] einnahmen, eine
Unsumme fast leerer Zigarettenhülsen befördert werden
mußten. Abhilfe war von der Heimat nicht zu erlangen.
Das war um so bedauerlicher, als es bei der oft äußerst gespannten
Transportlage außerordentlich schwer war, die Tabakfabrikate von den
Fabriken zu den Proviantdepots und von dort zur Front zu bekommen. Oft hat
Mangel an Tabak, der bei allen Großkampfhandlungen beinahe
schmerzlicher als Mangel an Verpflegung empfunden wurde, seinen Grund allein
in der Transportlage, nicht aber in zu geringer Erzeugung in der Heimat gehabt.
Diese leistete trotz Mangels an Rohstoffen infolge zweckmäßiger
Verteilung der Rohstoffe und der Aufträge Erstaunliches und konnte im
Frühjahr 1918 noch monatlich liefern:
| Zigarren |
137 590 000 |
Stück |
Feldkost, |
90 000 000 |
Stück |
Marketenderware, |
| Zigaretten |
555 000 000 |
Stück |
Feldkost, |
450 000 000 |
Stück |
Marketenderware, |
| Tabak |
810 000 |
kg |
Feldkost, |
170 000 |
kg |
Marketenderware |
und 15 Millionen Zigaretten für die im Heeresinteresse arbeitende
Bevölkerung Nordfrankreichs. Immerhin deckten diese Mengen nicht mehr
den vollen Bedarf, und der Generalintendant mußte auf Grund von
Bestands- und Bedarfsanzeigen unter Berücksichtigung der Lage an der
Front allmonatlich die zur Verfügung stehenden Mengen verteilen.
Die unmittelbare Ausnutzung der besetzten Gebiete zur Versorgung des
Feldheeres mit Tabakfabrikaten begegnete den heftigsten Widerständen der
heimischen Industrie, die sie mit Erfolg aufrecht erhielt. Die unmittelbare
Ausnutzung der nicht unerheblichen belgischen Ernte wurde unterbunden, und
auch die für die in Mazedonien kämpfenden Truppen fast
unentbehrliche von dem besonders rührigen Etappenintendanten in
Semendria (ursprünglich in Üsküb) eingerichtete
Zigarettenfabrik wurde im Interesse der heimischen Industrie in ihrem Betriebe
sehr behindert. Aus kleinen Anfängen hatte sich die Fabrik zu
Tagesleistungen von über drei Millionen Stück entwickelt, und ihr
allein war es bei den ungünstigen Nachschubverhältnissen zu
verdanken, wenn die Truppen in Mazedonien mit Zigaretten versorgt werden
konnten. Bei Außerachtlassung der Rücksichten auf die heimische
Industrie hätten auch weitere Teile des Feldheeres von dieser Fabrik Vorteil
haben können.
Einen Fehlschlag bedeutete die Lieferung einer Kriegstabakmischung (85%
Buchenlaub und 15% Tabak), mit der das Feldheer im März 1918
überrascht wurde. Kein gutes Zureden, keine Aufklärung halfen:
dieser Ersatz wurde einstimmig abgelehnt, und ärztlicherseits fand die
uneingeschränkte Ablehnung Unterstützung.
Außer den schon erwähnten Zulagen zur Feldkostportion an Zucker
und Getränken konnten die
Armee-Oberkommandos bei besonders großen Anstrengungen weitere
Verpflegungszulagen, wie frische Wurst, Heringe, Dauerfleisch,
Käse usw. nach Maßgabe verfügbarer Vorräte
gewähren. Die Verpfle- [66] gung wurde dadurch bei
den einzelnen Armeen sehr verschiedenartig, was bei dem häufigen
Übertritt der Truppen von einer Armee zu der anderen zu Klagen und
Berufungen Anlaß gab. Andererseits war eine einheitliche Regelung nicht
möglich, da ja diese Zulagen gerade den besonderen, im voraus in ihren
Einzelheiten nicht zu übersehenden Lagen Rechnung tragen sollten. Es
konnten nur allgemeine Gesichtspunkte gegeben und gewisse
Einschränkungen vorgeschrieben werden, um der allgemeinen
Verpflegungslage Rechnung zu tragen.
Marketenderwaren.
Zu nicht vorausgesehener Bedeutung gelangte im Großen Kriege die Frage
der Bereitstellung von Marketenderwaren, und zwar sowohl von
Gebrauchsgegenständen als besonders von
Lebens- und Genußmitteln, von denen allein hier zu sprechen sein wird. Zu
Beginn des Krieges waren bei einzelnen Armeen Verträge mit großen
leistungsfähigen Firmen abgeschlossen, denen zufolge diese an bestimmten
Punkten hinter der Front Marketenderwaren zu angemessenen Preisen zum
Verkauf bereitzustellen hatten. Militärische Gründe (Geheimhalten
von Truppenverschiebungen, Aufrechterhalten klarer
Nachschubverhältnisse usw.) und die Notwendigkeit, die Truppen
vor Ausbeutung zu schützen, auch das allgemeine wirtschaftliche Gebot,
Monopolbildungen einzelner Firmen zu verhindern, ließen es dem
Generalintendanten schon Ende September 1914 angezeigt erscheinen, dem
Aufkommen des aus früheren Kriegen noch im üblen Rufe stehenden
Händlerunwesens hinter der Front dadurch einen Riegel vorzuschieben,
daß die Zulassung von Zivilmarketendereien allgemein verboten wurde.
Eine später bei den Armeen gehaltene Umfrage zeigte, daß die
Anordnung von der Mehrzahl für zweckmäßig erachtet
wurde.
Es wurde nicht verkannt, daß die Heeresverwaltung sich nicht damit
begnügen konnte, allein das für die Truppe unbedingt Notwendige
bereitzustellen, sondern, daß auch solche Waren zum Verkauf gestellt
werden mußten, die den Truppen ihr entbehrungsreiches Leben
erträglicher und nach besonderen Anstrengungen und seelischen
Erschütterungen die Zeit der Ruhe durch besondere Genüsse
reizvoller gestalten konnten. Das mußte aber auch auf dem
ordnungsmäßigen Nachschubwege über die Proviantdepots zu
erreichen sein, von denen die Marketenderwaren über die
Großmarketendereien der Etappen, Korps und Divisionen an die
Truppenmarketendereien gelangten, wo sie mit einem zur Deckung der Unkosten
bestimmten kleinen Preisaufschlag verkauft wurden.
In dem Umfange, wie Privatfirmen, konnten die Proviantdepots allerdings
Sonderwünsche der Truppen nicht berücksichtigen und namentlich
nicht den Wünschen von Feinschmeckern Rechnung tragen. Der Mangel
einer gewissen Eintönigkeit wird einer Massenversorgung stets anhaften.
Trotz immer wiederholter Verbote versuchten einzelne Truppenteile, einzelne
Divisionen, aber auch Etappen unter Abweichung von dem allein eine
einigermaßen gleich- [67] mäßige
Versorgung aller Truppen ermöglichenden vorgeschriebenen
Beschaffungsweg durch Aufkäufer, die nicht immer uninteressiert an den
Geschäften waren, sich unmittelbar mit den gewünschten Waren
einzudecken. Recht bedauernswerte Unzuträglichkeiten, wie
Übervorteilung der Truppe, unkontrollierbare Geschäfte,
Emporkommen von Schiebern und Schleppern, Herumreisen einer großen
Zahl anderem Dienst entzogener Heeresangehörige, ganz ungleichartige
Ausstattung der Marketendereien, Unzufriedenheit der schlechter versorgten
Truppen waren die Folgeerscheinungen, für die nicht an allen
maßgebenden Stellen das rechte Verständnis war, und deren dringend
gebotene Bekämpfung vielfach als Nichterkennen des für die Truppe
Notwendigen empfunden wurde.
Die heimische Ernährungslage zwang leider dazu, den Nachschub von
Lebensmitteln zum Verkauf in Marketendereien immer mehr
einzuschränken. Ab 1. Januar 1917 wurde der Verkauf von Speisefetten,
Kaffee, Tee, Kakao, kondensierter Milch und Branntwein (außer
Korn- und Obstbranntwein) verboten; andere Verbote und einschränkende
Bestimmungen mußten folgen. Ein Teil noch verfügbarer Waren
mußte kontingentiert werden. Gleichzeitig wurde aber die Feldkost immer
einförmiger, und um so lebhafter wurde der Wunsch der Truppen, aus den
Marketendereien andere Lebensmittel dazukaufen zu können. Die aus
schwerem Kampfe kommende Truppe wollte sehen, daß man inzwischen an
sie gedacht, für sie irgend etwas Besonderes bereitgestellt hatte, wenn es
auch keinen sonderlichen Nährwert hatte. Die Bestrebungen des
Generalintendanten, dafür geeignete Waren zu beschaffen, hatten nur noch
geringen Erfolg. Da war es kein Wunder, daß die Truppen, die in
Deutschland keine Waren mehr erhielten, ihre Aufkäufer an die ihnen als
ergiebig bekannten Quellen in den besetzten Gebieten schickten trotz aller
Verbote, die nicht allein deswegen erlassen waren, um die verfügbaren
Lebensmittel der Allgemeinheit zukommen zu lassen, sondern im eigensten
wohlverstandenen Interesse der Truppe. Alle Warnungen vor dem unlauteren
Geschäftsgebahren der hier - ganz besonders in
Belgien - ihre Geldsäcke füllenden "Heereslieferanten"
nutzten nichts. Viel Geld ist vergeudet! Die Waren waren oft schlecht, stets recht
teuer. Die Truppe aber schrie nach Marketenderwaren!
Daß die Marketendereien von den mühsam erhamsterten
Vorräten nicht gern an Truppen, die nicht zu ihrem Verbande
gehörten, abgaben, ist verständlich; ebenso verständlich ist
aber die Unzufriedenheit der den Verband oft wechselnden Formationen,
vornehmlich der Heeresreserven, die dabei zu kurz kamen und meistens wegen
Ausverkaufs verschlossene Marketendereitüren fanden. Vom
Generalintendanten wurde versucht, dem entgegenzuwirken: allerlei
Kontrolleinrichtungen wurden eingeführt, wie Empfangsbücher,
Verteilung der Waren an bestimmten Stichtagen. Die berechtigten Klagen
verstummten nicht. Auch über ungleichmäßige Abfindung der
einzelnen Käufer, namentlich mit [68] seltenen und besonders
begehrten Waren, wurde geklagt; auch hier wurden Kontrollmaßnahmen
angeordnet. Die Durchführung aller Bestimmungen wurde durch besondere
Beauftragte des Generalintendanten nachgeprüft. Wie im täglichen
Leben in der Heimat, zeigte sich aber, daß, je größer der
Mangel wird, desto schwieriger die Durchführung von Bestimmungen ist,
die ihn möglichst gleichmäßig auf die Allgemeinheit verteilen
und so leichter tragbar machen wollen.
Es kam noch hinzu, daß die Marketendereieinrichtungen, wie im Frieden,
als Privateinrichtungen der Truppen galten und daß demnach
Überschüsse der Truppe gehörten. Auch dadurch war
Anlaß zu großen Ungleichheiten bei nebeneinander
kämpfenden Truppen und zu wohl verständlichen Klagen gegeben,
deren Grund aber nicht abgestellt werden konnte, da eben eine Marketenderei
größere Umsätze hatte als die andere, ohne daß jemand
ein Verschulden traf. Es war auch nicht zu vermeiden, daß die
Marketendereien bodenständiger Formationen (Kolonnen,
Armierungskompagnien usw.) sich besonders gut einrichten konnten, viel
verdienten und aus den Überschüssen ihrer Formation mehr
Zuwendungen machen konnten, als es bei den hin und her geworfenen Truppen
möglich war. Solche Fonds sind für die Eigentümer sehr
angenehm, sollten im Interesse der Gesamtheit im Feldheer aber nicht
bestehen.
Gewiß war es bedauerlich, daß es in den letzten Kriegsjahren nicht
mehr möglich war, den überanstrengten Truppen allgemein
Gelegenheit zu geben, sich dieses und jenes Genußmittel in den
Marketendereien zu kaufen, und sehr begreiflich ist das Bestreben aller
Intendanten, ihren Truppen diese Gelegenheit zu verschaffen. Vielleicht
wäre es aber doch besser gewesen, die spärlichere, aber
gleichmäßigere Versorgung auf dem ordnungsmäßigen
Wege in Kauf zu nehmen, als den Grund zu viel Unzufriedenheit zu geben
dadurch, daß einzelne Verbände auf Grund "besonderer
Beziehungen" besser versorgt wurden als andere, die dann geneigt waren,
mangelhafter Fürsorge ihrer Vorgesetzten die Schuld zu geben. Auch hier
hätte sich gezeigt, daß die Truppe Mangel leichter erträgt als
ungleichmäßige Abfindung, und dem Minderbemittelten wäre
das im Felde besonders unerträgliche Gefühl erspart geblieben,
daß für Geld trotz Mangels noch etwas zu haben war. Selbst der
Schein der Bevorzugung einzelner in der Versorgung mit Marketenderwaren
wäre vermieden worden.
Im Stellungskrieg hätte der Fortfall der Truppenmarketendereien und die
Einrichtung guter, leistungsfähiger, für Rechnung des Reiches
betriebener Ortsmarketendereien große Vorteile gehabt. In ihnen
hätte jeder kaufen können ohne Rücksicht auf die
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Verband; damit wäre eine
Quelle großer Unzufriedenheit beseitigt gewesen, die Versorgung der
Truppen wäre vereinfacht, das sehr umständliche, zeitraubende
Ein- und Auspacken, Versenden usw. bei Truppenverschiebungen
wäre vermieden worden und damit auch das Einstellen des Betriebes auf
längere Zeit und die Gefahr [69] des
Nichtberücksichtigtwerdens bei Verteilungen kontingentierter Waren
während des Transports der Formation. Auch wären zu hohe Preise
ohne weiteres vermieden worden, da niemand Vorteil davon gehabt
hätte!
Dagegen sprach ausschlaggebend allein das Interesse der Truppen, sich aus den
Überschüssen des Marketendereibetriebes einen zur freien
Verfügung stehenden Fonds zu schaffen. Alle anderen Bedenken
wären zu zerstreuen gewesen. Beim Übergang zur Bewegung
hätten die Truppen leicht aus den bodenständigen Marketendereien
mit dem Notwendigsten ausgestattet werden können; anders konnte auch
beim Vorhandensein von Truppenmarketendereien nicht verfahren werden, denn
die Hauptbestände der Großmarketendereien
(Divisionsmarketendereien) waren unbeweglich und mußten während
der Operationen irgendwo abgestellt werden. Als 1918 die
Rückwärtsbewegungen einsetzten, mußten sie schleunigst in
die Heimat abgeschoben werden, um die Truppen vor erheblichen
Vermögenseinbußen zu retten. Ihre Sicherung vor dem Zugriff
Unbefugter und ordnungsmäßige Veräußerung ist
für viele Formationen Gegenstand recht ernster Sorge gewesen und nicht
durchweg in unbedenklicher Weise gelungen.
Der Marketendereifrage war, wie gesagt, anfangs nur untergeordnete Bedeutung
beigelegt. Erst der Weltkrieg brachte die Erscheinung, daß das Feldheer
jahrelang auf Kriegsschauplätzen kämpfte, auf denen Handel und
Wandel stockte, auf denen den Soldaten nur selten Gelegenheit gegeben war, im
freien Verkehr einzukaufen. Erst dadurch gelangten die Marketendereien zu ihrer
großen Bedeutung, die, rechtzeitiger erkannt, eine durchgreifende
Neuorganisation dieses Versorgungszweiges hätte veranlassen
müssen. Später war das nicht mehr möglich. Ist es für
die Truppe im Frieden erwünscht, Fonds zu uneingeschränkter
Verfügung zugunsten der Mannschaften zu haben, so ist es im Kriege
notwendig. Bei jeder Truppe kommen Fälle vor, wo auch über die
Bestimmungen hinaus Geld zur Verfügung stehen muß. Dem
hätte durch Gewährung gewisser Beträge zur
Selbstbewirtschaftung unter möglichst weiter Fassung des
Verwendungszwecks Rechnung getragen werden sollen, dann hätte es nicht
des Geschäftemachens mit Marketendereien bedurft.

Hartfutter und Hartfutterersatz.
Weit ungünstiger als die Verpflegung des Mannes gestaltete sich die des
Pferdes.
Nach Ausspruch der Mobilmachung rollte zunächst pünktlich nach
dem Plan der Friedensvorbereitungen Haferzug auf Haferzug aus der Heimat zum
Feldheere, und ebenso pünktlich erhielt die Truppe die schwere
Kriegsration von 6000 g Hafer, für schwere Zugpferde sogar das
Doppelte. Daneben lieferte der noch auf dem Felde in Hocken stehende Hafer
einen nicht unbeträchtlichen Zuschuß, so daß man sich in den
ersten Wochen nicht immer des Eindrucks [70] des Überflusses
erwehren konnte. Bei Formationen, bei denen die Fütterung der Pferde
sachverständig beaufsichtigt wurde, wurde zwar einem allzu
verschwenderischen Haferverbrauch vorgebeugt und beachtet, daß ein
großer Teil der soeben aus dem Lande ausgehobenen Pferde an einen
annähernd so hohen Hafersatz gar nicht gewöhnt war, vielmehr auch
zu einer guten Ernährung bei großer Anstrengung viel weniger
gebrauchte, daneben allerdings Rauhfutter und sonstiges Beifutter, das bei Beginn
der Operationen leicht beizutreiben war. Ein recht erheblicher Teil der Pferde
erhielt aber weit mehr Hafer als er ordentlich verarbeiten konnte, und ohne die
Leistungsfähigkeit der Pferde irgendwie zu beeinträchtigen,
hätte an Hafer so erheblich gespart werden können, daß der
Beginn der Futternot nicht unwesentlich hätte hinausgeschoben werden
können.
So aber spukte schon im Januar 1915 das Gespenst des Hafermangels, und das
preußische Kriegsministerium mußte warnend hierauf hinweisen. Bei
den Armee-Oberkommandos wurde Herabsetzung der Haferration auf 9 kg
für schwere und 5 - 5½ kg für andere
Pferde angeregt; im Februar schon wurden diese Rationssätze vom
Kriegsministerium als bindend eingeführt. Und als sich ergab, daß an
Stelle der 1½ Millionen Tonnen Hafer, die das Feldheer vom 1. Februar
1915 bis zur neuen Ernte bei Gewährung der ursprünglichen
Sätze gebraucht hätte, nur 800 000 t würden
aufgebracht werden können, da mußten im März 1915 die
Rationen auf 6 kg für schwere und 3 kg für die anderen
Pferde herabgesetzt werden; ein jäher Sturz aus der reichlichen Versorgung
im August/September 1914!
Die Ernte 1915, die eine Besserung der Lage bringen sollte, war knapp und
schlecht, so daß eine bemerkenswerte Heraufsetzung der Haferration nicht
möglich war. Die Futternot in der Heimat nahm ständig zu; ohne
Vorräte ging man in das neue Wirtschaftsjahr hinein, dessen Erzeugnisse
früher als sonst zum Verbrauch herangezogen werden mußten und
deshalb am Schlusse wiederum nicht reichten. Durch Druschprämien und
Lieferungsprämien mußte Anreiz zu frühzeitiger Ablieferung
der Umlagen geboten werden. Zum Zustopfen des Loches mußte man ein
anderes in die neue Ernte reißen. Da sie recht ungünstig ausfiel,
versiegten ihre Erträge noch schneller als sonst. Schon im November waren
die Vorräte erschöpft: die täglichen Eingänge bei der
Reichsgetreidestelle deckten nur ein Drittel des Tagesbedarfs.
Im Mai 1918 wurde schließlich die Heeresverwaltung ermächtigt,
statt 270 Mark für die Tonne Hafer 600 Mark zu zahlen. Trotzdem kamen
nur ganz geringe Mengen ein. Das Feldheer wurde auf die Hartfuttereinfuhr aus
Bessarabien, Rumänien und der Ukraine verwiesen, wobei aber ein
großer Teil der Maiseinfuhr für die Brotversorgung der heimischen
Bevölkerung beansprucht werden mußte, sollte die Brotversorgung
bis zur neuen Ernte aufrechterhalten werden. Doch auch die auf diese Einfuhr
gesetzten Hoffnungen erwiesen sich [71] als trügerisch; die
Einfuhr verzögerte sich, und mit Mitte Juni mußte der Nachschub
von Körnerhartfutter auf Ausnahmefälle für besondere
Kampfhandlungen beschränkt werden. Zugleich mußte, wie
früher erwähnt, die Verfütterung von Kartoffeln verboten
werden, um die Versorgung der Mannschaften mit Kartoffeln noch einige Wochen
zu ermöglichen. Die Not hatte einen Höhepunkt erreicht; mit
Weidegang und Ersatzfutter mußten die Pferde durchgehungert werden, bis
die Frühdruschablieferungen aus der neuen Ernte einige Entlastungen
brachten, indessen die Operationen keine geringen Anforderungen an die
hungernden Tiere stellten.
Ein Weg dauernder schwerster Sorge war es, den die Leiter des
Verpflegungsdienstes auf dem Gebiete der Hartfutterversorgung durch alle
Kriegsjahre hindurch zurückgelegt haben, dessen Trostlosigkeit hier nur
angedeutet werden konnte. Mittel, auf Beseitigung des Grundübels, des
Mangels, hinzuwirken, hatten sie nicht; sie mußten auf solche sinnen, die es
ermöglichten, trotz des Mangels die Bewegungsfähigkeit des Heeres
nicht lahmzulegen. Drei Wege boten einige Aussicht: Zweckmäßige
Verteilung der zur Verfügung stehenden Hafervorräte durch
entsprechende Regelung der Rationsgebühr, Einschränkung der
Pferdezahl auf ein Mindestmaß und Verfütterung von
Ersatzfuttermitteln unter gleichzeitiger Förderung von deren Gewinnung
auf dem Kriegsschauplatz.
Ursprünglich war bei der Rationsfestsetzung nur zwischen Pferden
schweren Schlages und anderen unterschieden worden; allein dem Zwange
äußerster Sparsamkeit folgend, mußten den tatsächlichen
Bedürfnissen der Pferde entsprechend feinere Abstufungen vorgenommen
werden zwischen kaltblütigen Pferden schwersten Schlages mit mindestens
1,68 Stockmaß (6½ kg), ausgesprochen schweren
Pferden (5 kg), mittelschweren und leichten Pferden (3 kg),
Panjepferden (1½ kg). Daneben waren besondere Sätze
für Pferde in Lazaretten, Erholungsheimen, Pferdedepots und für
Fohlen angesetzt, außerdem für sonstiges Vieh (Esel, Maulesel,
Zugochsen, Milchkühe, Schlachtrinder, Kälber, Schafe, Schweine).
Dabei konnten diese Rationssätze nur als Grundgebühren angesehen
werden. Es mußte Vorsorge getroffen werden, daß bei der
tatsächlichen Bemessung der Rationen diese sich unter dem Bestreben nach
möglichster Sparsamkeit immer erneut den schwankenden
Verhältnissen anpaßten, dabei den
Witterungs- und Wegeverhältnissen, den
Vor- und Nachwirkungen der Operationen Rechnung trugen. Den
Armee-Oberkommandos mußte es deshalb überlassen bleiben, an den
Normalsätzen zu sparen, andererseits bei besonderem Bedarf innerhalb
gewisser, allmonatlich festgelegter Gesamtmengen Zulagen zu
gewähren.
Das machte den an sich schon recht bunten Rationstarif noch
unübersichtlicher, insbesondere für Kampftruppen, die
häufiger den Armeeverband wechselten. In der Truppe wurde er als
Erzeugnis des grünen Tisches empfunden. Er stellte einen Notbehelf dar,
eine Zwangsmaßnahme, von bitterster Not diktiert.
[72] Die Truppe
wünschte möglichst gleichartige Abfindung nach einfachem, leicht
übersichtlichem Tarif, innerhalb dessen Gebühren ihr das Sparen
überlassen bliebe. Damit wäre gewiß ein Sparen zugunsten der
einzelnen Truppenteile, nicht aber für die Allgemeinheit erreicht worden.
Daß auch trotz des gewählten Zuteilungsverfahrens nach genauer
Rationsberechnung eine gewisse Vorratswirtschaft (allerdings in engsten
Grenzen) bei der Truppe Platz griff, hat manchen Truppenteil vor
äußerster Not bewahrt, läßt aber erkennen, wohin der
von der Truppe gewünschte Weg geführt hätte. Je geringer
aber die zur Verfügung stehenden Gesamtmengen waren, um so weniger
durften Reserven verzettelt werden.
Bei den Anordnungen konnte auch ihr vermutlicher Eindruck auf die Heimat nicht
unbeachtet bleiben, wo immer wieder der Verdacht auftauchte, daß das
Feldheer "hamstere". Gegründet war ein solcher Verdacht meistens auf
Nachrichten aus dem Feldheere von Leuten, die sich nicht klarmachten, welche
gewaltigen Mengen zur laufenden Versorgung des Feldheeres gehörten und
welchen großen Raum Vorräte für einige Tage einnahmen. Oft
wurden auch Einzelvorgänge verallgemeinert. Der Generalintendant
mußte aber der darbenden Heimat zeigen, daß alles, was in seinen
Kräften stand, geschah, die durch die Lage bedingte äußerste
Sparsamkeit zu erzwingen. Das war im Interesse des Feldheeres
unerläßlich, sollte die Opferfreudigkeit der heimischen
Landwirtschaft nicht erlahmen. Straffste Durchführung der Rationierung
war im Hinblick auf die in der Heimat bis zum äußersten gesteigerte
Zwangsbewirtschaftung ein Haupterfordernis.
Der Weg, die Zahl der Pferde einzuschränken, wurde damit beschritten,
daß strengste Innehaltung der vorgeschriebenen Stärken angeordnet
und überwacht wurde. Dadurch wurden die in den ersten Kriegsmonaten
bei den Truppen in recht großer Zahl eingestellten
überplanmäßigen Pferde den Truppen wieder genommen.
Dann wurden aber die Stärkeübersichten selbst einer scharfen
Prüfung unterzogen, und alle irgendwie entbehrlichen Pferde wurden
gestrichen, wobei oft wichtige dienstliche Rücksichten für
Beibehaltung unbeachtet bleiben mußten; so wurden z. B. den
Feldverwaltungsbehörden fast alle Pferde genommen, wodurch ihr
Dienstbetrieb sehr erschwert und erheblich geschädigt wurde.
Im Dezember 1917 ordnete der Chef des Generalstabs des Feldheeres eine
Herabsetzung der Etatsstärken an Pferden auf 92% an; allerdings sollten
für 92% auch dann Rationen empfangen werden, wenn weniger Pferde (bis
zu weiteren 8%) vorhanden wären, damit dann die übrigen um so
besser verpflegt werden könnten. Pferde, die voraussichtlich länger
als zwei Monate nicht kriegsverwendungsfähig wären, sollten in die
Heimat abgeschoben werden, wenn sie dort noch zu verwenden waren;
andernfalls sollten sie getötet werden. Im übrigen enthielten die
Anordnungen weitgehende Hinweise zur sachgemäßen [73] Fütterung
(Quetschen des Hartfutters) und zur Schonung der Pferde, damit auch dadurch der
Futternot Rechnung getragen würde.
Von den Ersatzfuttermitteln, die den Hafer voll ersetzen konnten, waren die
meisten bald so knapp und dringend zu anderen wichtigen
Ernährungszwecken benötigt, daß sie nur in bescheidenem
Umfange die Hafermengen strecken konnten. Roggen und Weizen kamen nicht in
Frage. Aus Gerste wurden dringend gebrauchte Nährmittel hergestellt; ein
Teil mußte auch für Brauzwecke verfügbar bleiben, wenn auch
dieser Teil auf das äußerste eingeschränkt wurde. Gegen
gänzliche Einstellung des Braubetriebes sprachen aber Interessen des
Feldheeres ebenso wie der schwer arbeitenden heimischen Bevölkerung,
der das Bier als Genußmittel nicht ganz entzogen werden konnte. Mais war
zeitweilig knapp und konnte erst nach Besetzung Rumäniens wieder in
größerer Menge eingeführt, aber auch nur zum Teil als
Pferdefutter verbraucht werden. Hülsenfrüchte mußten voll zur
menschlichen Ernährung, vorwiegend zur Herstellung der
Armeegemüsekonserven (eiserne Portionen), verwendet werden. Kleie
wurde nach Einführung des hohen Ausmahlungsgrades von 92% beim
Brotgetreide nicht mehr viel gewonnen und war als Kraftfutter für Rindvieh
und Schweine schwer entbehrlich. Zucker war zu Beginn des Krieges
überreichlich vorhanden; im besetzten Gebiete, insbesondere in Belgien,
wurden außerdem große Mengen Rohzucker vorgefunden. Aber an
die Stelle von Überfluß trat bald Mangel und nur noch geringe
Mengen kamen als Pferdefutter ins Feld, dafür aber Melasse und
Melassemischfutter (28% Torfmull, 75% Melasse) mit einem
Mindestzuckergehalt von 36%.
In welchem Umfange die erwähnten Ersatzfuttermittel an Stelle von Hafer
ins Feld nachzuführen waren, richtete sich allein nach der heimischen
Ernährungslage und den Zuteilungen aus der allgemeinen Bewirtschaftung.
So verwies das Kriegsernährungsamt für das Jahr 1917/18 in ganz
erheblichem Maße auf Verfütterung von Kartoffeln: von einem
Gesamtbedarf von 2 Millionen Tonnen Hartfutter sollten 500 000 t
durch 1½ Millionen Tonnen Kartoffeln ersetzt werden. In dem Rationstarif
wurde deshalb die Hälfte bis zwei Drittel der Haferration nach dem
Verhältnis 1 kg Hartfutter = 2½ kg
Kartoffeln durch Kartoffeln ersetzt. Wenn auch zu befürchten war,
daß neben den Speisekartoffeln so viel Futterkartoffeln nicht
heranzuschaffen waren, selbst bei Ausdehnung des Transportes in die
Wintermonate, so mußte die Maßnahme soweit als möglich
durchgeführt werden, da Hartfutter nicht zur Verfügung stand.
Grünfütterung, die schon im Jahre vorher gute Dienste getan hatte,
mußte wieder aushelfen. Dringend erwünscht wäre es gewesen,
den abgetriebenen Pferden den Weidegang als Zuschußverpflegung ohne
Anrechnung auf die knappe Ration zu gewähren; das war aber nicht
möglich. 160 000 t Hafer mußten durch Weidegang
eingespart werden. Das verlangte eine außerordentlich weitgehende
Ausnutzung der Weiden, waren doch im Vorjahr während des [74] Weideganges im Mai bis
September nur etwa 16 000 t Hartfutter monatlich erspart bei
Anrechnung von 50% Hartfutter auf die Grünfütterung bei nicht
arbeitenden Pferden und von 331/3% bei arbeitenden.
Mit ganz besonderem Interesse wurden beim Feldheere die verschiedenen
Bestrebungen verfolgt, die Zellulose des Strohs mit Chemikalien
(Natron- und Kalilauge, Säuren, Ätzkalk usw.)
aufzuschließen. Im Befehlsbereich des Oberbefehlshabers Ost wurden
frühzeitig Versuche unter Hinzuziehung bekannter Sachverständiger
angestellt. Zu ganz besonderer Bedeutung gelangten die in dem Futterwerk
Plociczno durchgeführten Arbeiten in der Aufschließung des Strohs
mittels Ätzkalks, der leichter zu erlangen war als die sonst verwendeten
Chemikalien. Hier wurde auch die Aufschließung von Holz betrieben,
die - anders als bei dem auch unaufgeschlossen bis zu einem gewissen
Grade verdaulichen Stroh - aus einem an sich gänzlich
unverdaulichen Stoff einen solchen schaffen sollte, der, mit anderen Stoffen
vermischt, ein brauchbares, nahrhaftes und verdauliches Futter ergab.
Später wurden auch im Westen Aufschließungsfabriken angelegt und
auch hier die Forschungsarbeiten auf diesem Gebiete unterstützt, auf dem
sich in der Heimat der Kriegsausschuß für Ersatzfutter mit
großem Erfolge betätigte.
Der Generalintendant hatte die Bedeutung, die diese Bestrebungen für das
Feldheer hatten, voll erkannt. Ein von ihm beauftragter Offizier gehörte
dem Arbeitsausschuß des erwähnten Kriegsausschusses an. Es kam
vor allem darauf an, in der Heimat der Verfütterung dieser Ersatzfutter
weitesten Eingang zu verschaffen, um dadurch das im Felde leichter verwendbare
Hartfutter in größerer Menge frei zu bekommen. Beim Feldheer
selbst mußte es in der Etappe in der Nähe der
Aufschließungsanlagen verfüttert werden, da der Transport auf
weitere Strecken viel Frachtraum erforderte. Die Schaffung der Anlagen,
Sicherstellung der Rohstoffe usw. gingen aber nur langsam vor sich, so
daß die Herstellung von Kraftstroh nicht in der Menge gelang, wie es zur
Besserung der Futterlage unbedingt notwendig gewesen wäre. Nach den bei
der Verfütterung von Kraftstroh gemachten Erfahrungen wäre eine
solche bestimmt zu erwarten gewesen. Die Männer der Wissenschaft, die
sich bereitwillig in den Dienst der Sache auch im Bereich des Feldheeres gestellt
haben, haben sich aber ein großes Verdienst um sein Wohl erworben.
Im Herbst 1917 trat ein Lehrer aus Thüringen an die Oberste Heeresleitung
mit der Anregung heran, all das zu Futterzwecken zu verwerten, was noch
ungenutzt auf dem Lande lag, Quecken, Kräuter, vor allem aber Laub. Der
Generalintendant nahm daraus Veranlassung, sich angesichts der völlig
unzureichenden Versorgung des Feldheeres mit Futter für die
Weiterverfolgung der Anregung auch in der Heimat einzusetzen. Geringe
Anfänge einer entsprechenden Bewegung waren im Königreich
Sachsen vorhanden, sonst bestanden nur Bedenken.
[75] Versuche ergaben,
daß sich das Laubfutter in Kuchen- (Brikett-) Form bringen und so sehr
bequem unverpackt befördern ließ, ohne allzuviel Raum
einzunehmen. Das Laub mußte getrocknet und vermahlen werden. Zur
Geschmacksverbesserung, Beseitigung der allen Laubarten eigentümlichen
Bitterkeit sollten 10% Melasse hinzugesetzt werden, ferner zur Hebung des
Eiweißgehaltes nach Maßgabe der im preußischen
Landwirtschaftsministerium angestellten Analysen des Laubes andere pflanzliche
Stoffe und Produkte (Obsttrester, Ölkuchenteile usw.). Ein besonders
für die Frage interessierter Offizier wurde vom Generalintendanten mit der
Aufgabe betraut, insbesondere die Nutzbarmachung des Laubs für
Futterzwecke zu fördern. In der Heimat nahm sich das Kriegsamt (Stab)
unter Heranziehung der Kriegswirtschaftsämter der Durchführung
mit großer Energie an.
Um die Arbeitskräfte für das Einsammeln des Laubes aufzubringen,
mußten die städtischen Schulkinder mobil gemacht werden; die
Landkinder wurden zu landwirtschaftlichen Arbeiten gebraucht, andere
Arbeitskräfte gab es nicht. Eine umfassende
Aufklärungs- und Werbearbeit war zu leisten, die zunächst
Verständnislosigkeit und Ablehnung in allen Kreisen, auch bei den
Waldbesitzern, begegnete, schließlich aber von durchschlagendem Erfolg
war. Eine gewaltige Sammeltätigkeit setzte ein. Aber die Zahl und
Größe der sonstigen Widerstände und Reibungen schien von
Tag zu Tag zu wachsen. Es fehlte an Darren, Mühlen, Pressen, an Personal
zum Leiten der vorhandenen Einrichtungen; die Versicherungsgesellschaften
lehnten die Versicherungen der Betriebe wegen der Feuergefährlichkeit des
Laubheumehls ab. Vor allem aber (und das verzögerte die Herstellung der
Laubheukuchen am meisten) mangelte es überall an Kohlen. Aus allen
Teilen des Reiches liefen beim Generalintendanten Hilferufe ein. Der
Reichskohlenkommissar hatte diesen Bedarf in seinem Plane nicht
berücksichtigen können und mußte nun "versuchen", die
nötigen Mengen an anderen Stellen zu ersparen. Erhebliche Mengen waren
nötig, denn auf 4000 t Laubheu kamen 1000 t Kohlen,
für die Monate Mai bis September etwa 10 000 t.
Während die Sammeltätigkeit sehr erfreuliche Fortschritte machte,
hinkte die Verarbeitung infolge der vielen unvorhergesehenen, nur durch
dauerndes unmittelbares Eingreifen der Zentralstellen zu beseitigenden
Schwierigkeiten jämmerlich nach. Ende Juni 1918 war noch kein Kuchen
angefertigt, bis Mitte Juli waren 650 t hergestellt. Am 9. August waren
rund 590 000 Zentner frisches Laub und 310 000 Zentner Laubheu
(getrocknetes Laub) eingeliefert, was einer Menge von rund 21 000 t
fertigen Futters entsprach; vermahlen waren aber nur 120 000 Zentner und
an die Front geschickt nur 2000 t Futter. Die im Herbst 1917
aufgenommene und mit ganz besonderem Nachdruck betriebene Arbeit hatte
leider nur wenig zur Linderung der Futternot beitragen können; vielleicht
wären im nächsten Jahre ihr schönere Erfolge beschieden
gewesen trotz der großen Kosten, die die Gewinnung von Laubheu
verursachte. Die Entwicklungsgeschichte [76] dieser Versorgungsfrage
ist charakteristisch für die ungeheuren Schwierigkeiten, die es machte,
einen als zweckmäßig erkannten und Rettung in größter
Not bringenden Gedanken in die Tat umzusetzen, selbst wenn der günstige
und seltene Fall vorlag, daß schließlich alle Zentralstellen an der
Durchführung willig mitarbeiteten. - Auch an der Front wurde Laub
gesammelt. Hier wurden mit gutem Erfolg Versuche gemacht, das Laub
anzusäuern.
Aus den Rückständen der Feldschlächtereien und aus den
Tierkadavern wurde in den
Tierkörperverwertungsanstalten - Anfang 1917 gab es deren mehrere
hundert (im Osten allein 262) - ein sehr eiweißhaltiges Fleischmehl
und durch Vermischung von Blutrückständen mit Kartoffeln und
Sägemehl ein Blutmehl hergestellt, das, in geringen Mengen
verfüttert, ein gutes Ersatzfutter gab und wegen seines
Eiweißgehaltes ein zweckmäßiges Beifutter neben dem
eiweißlosen Kraftstroh bilden konnte. Auch der Panseninhalt der Rinder
wurde getrocknet und mit Blut, Melasse und dergleichen gedörrt oder zu
Futterkuchen gebacken.
So wurden an Stelle des Hartfutters alle irgend erdenklichen Ersatzfuttermittel
verwendet, um die Pferde trotz der dauernden Hartfutternot zu ernähren.
Die Ersatzfuttermittel haben zweifellos wesentlich dazu beigetragen, die
Katastrophe abzuwenden und hätten weit mehr helfen können, wenn
schon im Frieden in ihrer Verwendung Erfahrung gesammelt und die Industrie auf
ihre Herstellung eingerichtet gewesen wäre. Wäre ihre Bedeutung
allgemeiner bekannt gewesen, wäre es vielleicht auch leichter gewesen, die
für ihre Herstellung erforderlichen Rohstoffe freizubekommen und vor
allem die Kohlenversorgung der Ersatzfutterindustrie zu heben. Alle jene
Männer aber, die sich im Kriege der Bearbeitung und Erprobung der
Ersatzfutterfrage mit unermüdlichem Eifer annahmen, erhofften von der
Kriegsarbeit auch nützliche Verwertung der gesammelten Erfahrungen nach
dem Kriege. Hätten sie recht behalten, könnte manche
mühevolle Arbeit noch zu Erfolgen führen, die sie im Kriege nicht
mehr erzielen konnte.
Eine Erfahrung wurde mit allen nicht als vollwertig bekannten Ersatzfuttermitteln
gemacht. Ihr schlimmster Feind war das Vorurteil des Pferdepflegers. Die
Verfütterung der Ersatzfuttermittel erfordert Geduld und sorgfältige
Zubereitung der Mahlzeiten, langsames und verständiges Gewöhnen
der Tiere an das neue Futter. Dabei darf die Beobachtung nicht abschrecken,
daß einzelne Tiere die Annahme verweigern. Auch die
Geschmacksrichtungen der Menschen sind verschieden! Genaue Kenntnis des
Nährwerts der einzelnen Ersatzfuttermittel ist nötig, damit sie nicht
falsch verwendet werden.
Rauhfutter und Rauhfutterersatz.
Auf ein weiteres Aushilfsmittel bei Hartfuttermangel verwies die
Verpflegungsvorschrift, indem sie zuließ, daß 500 g Hafer
durch 1½ kg Heu ersetzt werden könnten, wobei
vorausgesetzt war, daß Rauhfutter in ausreichender [77] Menge zur
Verfügung stände. Leider war das aber nur selten der Fall. Zwar
wurden die Rauhfuttersätze von 3½ kg Heu (und
1½ kg Zuschuß für schwere Pferde) und
1½ kg Futterstroh mit zunehmender Hartfutterknappheit gesteigert
auf 5 - 7 kg Heu und
3 - 5 kg Stroh für schwere Pferde und
3½ kg Heu und 2 kg Futterstroh für die andern.
Meistens konnten aber nicht einmal die ursprünglichen Sätze
gegeben werden, da die Bereitstellung der ungeheuren Mengen Rauhfutter
unüberwindliche Schwierigkeiten bereitete.
Auf dem Kriegsschauplatz kamen große Mengen Rauhfutter auf, wenn auch
die Verhältnisse bei den einzelnen Armeen im Westen und im Osten sehr
verschieden waren. In gewissen Gegenden konnte es nicht voll abgeerntet werden,
weil so viele Arbeitskräfte nicht verfügbar gemacht werden konnten.
Im Osten herrschte im Winter 1915/16 noch außerordentlicher Mangel.
Außer bei der Njemenarmee konnte nicht mehr als
½ - 1 Pfund täglich bis Ende Januar entnommen
werden. Später machten die ungünstigen Transportverhältnisse
die volle Ausnutzung der Ernte unmöglich trotz größter
Anspannung aller Kolonnen und sonstigen Fuhrwerke. Immerhin konnten aus
dem besetzten Gebiet (außer den Generalgouvernements Warschau und
Belgien) aus der Ernte 1916 895 000 t Heu und
646 000 t Futterstroh für die Truppenverpflegung nutzbar
gemacht werden, so daß nur rund 700 000 t Heu und
500 000 t Stroh aus der Heimat nachzuführen blieben. Die
Ernte des Generalgouvernements Warschau konnte wegen der schlechten
Transportverhältnisse, obgleich die Armeen Kolonnen zur Verfügung
stellten, nur zum Teil ausgenutzt werden. Das Generalgouvernement Belgien, das
anfangs gerade an Rauhfutter erhebliche Mengen geliefert hatte, kam aus noch zu
erörternden Gründen für die Versorgung des Feldheeres
später (1916) nicht mehr in Betracht.9 Bei der sehr
schlechten Ernte 1917 sanken die Ziffern auf etwa die Hälfte, so daß
die Nachschubbedarfsmengen auf 1 300 000 t Heu und
1 000 000 t Stroh stiegen. 1918 brachte wegen der
erheblichen Steigerung der Pferdestärken im Westen und Verminderung
des Heuertrages infolge der zum Ausgleich für den Hartfuttermangel
verstärkten Ausnutzung der Weiden zum Weidegang der Pferde keine
größere Entlastung des Nachschubs. Von seiner glatten
Durchführung blieb die Versorgung des Feldheeres mit Rauhfutter
abhängig.
Schon im November 1914 mußte der Nachschub im großen einsetzen,
während man gehofft hatte, daß er nur in Ausnahmefällen Platz
greifen müßte. Die Kriegserfahrungen, insbesondere die aus dem
Kriege 1866 hatten hinreichend dargetan, wie schwierig es ist, ein Feldheer durch
Nachschub mit Rauhfutter zu versorgen. Zwar waren Pressen bereitgestellt, um
durch Pressen des Rauhfutters den Transport zu erleichtern, indessen behielt die
Transportfrage ausschlaggebende Bedeutung in der Rauhfutterversorgung. Es
erwies sich als [78] unmöglich,
Armeen mit nicht ganz glatt laufender Nachschubverbindung mit Rauhfutter auch
nur einigermaßen ausreichend zu versorgen; die Transportschwierigkeiten
wirkten aber auch auf die Aufbringung in der Heimat ein. War bei der
allgemeinen Futternot schon die Beschaffung der gewaltigen Rauhfuttermengen
fast unmöglich, so setzte schließlich die Transportmöglichkeit
Grenzen, die nicht einmal die volle Erfassung der verfügbaren Mengen
gestattete.
Nur bei einer einigermaßen gleichmäßigen Verteilung der
Gesamtnachschubmengen auf das ganze Jahr und Festlegung eines gewissen
Transportprogramms war es überhaupt denkbar, die Transporte zu leisten.
1918 konnten über 5000 t Rauhfutter täglich neben dem
sonstigen Nachschub nicht gefahren werden (Erfahrung Januar bis Juni 1918), so
daß der Nachschubbedarf 1918 von 1 650 000 t Heu
und 1 000 000 t Futterstroh allein wegen der
Transportschwierigkeit nicht einmal voll angefordert werden konnte. Die auf dem
Kriegsschauplatz geernteten Mengen mußten, gleichfalls über das
ganze Jahr verteilt, die Ergänzungsmengen liefern
und - was von ganz besonderer Bedeutung
war - die Reserven für plötzlich eintretende
Bedarfsvermehrungen bilden. Eine auch nur annähernd
gleichmäßige Anlieferung war aber von den heimischen Landwirten
nicht zu erreichen. Bei den außerordentlich schwierigen
Wirtschaftsverhältnissen waren sie gezwungen, die
Bestellungs- und Erntearbeiten in den Vordergrund zu stellen, den Abtransport der
Ernte aber vorzunehmen, wenn es der Betrieb gestattete. So kam es noch mehr als
bei den Kartoffeln, wo ja ähnliche Verhältnisse vorlagen, zu ganz
unregelmäßigen Anlieferungen. Insbesondere konnten die ersten
Monate nach der Heuernte wegen der sonstigen Ernte und der dann einsetzenden
Kartoffelabtransporte nicht voll ausgenutzt werden. August bis Oktober 1916
wurden nur rund 63 000 t Heu an das Feldheer nachgeführt,
im Februar bis April 1917 dagegen 156 000 t. Bei der 2. Armee
trafen anstatt des Solls von 900 t Rauhfutter in den Dekaden 11. bis 20.
Dezember 1916 nur 730 t, vom 21. bis 31. Dezember 556 t, vom 1.
bis 10. Januar 1917 350 t, vom 11. bis 15. Januar 253 t ein, bei der 7.
Armee statt eines Tagessolls von 200 t in den ersten Tagen des Novembers
1917 zusammen nur 87 t Heu und 71 t. Stroh.
So wurden die im besetzten Gebiete geernteten Vorräte gleich nach der
Ernte über Gebühr angegriffen und waren, von einigem
ungedroschenen Getreide abgesehen, im Januar/Februar aufgebraucht. Da die
Leistungsfähigkeit der Eisenbahn nicht gesteigert werden konnte, konnten
die Fehlmengen schon deswegen nicht nachgeliefert werden. Die Aufbringung in
der Heimat wurde aber auch mit fortschreitender Jahreszeit gegen Schluß
des Wirtschaftsjahres von Monat zu Monat schwieriger.
Der so immer wieder entstehenden Rauhfutternot gegenüber waren die
Feldverwaltungsbehörden machtlos. Die Verfütterung von
Ersatzmitteln wie Heidekraut, Schilf, junge Baumtriebe neben den schon
erwähnten, brachte zeit- [79] weilig zwar geringe
Zuschüsse, aber keine Abhilfe. Jeweils konnten wohl Ausgleiche zur
Beseitigung der größten Notstände vorgenommen werden; sie
konnten aber meistens von den abgebenden Stellen auch nur vorübergehend
ertragen werden und an dem Gesamtmangel nichts ändern. Unter ihm litten
die schweren Pferde, an die gerade die größten Anforderungen
gestellt wurden, ganz besonders. Es nutzte nichts, daß für sie nach
Möglichkeit noch größere Hartfutterrationen verfügbar
gemacht wurden, wenn sie daneben nicht hinreichend Rauhfutter bekommen
konnten. Ohne Rauhfutter waren sie selbst bei geringen Leistungen nicht bei
Kräften zu erhalten. Melasse und frische Kartoffeln, die an Stelle von
Hartfutter verfüttert wurden, verlangten reichliche Verfütterung von
Rauhfutter und Häcksel. Auch Grünfütterung und Weidegang
machten das Rauhfutter nicht entbehrlich, zumal daneben schon die
Hartfutterration gekürzt wurde.
|