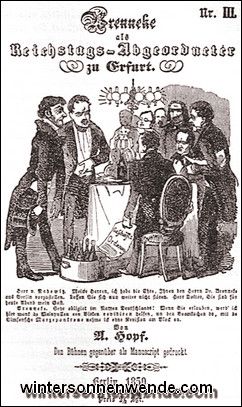|
[Bd. 3 S. 357]

Von vornherein haben Herkunft und Verlauf seines Heranreifens die Eigenschaft in ihm ausgebildet, die ihn vor allen gekennzeichnet hat: jede Frage von vielen Standpunkten her zu betrachten, sie innerlich gründlichst zu verarbeiten und erst nach sorgfältigstem Abwägen aller Meinungen die eigene Ansicht zu bilden. Radowitz war kein Mann der Intuition und des Instinktes, aber dem aus ungarischem Blut stammenden Katholiken, der sich freudig der Welt des protestantischen Preußens einordnete, mußten auch Einseitigkeiten und Voreingenommenheiten des Urteils fernliegen. Sein Großvater war aus der preußischen Kriegsgefangenschaft, in die er bei Hohenfriedberg geraten war, nicht wieder in die Heimat zurückgekehrt; in Blankenburg am Harz ist Radowitz am 6. Februar 1797 geboren, fast genau also ein Altersgenosse Kaiser Wilhelms I. Nachdem er gemäß dem Wunsch seines Vaters seit dem dreizehnten Lebensjahre im katholischen Bekenntnis erzogen worden war, hat er sich ihm Zeit seines Lebens gläubig hingegeben. Im Katholizismus ist eine der Grundsäulen seines Wesens zu erblicken. Auch die weiteren Jugenderlebnisse verstärkten in ihm die Neigung, die Dinge stets von mehreren Seiten zu betrachten. Seine militärische Ausbildung erhielt er als Angehöriger der westfälischen Armee auf französischen Kriegsschulen, machte auch den Feldzug 1813 auf französischer Seite mit, wobei er zweimal verwundet wurde; dann aber, nach Leipzig und dem Zusammenbruch des Reiches Jérômes, hat er unter kurhessischer Fahne gegen Napoleon gekämpft. Jedoch auch in Hessen, wo er trotz seiner Jugend infolge seiner ins Auge fallenden pädagogischen und theoretisierenden Neigungen als Lehrer an der Militärschule in Kassel verwendet wurde, hat sein Bleiben nur wenige Jahre gedauert, allerdings nach eigenem Zeugnis die fruchtbarsten Jahre seines Lebens, da er in ihnen durch Lesen [358] und Lernen den Grundstock seiner Bildung legte. Dann ist ihm durch den hessischen Familienstreit Kassel verleidet worden, wieder mußte er die Fahne wechseln, diesmal aber endgültig. Denn sein Eintreten gegen den Kurfürsten für dessen Gemahlin, die Schwester Friedrich Wilhelms III., und für den Kurprinzen wies ihm den Weg nach Preußen. Durch äußere Fügung also, und nicht wie so viele der großen Reformer durch freie Wahl, ist er 1823 nach Preußen gekommen, aber das hat nicht gehindert, daß er seitdem sich innerlich ihm völlig verbunden hat. "Das lebendige, jugendlich-kräftige und intelligente Treiben", das sich so abhob von dem Ton in Kassel, machte ihm großen Eindruck. Fortan ist Preußen für ihn der Staat geblieben, dem er seine ganze Kraft gewidmet hat, "mit dem er stand und fiel". Leicht allerdings ist ihm der Anschluß nicht gemacht worden. Denn die Welt, in die er nun eintrat, stand seinem Wesen fremd und ablehnend gegenüber. Zwar seine Fähigkeiten wurden anerkannt, rasch stieg er im Generalstab empor, ohne jemals mehr zu eigentlicher Tätigkeit bei der Truppe zurückzukehren, seiner schon in Kassel entwickelten Art gemäß. Radowitz ist auch militärisch der Mann des Schreibtischs geblieben. Aber abgesehen von wenigen Persönlichkeiten, denen er nahetrat, empfand die neue Umgebung den Katholiken anderen Blutes, dessen Großvater gegen Friedrich den Großen und der selbst für Napoleon gefochten hatte, als Fremdkörper. Das Mißtrauen, über das er zu seinem bitteren Schmerz sein Leben lang nicht hat hinwegkommen können, das ihn zur Einsamkeit verdammt und die in seiner Natur liegende Neigung zu Verschlossenheit und Undurchsichtigkeit immer mehr verstärkt hat, kennzeichnet auch schon diese ersten Berliner Jahre. Um so inniger schloß er sich an seinen engeren Kreis, der ihm auch die Lebensgefährtin Gräfin Maria von Voß zuführte. Leidenschaftlich stürzte er sich in dessen Lebenselement, die politische Diskussion, etwas ihm völlig Neues, denn bisher waren ihm bei allem Umfang seines Lesens die politischen Ideen fremd geblieben. Die Reichweite seiner Interessen war auch jetzt noch außerordentlich, wie seine Veröffentlichungen über Formeln der Geometrie und Trigonometrie einerseits, über die Ikonographie der Heiligen andererseits beweisen. Aber den entscheidenden Lebensinhalt gewann er doch durch das Nachdenken über Sinn und Zweck des Staats. Er durchdrang sich ganz mit politischen Vorstellungen, und so stark wirkte das neue Interesse auf ihn, daß er die Anregung gab, zur Vertretung der in dem Freundeskreis lebendigen Gedanken ein eigenes Organ herauszugeben, das Berliner Politische Wochenblatt, das seit 1831 erschien. Radowitz hat in ihm wesentlich die außenpolitischen Fragen behandelt, aber auch die innenpolitische Stellungnahme der Zeitschrift entsprach durchaus seinen Überzeugungen. Es ist die konservative Romantik, der sogenannte christlich-germanische Kreis, zu dem Radowitz sich bekannte. Aufbauend auf den Lehren Karl Ludwig von Hallers stellte er als Grundgedanken voran die Wiederbelebung der Rechts- und Staatsformen der christlich-germanischen Völker, als deren echtesten Ausdruck er [359] den auf den altüberlieferten ständischen Rechten beruhenden Staat ansah. Zu ihm mußte zurückgefunden werden, und dies schien nur möglich durch den grundsätzlichen Kampf gegen die Revolution. Hiermit hatte Radowitz sich das politische Ziel gestellt, dem er unwandelbar, wenn auch mit wechselnden Mitteln, gedient hat. Aber durch diesen Kampf gegen die Revolution sollte keineswegs bloß die auf den Ideen von 1789 ruhende Demokratie getroffen werden, sondern ebenso der fürstliche Absolutismus, der den mittelalterlichen Ständestaat verdrängt hatte. Beides, absolutistischer Beamtenstaat und demokratischer Volksstaat, galten ihm als Abarten des gleichen verhängnisvollen Prinzips, der Überhöhung des Staatsbegriffs. Das Übermaß des Beamtenregiments hatte in den Untertanen das Verlangen nach Verfassung großgezogen und damit dem Schlagwort der Volkssouveränität freie Bahn geschaffen. Sie beide hatten die Ehrfurcht vor den historischen Rechten des Einzelnen, wie sie im Ständestaat gewährleistet war, untergraben und damit die einzig sichere Grundlage zerstört: den freiwilligen Gehorsam, aus dem allein in der Welt des Rechts der wahrhafte Staat, in der der Religion die Kirche auf Erden hervorgehen könne. Das sind die Gedanken, an denen Radowitz bis zu dem erschütternden Eindruck der Revolution von 1848 seine Staatsauffassung gebildet und nach denen er sein politisches Handeln einzurichten gesucht hat – Gedanken, gegen die trotz der gemeinsamen konservativen Überzeugung Leopold von Ranke im Sinne der wahren historischen Entwicklung Einspruch erhoben hat. Aber für Radowitz ist das Bekenntnis zu ihnen auch insofern Schicksal geworden, als er durch sie die für sein Leben entscheidende Freundschaft gewonnen hat zu dem preußischen Thronfolger, dem künftigen Friedrich Wilhelm IV. Dessen Einfluß ist es auch gewesen, der den Freund aus Schwierigkeiten, die aus den Widerständen gegen seine Persönlichkeit erwachsen waren, durch die Verpflanzung in einen anderen Wirkungskreis befreit hat: 1836 wurde Radowitz zum Militärbevollmächtigten beim Frankfurter Bundestag ernannt. Für diesen Posten, der ihm sowohl militärische wie politische Aufgaben stellte, war er durch seine bisherige Entwicklung aufs beste vorbereitet. Aber er konnte nicht ahnen, daß damit auch innerlich für ihn ein völlig neuer Lebensabschnitt begann. Denn nun erfuhr er den aufrüttelnden Anstoß durch die unmittelbare Berührung mit dem brennenden Problem allen deutschen Lebens, mit der nationalen Frage. Fortan hat sie all sein Tun beherrscht. Verständnis für sie hatte er schon früher besessen, aber wie sein ganzer Kreis hatte er den nationalen Gedanken wesentlich kulturell verstehen wollen und sich gegen die praktisch-politische Anwendung aus Ehrfurcht vor den bestehenden Formen gewehrt. Jetzt gingen ihm die Augen dafür auf, daß die stärkste Durchschlagskraft des Nationalismus gerade auf staatlichem Gebiete lag und daß sich deshalb für das konservative Prinzip eine schwere Gefahr ergab, wenn diese Macht in Gegensatz zu den herrschenden Gewalten geriet. Unermüdlich hat er seitdem die Notwendigkeit gepredigt, den Kampf für den besseren nationalen Staat nicht bloß dem Liberalismus zu überlassen. [360] So ist Radowitz in Frankfurt aus dem preußischen zum deutschen Politiker geworden. Handgreiflich die Ähnlichkeit mit Bismarcks Entwicklung: Beide ringen sich am Bundestag angesichts der Realitäten zu Ansichten durch, die ihren bisherigen durchaus zuwiderlaufen, und beide sind dadurch zum Bruch mit den dogmatisch gebundeneren alten Freunden gekommen, die ihnen den Vorwurf machten, der revolutionären Ansteckung erlegen zu sein. Für Radowitz ist die Kluft zu ihnen unüberbrückbar geworden durch den Kölner Kirchenstreit, den Vorläufer des Kulturkampfs. Mit tiefster Trauer erfüllte ihn der Zwist zwischen katholischer Kirche und preußischem Staat, den beiden Gewalten, denen er sich hingegeben hatte. Aus dem Kreis des Wochenblatts hat er sich unter diesen Eindrücken losgelöst. Nur die Freundschaft mit Friedrich Wilhelm hat standgehalten, und auch dessen Thronbesteigung 1840 hat daran nichts geändert. Der Anstoß, den die nationale Bewegung durch das Ausscheiden Friedrich Wilhelms III., dieses Gegners jeder Veränderung, und durch die Hoffnungen auf seinen Nachfolger erfuhr, war um so gewaltiger, als gleichzeitig durch Frankreichs Verlangen nach dem Rhein sich die Kriegsgefahr erhob, wobei Gesamtdeutschland sich einheitlich zur Verteidigung seines Bodens entschlossen zeigte. Radowitz' Empfindungen hierbei lassen deutlich erkennen, wie bedenklich er dazu neigte, auch in solchen außenpolitischen Fragen sich Wunschvorstellungen hinzugeben, die von der Wirklichkeit weitab führten. Denn er meinte, daß die Frucht des siegreichen Kriegs der Wiedergewinn nicht nur des Elsaß, sondern auch der Schweiz und der Niederlande für den deutschen Staat sein könnte, und empfand es deshalb schmerzlich, als das Gewitter sich verzog. So sehr verkannte dieser kluge Mann die europäische Lage und ihre Möglichkeiten. Nachdem auf diese Weise die Gelegenheit, am Feuer des Kriegs die deutsche Einheit zu schmieden, nach seiner Auffassung verpaßt war, setzte er seine Kraft daran, an ihrem Ausbau von innen heraus mitzuarbeiten. Er hat auch nicht unwichtige Erfolge bei seiner unmittelbaren Aufgabe, der Verbesserung des Bundesheereswesens, erzielt. Aber neben dem Militärischen stand ihm stets die Politik, und durch die Ernennung zum Gesandten in Karlsruhe wurde diese Seite seiner Wirksamkeit entscheidend verstärkt. Hierbei beherrschte ihn die neugewonnene Einsicht in die Notwendigkeit, durch eine allgemeine Bundesreform den nationalen Wünschen entgegenzukommen. Über den Bundestag, "diese betrübende Erscheinung", hatte er schon bald ein hartes Urteil gewonnen. "Schon in ihrer Geburt verwahrlost, unter widerstrebenden und sich wechselseitig aufhebenden Einflüssen entstanden, trug die ganze Institution den Keim des Todes in sich." Er klagte über die unaussprechliche Geistlosigkeit der Geschäftsform, und mit dem gleichen Ausdruck wie vor ihm der Freiherr vom Stein und nach ihm Bismarck verdammte er als Grund allen Übels den Souveränitätsschwindel der kleinen Staaten, die kein Opfer zugunsten der nationalen Einheit bringen wollten. Aber er sah auch das andere Hemmnis einer handlungsfähigen Zentralgewalt, die Eifersucht zwischen Österreich und Preußen. An diesem [361] Punkte jedoch zeigt sich deutlich die Grenze, über die Radowitz bei seinem Vordringen aus Wunschträumen zu einer Meisterung der Gegebenheiten entsprechend seiner theoretischen Staatsauffassung nicht hinwegkam: Er erkannte nicht die Unmöglichkeit eines wirklich lebensfähigen einheitlichen Staates, der zwei gleichberechtigte Großmächte in sich vereinigte, sah nicht, daß bei dem Wesen der Großmacht ein solches Nebeneinander in ein Gegeneinander umschlagen mußte. Wie sein König hielt er an Österreich fest, und so hat er sich an der unlösbaren Aufgabe zerrieben, die fruchtbare Zusammenarbeit beider Staaten herbeizuführen, die er auf Grund der großen Vergangenheit für die nationale Zukunft als unentbehrlich ansah. Je länger er mit diesem Problem rang, um so deutlicher wurde ihm die Tatsache, daß Österreich nicht mehr als eigentlich deutscher Staat angesehen und daß daher zum Träger der nationalen Entwicklung nur Preußen werden konnte. Aber vor der letzten Folgerung, die sich hieraus ergab, verschloß er sich; inbrünstig suchte er den Weg, der für beide gangbar sein und doch die nationale Sehnsucht erfüllen würde. Er glaubte ihn darin zu erkennen, daß er für Preußen nur moralische, keine materielle Verstärkung wünschte. Zweifellos hat hierbei die Rücksicht auf den König und dessen Anschauungen sehr stark mitgespielt. Aber die Unermüdlichkeit seines Strebens läßt deutlich erkennen, daß auch die eigene Überzeugung ihn in diese Richtung wies. Allerdings hat die räumliche Trennung seinen Einfluß auf den König in den Jahren nach 1840 zunächst stärker zurücktreten lassen. Voller Sorge beobachtete Radowitz, wie die Schwierigkeiten sich für Friedrich Wilhelm häuften und wie die Zweifel, die er von Anfang an auf Grund der Eigenart des Königs in seinen politischen Erfolg gesetzt hatte – von Radowitz stammt das viel zitierte Wort von der Hamletnatur Friedrich Wilhelms – sich bestätigten. An seinen eigenen Anschauungen hielt er im wesentlichen noch fest und vertrat sie der Öffentlichkeit gegenüber glänzend und geistvoll in seinen Gesprächen aus der Gegenwart über Staat und Kirche (1846). Nach wie vor stand im Mittelpunkt seines Denkens der Kampf gegen die Revolution, wobei er wieder von der "Szylla des administrativen Despotismus und der Charybdis der Parteienherrschaft" sprach. In der Verfassung, dem Allheilmittel des Liberalismus, sah er auch jetzt nur eine Gefährdung der echten Freiheit, da sie Eingriffe in die ursprünglichen Rechte ermögliche, ebenso wie die Volkssouveränität ihm als "die brutalste aller Sklavereien" galt. "Keine Zeit hat mehr von der Freiheit gesprochen als die jetzige, und keiner ist ihr wahrer Begriff mehr abhandengekommen." Darum bezeichnete er das Repräsentativsystem als Vertretung der Meinungen gegenüber der Vertretung der wirklichen Rechte durch das historische Ständetum. Aber so sehr er damit an seinen alten Idealen festhielt, es regten sich doch bereits bei ihm leise Zweifel, ob sie in der Welt des neunzehnten Jahrhunderts noch zu verwirklichen seien. Gleichzeitig erkannte er, daß ein der romantischen Auffassungsweise entsprechender Verzicht auf jeden künstlichen Eingriff in das Geschehen Preußen in Gefahr brachte, [362] hinter der Entwicklung zurückzubleiben. Infolgedessen verstärkte er seine Mahnrufe, daß in der nationalen Frage stärkere Aktivität erforderlich sei, und nach den Enttäuschungen mit der Einberufung des Vereinigten Landtags 1847 fand er bei Friedlich Wilhelm Gehör.
Daß der Sieg der Revolution in Paris auch für Deutschland von schwersten Folgen sein müsse, hatte Radowitz alsbald erkannt. Deshalb sein verstärktes Eintreten für nationale Reform, deshalb aber auch sein Rat an Friedrich Wilhelm, Preußen freiwillig eine Verfassung zu verleihen. In schärfstem Widerspruch zu seiner gesamten bisherigen Stellungnahme hat er also jetzt um der praktischen Notwendigkeit willen befürwortet, dem Verlangen nach Verfassung entgegenzukommen. Nachdem er das ihm selbst so Unerwünschte als unabwendbar erkannt [363] hatte, setzte er sich für rechtzeitiges Nachgeben ein, ehe es erzwungen würde. Nur auf diese Weise würde es möglich sein, die alten Ideale in der neuen Welt lebendig zu erhalten und die Führung für sie zurückzugewinnen. In der Schärfe seines Gegensatzes gegen die Demokratie ist ein Wandel nicht eingetreten, aber er hielt es für unvermeidlich, sie mit anderen Mitteln, auf dem von ihr selbst bereiteten Boden zu bekämpfen. Auch hier also hat er seine theoretische Überzeugung preisgegeben und sich der tatsächlichen Entwicklung gefügt. Aber als am 19. März das preußische Königtum sich vor der Revolution demütigte, waren alle Voraussetzungen der von Radowitz betriebenen Politik zusammengebrochen. Die Wendung gegen Österreich, die Preußen nunmehr nahm, indem Friedrich Wilhelm es an die Spitze Deutschlands zu stellen suchte, mißbilligte Radowitz entsprechend der ganzen Richtung seines bisherigen Handelns; als "rasendes Unternehmen" bezeichnete er diese Pläne des neuen Außenministers Arnim. Auch trat alsbald ein, was er vorhergesagt hatte: das erzwungene Nachgeben machte Preußens Führerstellung zunächst unmöglich. Nicht mehr bei den Regierungen lag die Leitung, sondern das Bürgertum nahm die Lösung des deutschen Schicksals in die eigene Hand. Die Monate bis zum Zusammentritt der Nationalversammlung hat Radowitz, allgemein angefeindet als der Berater bei den reaktionären Plänen des Königs, zurückgezogen auf dem Lande verbringen müssen. Ihre Frucht war die Schrift Deutschland und Friedrich Wilhelm IV., in der er auf Grund seiner Denkschrift vom 20. November 1847, die er hier abdruckte, den Nachweis erbringen wollte, wie stark die preußische Politik auch schon vor dem 19. März unter dem Leitgedanken der nationalen Reform gestanden habe. Vielleicht hat gerade dieser Nachweis dazu beigetragen, daß Radowitz ohne jedes sonstige eigene Zutun von dem Wahlkreis Arnsberg in die Paulskirche entsendet wurde. Nun galt es, im gesamtdeutschen Rahmen die Revolution auf parlamentarischem Boden zu bekämpfen, wie er es für Preußen bereits angeraten hatte. In dieser Überzeugung, daß nach den Ereignissen des März eine Lösung der deutschen Frage ohne Verfassung und ohne Volksvertretung unmöglich und daß nur auf diese Weise die Quelle der Revolution zu verstopfen sei, ist Radowitz nicht mehr schwankend geworden. Verfassung und Volksvertretung waren ihm jetzt "eine schlechthinnige Notwendigkeit um der Krone und um des Landes, um Preußens und um Deutschlands willen", "die gegebene Grundlage, auf der Weiteres aufgerichtet werden kann, ein gewiesener Weg, den man aufrichtig betreten muß, um das Mangelhafte auszuscheiden und durch Vollkommeneres zu ersetzen". So sehr er sich dadurch in Widerspruch zu den eigentlich Konservativen setzte, änderte sich doch äußerlich nichts an seiner Zugehörigkeit zur Rechten, weil er ja nach wie vor an dem Ziel des Kampfes gegen die Revolution festhielt. An dem neugegründeten Organ der Konservativen Partei, der Kreuzzeitung, hat er mitgearbeitet, und in Frankfurt ist er sogar nach anfänglicher, durch das ihm von allen Seiten entgegenschlagende
Als solcher hat er sich stets bemüht, nicht einseitigen Parteirücksichten zu verfallen. Sein Bekenntnis zum Verfassungsstaat führte ihn keineswegs zur Kapitulation vor dem Parteiregiment. Im Gegenteil, politische Parteien, diese "einzelnen von dem lebendigen und lebengebenden Organismus abgesonderten Elemente", galten ihm von Haus aus als "etwas Verwerfliches und Sträfliches", gleichgültig welches ihr Zweck und welches ihre Mittel. Darum wehrte er sich gegen das Überwuchern des Parteistandpunktes, dieses Grundübel des gesamten festländischen Parlamentarismus. Ebenso hat er es strikt abgelehnt, konfessionelle Gesichtspunkte in die Politik hineinspielen zu lassen. Den Ausbau der Interessengemeinschaft, zu der sich die Katholiken der Paulskirche zusammengefunden hatten und deren Vorsitzender er war, zu einer Partei hat er zu verhindern gewußt. Von besonderem Interesse ist es, zu beobachten, wie ein Gedanke, mit dem er sich schon ein Jahrzehnt beschäftigt hatte, durch seine Tätigkeit in der Nationalversammlung festere Gestalt gewonnen hat, so daß er seitdem zum Grundstock seiner Anschauungen zu rechnen ist: durch systematische soziale Arbeit des Staates die Massen für die revolutionäre Propaganda unempfänglich zu machen. Mit offenen Augen verfolgte Radowitz den gewaltigen Umschwung, der damals in Deutschland durch die Entstehung der starken Industrie und damit des Proletariats vor sich ging. Schon in den dreißiger Jahren hatte er geschrieben, daß ein richtig behandelter vierter Stand für die Monarchie eine Stütze gegen die Forderungen des Bürgertums werden könne; 1846 hatte er Sozialismus und Kommunismus als "ganz unabweisliche Konsequenzen aus dem Wesen des modernen Staates" bezeichnet. Daher wünschte er eine gerechtere Verteilung des industriellen Gewinnes und bezeichnete als oberste Aufgabe des Staats die Fürsorge für alle seine Angehörigen. Dem Großherzog von Baden riet er, ein umfassendes soziales Programm ausarbeiten zu lassen: "Hier liegt das Mittel, den vulgären Liberalismus der Mittelklassen in seiner Nichtigkeit aufzudecken und ihn der magischen Kraft zu entkleiden, die er als Vertreter der reellen Volksinteressen usurpiert hat". Auch Friedrich Wilhelm hat er im März 1848 den Rat erteilt, durch energische Sozialpolitik die Stimmung der Arbeiterschaft zugunsten der Krone zu beeinflussen und auf diese Weise eine bessere Zukunft vorzubereiten. Hier hat also Radowitz einen Scharfblick erwiesen, der ihn weit über die anderen Verfechter konservativer Ideale in seiner Zeit hinaushebt. Er ist ein Vorläufer des sozialen Konservativismus, wie er sich theoretisch eigentlich erst in den sechziger Jahren und praktisch durch Bismarck durchgesetzt hat. Wie dieser und wie in England der "Torysozialist" Disraeli hoffte er den Konservativismus zu retten, indem er die Massen für ihn gewann und sie gegen das Bürgertum ausspielte. Allerdings ist es für Radowitz kennzeichnend, daß er auch hier auf halbem Wege stehenblieb: Die Bewilligung politischer Rechte für die Arbeiter lehnte er ab, eine Ausdehnung des [365] Wahlrechts hätte allzusehr seinen Grundideen des von oben her in väterlicher Fürsorge geleiteten Staats widersprochen. Darum würde auch, hätte er Gelegenheit gehabt sein Programm in die Tat umzusetzen, der gewünschte politische Erfolg sicherlich nicht eingetreten sein. Immerhin bleibt seine Einsicht in die Notwendigkeit bemerkenswert, diese die Zukunft bestimmende Kraft zu berücksichtigen. Aber für die achtundvierziger Bewegung in Deutschland ist die soziale Frage noch nicht das Entscheidende gewesen. Das Bürgertum hatte die Dinge in die Hand genommen, und ihm standen im Vordergrund die Errichtung des nationalen Staats und sein Aufbau auf einer die Regierungsgewalt beschränkenden Verfassung. Das waren die Hauptfragen, die in der Paulskirche gelöst werden sollten und vor die damit auch Radowitz gestellt wurde. An der Verfassung konnte er, seitdem er den grundsätzlichen Widerspruch gegen die Volksvertretung aufgegeben hatte, durchaus positiv mitwirken. Es kam ihm darauf an, daß der ihm so verhaßte Gedanke der Volkssouveränität sich nicht auswirke. Zu diesem Zweck suchte er ein möglichst hohes Maß von Rechten für die Regierungen als Mitglieder des neuen Bundes durchzusetzen und vor allem die Verfassung nicht durch einseitigen Beschluß der Nationalversammlung, sondern durch eine Übereinkunft mit den Ländern zustande kommen zu lassen. Denn haltbar, so legte er dar, könne das neue Recht nur sein, wenn es aus freier Vereinbarung erwüchse. In folgerichtiger Anwendung dieses Gedankens hat er in Frankfurt davor gewarnt, ohne die Regierungen vorzugehen, und in Berlin von der Oktroyierung der preußischen Verfassung abgeraten. Jedoch an beiden Orten lief die Entwicklung in einer seinen Wünschen widersprechenden Richtung. In Preußen wurde die Verfassung durch das Ministerium Brandenburg kraft königlicher Gewalt erlassen, und daß auch in der Paulskirche Radowitz' Standpunkt sich nicht durchsetzen würde, konnte als entschieden gelten, seitdem auf Heinrich von Gagerns Antrag aus eigener Machtvollkommenheit des Parlaments die Berufung des Erzherzogs Johann zum Reichsverweser erfolgt war. In voller Deutlichkeit klaffte der Gegensatz auf, den Radowitz hatte überbrücken wollen. Auch in der Frage der äußeren Gestalt des zu errichtenden nationalen Staates ist das Ergebnis sehr anders gewesen als Radowitz' Wunsch. Zäh hielt er zunächst weiter an Österreich fest. Als aber geklärt war, daß die Paulskirche sich nicht mit der bloßen Verbesserung des bisherigen Bundes begnügen werde, sondern daß ein wirklicher Bundesstaat das Ziel war, da erkannte er, daß in diesem die gemeinsame Leitung durch die beiden Großmächte sich nicht mehr beibehalten ließ, und es war nur der Rückgriff auf die schon früher gewonnene Einsicht, wenn er sich nunmehr für die kleindeutsche Lösung entschied. Daß nur Preußen Träger der eigentlichen nationalen Entwicklung sein konnte, war ihm ja längst klar. Aber deshalb auf Österreich einfach zu verzichten, lag ihm fern. Durch ein verwickeltes Schema hoffte er doch um die stark empfundene Tragik der Trennung herumzukommen und Österreichs Kraft Deutschland zu erhalten. Dem engeren Bundesstaat [366] unter Preußens Führung sollte ein Reich deutscher Nation angegliedert werden, innerhalb dessen auch Schleswig, Posen und Deutschösterreich ihren Platz fänden, und ihm sollte sich schließlich ein völkerrechtlicher Verein mit dem österreichischen Gesamtstaat angliedern. Jede dieser drei Gruppen sollte durch ihr besonderes Direktorium geleitet werden. Daß sich für diesen schwerfälligen Plan in der Nationalversammlung gegenüber dem einfacheren Gagernschen Gedanken des engeren Bundesstaates unter Preußen und des weiteren Bundes mit Österreich keine Anhänger fanden, ist begreiflich; Radowitz selbst hat ihn schließlich fallen gelassen. Aber auch die Lösung Gagerns wurde zunichte, als Österreich nach der Bezwingung der Revolution im eigenen Hause durch Fürst Felix Schwarzenberg wieder den Anspruch auf Leitung des deutschen Staates erhob, indem es den Eintritt aller seiner Länder forderte. Das hat wie für viele Großdeutsche auch für Radowitz den Ausschlag gegeben, sich nun mit aller Entschiedenheit für die uneingeschränkte kleindeutsche Lösung als die bei der neuen Sachlage einzig mögliche Form des nationalen Staats einzusetzen. Allerdings führte es ihn zur Trennung von seinen katholischen Freunden, die sich nicht mit ihm zu der Ansicht bekennen wollten, daß die preußische Führung des deutschen Staates mit den katholischen Interessen vereinbar sei. Aber Radowitz hat sich dadurch nicht irremachen lassen, er stimmte dem preußischen Erbkaisertum zu. Das Ende der Nationalversammlung findet ihn also weit ab von seiner anfänglichen Stellungnahme. Es ist durchaus richtig, wenn Radowitz von sich selbst geschrieben hat, daß er aus der Paulskirche herausgekommen sei "schroffer gegen seine alten Freunde und sanfter gegen seine alten Feinde". Schwere Gewissenskämpfe waren es gewesen, in denen er sich zu solchem Frontwechsel durchgerungen hatte. Um so härter traf es ihn, sich in diesem entscheidenden Augenblick in anderem Lager zu finden als seinen königlichen Freund: Die Ablehnung der Kaiserkrone durch Friedrich Wilhelm zerstörte das Werk der Paulskirche, dem Radowitz zugestimmt hatte. Aber wenn darin auch eine tiefgehende Meinungsverschiedenheit sich äußerte, so dachte der König doch nicht daran, sich von dem Manne zu trennen, mit dem er so eng zusammengearbeitet hatte. Im Gegenteil, auf die Übereinstimmung in den Grundansichten vertrauend, berief er Radowitz als seinen Berater nach Berlin, als er gleichzeitig mit der Ablehnung seinen Versuch einleitete, von oben her, ohne die Volksvertretung, durch Vereinbarung mit den Regierungen die deutsche Frage zu lösen. Er bot ihm das Außenministerium; aber Radowitz lehnte es ab aus Besorgnis, das Mißtrauen, das ungeschwächt gegen ihn bestand, könnte der Sache schaden, und begnügte sich mit der unverantwortlichen Stellung des Ratgebers für die deutsche Politik. Dennoch ist er es gewesen, der dem preußischen Vorstoß den Stempel aufgedrückt hat. Denn wenn er auch jetzt erst recht auf Friedrich Wilhelm Rücksicht zu nehmen hatte, so darf man doch die Fehler, die zur Katastrophe hingeführt haben, nicht [367] bloß dem König zur Last legen. Obwohl Radowitz manche Einzelhandlungen mißbilligte, stimmte er mit der Grundrichtung überein. Richtig ist allerdings, daß er von Anfang an wegen der Eigenart des Herrschers schwere Gefahren vorhersah und sich trotzdem aus persönlicher Treue verpflichtet fühlte, die eigene Überzeugung zu opfern, wenn er mit ihr nicht durchdrang. Darum ging er auch mit dem Gefühl sicheren Mißerfolgs an seine Aufgabe. "Ich selbst habe das Gefühl eines Soldaten, der in die Schlacht geht mit der Gewißheit, geschlagen zu werden." Das war nicht die Stimmung, um aus schwerer politischer Krise den Sieg heimzutragen, und dieser Stimmung ist er nicht mehr Herr geworden. Als Heimsuchung Gottes empfand er die ihm zugewiesene Rolle, seine intimen Äußerungen zeigen die Stärke seines Wunsches, aus der Politik auszuscheiden, wie er es auch mehrfach amtlich dem König angeboten hat. Beiden gemeinsam war der Wunsch, den neuen deutschen Staat nicht in Widerspruch zu Österreich geraten zu lassen. Nach dem Scheitern des kleindeutschen Werkes der Paulskirche knüpften sie wieder an ihren vormärzlichen Versuch an, durch direkte Verständigung mit dem Kaiserstaat weiter zu kommen. Der Gedanke, durch den neuen Vorstoß etwa Österreich gewaltsam auszuschließen, lag auch Radowitz so fern, daß er für die "Union", die er anstrebte, nicht nur dessen [368] Mitgliedschaft für unentbehrlich hielt, sondern ihm den Vorsitz, sogar in der Form der Kaiserwürde überlassen wollte. Erst als Schwarzenberg unmißverständlich zu erkennen gab, daß er nicht daran dachte, Preußen materielle Gleichberechtigung zuzugestehen, ist Radowitz wieder auf den kleindeutschen Boden getreten, aber auch jetzt noch die Hoffnung festhaltend, daß Österreich vor der vollendeten Tatsache des Bundesstaates unter preußischer Führung sich zu einer Lösung in der Art des Gagernschen Planes bereit finden werde. In diesem Sinne hat er die neue Unionspolitik eingeleitet, jetzt ohne Österreich, und hat mit Hannover und Sachsen das Dreikönigsbündnis als Kern der deutschen Einheit geschlossen.
Im allerletzten Stadium, in dem Radowitz schließlich mit dem Außenministerium auch formell die Verantwortung übernahm, hat er, der sein Leben lang hartnäckig um die Erhaltung Österreichs für Deutschland gerungen hatte, bei der Zuspitzung der Lage kein anderes Mittel mehr gesehen, als um der Ehre Preußens willen vor dem Appell an die Waffen nicht zurückzuschrecken. Auch hier also das Endergebnis in krassem Widerspruch zu seinen eigentlichen Wünschen. Weil dem aber so ist, weil der Versuch gewaltsamer Verdrängung Österreichs sich ihm nur zwangsläufig aus der Entwicklung ergab und nicht sein Ziel darstellte, deshalb [369] darf Radowitz auch nicht als Vorläufer für Bismarcks Lösung der deutschen Frage bezeichnet werden. Ganz gegen seinen Willen war er in diese Richtung hineingedrängt worden, während Bismarck sie eingeschlagen hat, nachdem er sie mit unendlicher Vorsicht, Geduld und Geschicklichkeit gründlich vorbereitet hatte. Die Wiederanknüpfung an Geist und Methoden der Politik Friedrichs des Großen, die den Weg des Reichsgründers bestimmt hat, lag Radowitz fern. Aber vor die letzte Kraftprobe ist Radowitz nicht erst gestellt worden, denn als schließlich auch Zar Nikolaus von Rußland sich gegen seine Politik wendete, weil sie ihm ebenso wie den preußischen Konservativen revolutionär erschien – eine besondere Tragik für den grundsätzlichen Bekämpfer der Revolution, der Radowitz sein Leben lang gewesen ist –, ließ Friedrich Wilhelm ihn fallen. Nach Radowitz' Ausscheiden am 2. November 1850 hat der Olmützer Vertrag mit der Wiederherstellung des Bundestages diesen Versuch beendet, Preußen an die Spitze Deutschlands zu stellen. Der Grund des Scheiterns lag in der unrichtigen Einschätzung des Kräfteverhältnisses sowie in der Unfähigkeit, die eigenen Mittel restlos zu erfassen und entschlossen einzusetzen. Das menschliche Band zwischen Herrscher und Berater ist auch jetzt nicht zerrissen. Friedrich Wilhelm entsandte Radowitz nach London, um ihn aus der Schußlinie der Kritik zu entfernen, und allen Ernstes hat dieser sich der Hoffnung hingegeben, daß England jetzt, nachdem sein großer Gegner Rußland sich wider Preußen gewendet hatte, für ein Bündnis zu haben sein werde. Er hätte sich sagen müssen, daß das gedemütigte Preußen erst recht keine Anziehungskraft auf die kühl rechnenden britischen Staatsmänner ausüben konnte. Nach der Heimkehr von der völlig ergebnislosen Sendung hat Radowitz bis zu seinem Tode am 25. Dezember 1853 ins politische Treiben nicht wieder zurückgefunden. So kennzeichnet das Ende seiner außenpolitischen Tätigkeit eine Utopie, kaum geringer als die von 1840, mit der er sie begonnen hatte, und damit schließt sich der Kreis. "Halb im Traum, halb im Tageslicht", so ist Radowitz' Wirken richtig charakterisiert worden. Heiß und ehrlich hat er darum gerungen, aus dem Traum herauszukommen ins Tageslicht, die Welt der Wirklichkeit nicht zu behandeln nach den Maßstäben der Ideale. Abstrakte Prinzipien hat er das Grab jeder wahren Politik genannt. Aber er hat sich von ihrem Zwange nicht freimachen können und ist deswegen nicht fähig gewesen zu der vorwärtsführenden Tat.
 |