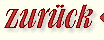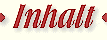|
 In der Weimarer Zeit In der Weimarer Zeit wurde für uns die politische Justiz zum ersten Mal in Deutschland ein innerstaatliches Problem. Es erschien uns als eine Seite des Parteienwesens, die wir als Entartung empfanden. Der Streit zwischen den Parteien von links und rechts wurde in Prozessen ausgetragen, die die Massen erregten. Das nahm Formen an, wie wir sie in Deutschland bis dahin in diesem Maße nicht gekannt hatten, die aber in Frankreich, dem Lande des Dreyfusprozesses, schon früher sich gezeigt hatten. Es war nicht nur der Staat, der die Politik in die Rechtssphäre hineintrug. Auch Einzelpersonen, Politiker und weltanschauliche Gruppen von rechts und links griffen zu politischen Prozessen als Kampfmitteln, durch die sie ihre Ziele verwirklichen wollten. Wir haben selten in Deutschland eine solche Flut von politischen Prozessen erlebt wie in den Jahren nach 1924. Männer wie Ebert, Helfferich u. a. wurden dadurch in das Rampenlicht der Öffentlichkeit gezerrt. Diese Entwicklung wurde durch das Pressewesen begünstigt. Die politischen Prozesse behandelten Vorgänge, die die Presse gern weiterverbreitete. Es gab Beleidigungsprozesse und Korruptionsprozesse ohne Ende. Die Politisierung der Prozesse ging teils von den Klägern, teils aber auch von den Beklagten aus. Der Wahrheitsbeweis als Verteidigungsmittel bei Beleidigungsprozessen gab für den Beklagten die Möglichkeit, zum Angriff überzugehen und seinen politischen Gegner in der öffentlichen Meinung herabzusetzen. Man stellte aufsehenerregende Beweisanträge auf Vernehmung prominenter Personen, die von der Presse groß dargestellt wurden. So wurden diese Prozesse nicht nur durch die Prozeßparteien, sondern oft auch durch die Zeugen, die darin vorgeladen wurden, zu politischen Sensationen. Zu den politischen Beleidigungsprozessen, die im Rheinland besondere Beachtung fanden, gehören die Separatistenprozesse, die nach der Rheinlandräumung im innerpolitischen Kampf ein beliebtes Mittel wurden, Parteigegner zu bekämpfen. Der bedeutendste dieser Prozesse war der Limbourgprozeß in Köln.24 Die Gebrüder Limbourg, Gutsbesitzer aus Bitburg, deren Verhalten in der Separatistenzeit beanstandet worden war, hatten den verantwortlichen Redakteur des Kölner Stadtanzeigers wegen Beleidigung verklagt, weil dieser sie als Separatisten bezeichnet hatte. In dem Prozeß, in dem das zeitgeschichtliche Problem des Separatismus gründlich erörtert wurde, unternahmen die Kläger den Versuch, auch die Frage des sogenannten "legalen Separatismus" zu erörtern, d. h. Bestrebungen deutscher Politiker in den Jahren der deutschen Not 1919 und 1923, die damals umstrittene Rheinlandfrage, einer Lösung entgegenzuführen. Überaus eindrucksvoll war, daß in diesem Prozeß der Duisburger Oberbürgermeister Dr. Jarres als Zeuge vor seine politischen Gegner trat und den klaren Trennungsstrich zwischen Landesverrat und den Bestrebungen verantwortungsbewußter Politiker zog. So bekam der Prozeß wegen dieser grundsätzlichen Erörterung eine zeitgeschichtliche Bedeutung. Es war ein reinigendes Gewitter. Nicht zu billigen aber war, daß sich dann unzählige Prozesse gleicher Art daran anschlossen. Das Wort "Separatist" wurde zu einem Schimpfwort für alles, was nationale Unzuverlässigkeit sein sollte. Jede Stadt und jedes Städtchen wollte ihren eigenen Separatistenprozeß haben. Mit der Einrichtung von Sonderdezernaten der Staatsanwaltschaft machte ich in der Weimarer Zeit zum ersten Mal nach dem Erzbergermord Bekanntschaft. Es war richtig, daß der Staat bei diesem von allen Gutgesinnten verurteilten Mord die Verfolgung der Täter und ihrer Hintermänner mit dem Aufgebot aller zur Verfügung stehenden Mittel betrieb. Bedenklich aber war, daß im Anschluß daran eine Unsumme von sogenannten kleinen Erzbergerprozessen aufgezogen wurde, die mit der Mordsache nichts mehr zu tun hatten. Dafür wurde ein Sonderdezernat der Staatsanwaltschaft eingerichtet, die eine große Zahl längst abgeschlossener Fälle von Geheimbündelei wieder aufgriff. Wochenlang wurden Angehörige von Rechtsverbänden, die in der Zeit des Kapp-Putsches eine Rolle gespielt hatten, in Untersuchungshaft gehalten, darunter Männer, die längst den Weg zu friedlicher Arbeit gefunden hatten. Es kam zu keinen nennenswerten konkreten Anklagen, und die meisten der Inhaftierten wurden nach einigen Wochen der Haft sang- und klanglos wieder entlassen. Viele Beschuldigte sind damals verhaftet worden, und die Akten umfaßten zahlreiche Bände. Im Zusammenhang mit dem Rathenaumord aber wurden noch mehr Strafverfahren durchgeführt. Von den Prozessen, in denen in der Weimarer Verfassung die Politisierung der Justiz besonders hervortrat, sind außer den politischen Beleidigungsprozessen einige Prozesse, die auf Grund des Republikschutzgesetzes angestrengt wurden, und die sogenannten Femeprozesse zu erwähnen. Nicht alle Prozesse auf Grund des Republikschutzgesetzes waren ohne weiteres zu verurteilen. Jeder Staat hat das Recht und die Pflicht, seine Verfassung und seinen Bestand gegen Angriffe von innen und außen zu schützen und zu diesem Zweck Gesetze zu erlassen, die umstürzlerische Bestrebungen mit Strafe bedrohen. Es muß sich aber immer um bestimmte Tatbestände handeln, die nach dem Rechtsempfinden aller rechtlich Denkenden als wirkliches Unrecht angesehen werden. Diese Gesetze dürfen jedoch nicht dazu benutzt werden, die Meinungsfreiheit zu beschränken und politische Gegner mundtot zu machen. Zu dem Republikschutzgesetz hatte der Reichsjustizminister Dr. Bell erklärt, daß dadurch keine Meinung, keine Weltanschauung und keine Pflege der Tradition unterdrückt werden sollte. In Wirklichkeit kam es aber doch zu Prozessen, die mit diesen Erklärungen nicht in Einklang zu bringen waren, dem Ansehen der Rechtspflege schaden mußten, die Richter und Staatsanwälte in eine unmögliche Lage brachten und auch bei den loyalsten Staatsbürgern Bedenken erregten, ob diese Justiz noch mit rechtsstaatlichem Denken vereinbar sei. Ein Prozeß dieser Art war der Prozeß gegen den früheren konservativen Reichstagsabgeordneten Dr. Wildgrube, der ein persönlicher Freund des letzten Kaisers, ein bedeutender Historiker und ein hervorragender Vortragsredner war. Er hatte auf Einladung des DOB (Deutscher Offiziersbund) in Kassel vor einem auserlesenen Kreis von Offizieren des ersten Weltkrieges einen wissenschaftlichen Vortrag über die Weimarer und Bismarcksche Verfassung gehalten, in dem er in sachlicher Form die Weimarer Verfassung kritisierte und der Bismarckschen Verfassung den Vorzug gab. Der Vortrag war in der Zeitschrift des DOB im vollen Wortlaut abgedruckt worden. Darin hatte sich Wildgrube leidenschaftlich für den Föderalismus des Bismarckreiches eingesetzt. Ich war mit der Tendenz des Vortrages nicht einverstanden, weil ich der Meinung bin, daß man Unitarist, aber nicht Zentralist sein sollte, der Föderalismus aber nicht die einzige Form ist, die Gefahren des Zentralismus zu bannen. Ich sehe in der preußischen Selbstverwaltung nach dem Muster der Stein-Hardenbergischen Verfassung die Form des Grundgesetzes, die wir für Deutschland erstreben sollten. Aber diese Meinungsverschiedenheiten hinderten mich nicht, die Art, wie Wildgrube seine Gedanken vortrug, zu bewundern. Eine Kasseler Zeitung verlangte ein Einschreiten nach dem Republikschutzgesetz. Die Staatsanwaltschaft Kassel lehnte dies mit der Begründung ab, daß das Republikschutzgesetz durch diesen wissenschaftlichen Vortrag nicht verletzt sei. Das Justizministerium aber wies die Staatsanwaltschaft an, Anklage zu erheben. Das Amtsgericht Kassel lehnte die Eröffnung des Hauptverfahrens ab. Die Staatsanwaltschaft mußte Beschwerde beim Landgericht einlegen. Das Landgericht beschloß die Eröffnung des Hauptverfahrens vor dem Amtsgericht. In der Verhandlung vor dem Amtsgericht, das als erweitertes Schöffengericht mit Laienrichtern fungierte, wurde Dr. Wildgrube zu einem Monat Gefängnis und einer hohen Geldstrafe verurteilt. Die Schöffen gehörten überwiegend den politischen Kreisen an, die in dem Angeklagten und dem Deutschen Offiziersbund ihre Gegner sahen, und hatten offenbar den Richter überstimmt. Wir legten Berufung an das Landgericht ein. Die Verhandlung vor dem Landgericht gestaltete sich zu einem eindrucksvollen Ereignis. Der große Saal des Schwurgerichts in Kassel war mit lauter Persönlichkeiten besetzt, denen man ansah, daß sie aus dem Kreis des DOB stammten. Sie saßen dort schweigend. Der Angeklagte aber hatte den Zuhörerkreis, vor dem er den inkriminierten Vortrag gehalten hatte. Auch die Pressebank war dicht besetzt. Es waren hauptsächlich Vertreter aus der gegnerischen Presse. Ich stellte den Antrag, daß der Angeklagte seinen Vortrag noch einmal als Ganzes vorlesen solle. Der Vortrag war ja gedruckt. Dem Antrag wurde stattgegeben. Der Angeklagte las; er wirkte überzeugend. Dasselbe Gericht, das die Eröffnung des Hauptverfahrens angeordnet hatte, sprach den Angeklagten frei, während die erste Instanz, die die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt hatte, den Angeklagten verurteilt hatte. Das Reichsgericht bestätigte den Freispruch. So hatte sich also wieder einmal das Recht schließlich doch durchgesetzt. Die Unabhängigkeit der Richter war intakt. Wie groß aber war der Wirrwarr, der durch diese Zustände in der Rechtspflege angerichtet wurde? Der Staatsanwalt, der die Anklage gegen Dr. Wildgrube vertreten mußte, hatte nach 1933 Schwierigkeiten. Ich bin für ihn eingetreten, weil er offensichtlich auf höhere Weisung gehandelt hatte. Wohin führt aber die politische Justiz, wenn sich Staatsanwälte und Richter und vielleicht auch noch die Verteidiger bei jedem Regimewechsel wegen ihrer Haltung im vorangegangenen Regime zu verantworten haben? Bei der Mehrzahl der politischen Prozesse jener Zeit hatte ich mit der politischen Abteilung des Preußischen Justizministeriums zu tun. Ich konnte mich über die Art, wie die einzelnen Sachen dort behandelt wurden, nicht beklagen. Die Erörterungen waren immer sachlich, korrekt und loyal, die Rechtsanwälte wurden gehört; und dennoch habe ich diese Abteilung des Ministeriums, die an Bedeutung mehr und mehr zunahm und einen immer größeren Einfluß auf die politische Justiz erlangte, stets wie eine Art "Sonderdezernat" empfunden, durch das die politischen Instanzen in Preußen bemüht waren, auf ihrem Gebiet die Rechtspflege sich politisch nutzbar zu machen. Das trat in besonders bedenklicher Form in den sogenannten Femeprozessen25 hervor, die in der damaligen Zeit mehrere Jahre hindurch die Bevölkerung in Deutschland in gefährlicher Weise beunruhigt haben und schließlich zu einer wahren Justizkrise in Preußen führten. Der Tatbestand war der, daß in den Jahren 1920 und 1923, d. h. in den Bürgerkriegswirren nach dem Kapp-Putsch und im Ruhrkonflikt, innerhalb der Freikorps, die man später die Schwarze Reichswehr nannte, einige Verrätertötungen - insgesamt 6 Fälle im Ruhrkampf und einige wenige im Jahre 1920 - vorgekommen waren, deren Rechtmäßigkeit nicht festzustellen war, weil die Schwarze Reichswehr als eine gegen den Versailler Vertrag verstoßende Einrichtung kein Recht auf Militärjustiz hatte. Diese zweifellos bedauerlichen Vorgänge aus der Bürgerkriegszeit wurden von den in Preußen damals herrschenden Parteien dazu benutzt, große politische Mordprozesse aufzuziehen, die letzten Endes gegen die Reichswehr und die hinter ihr stehenden Kreise gerichtet waren. Ich bin als Verteidiger in diese Prozesse berufen worden, weil diese Vorgänge mit dem Ruhrkampf zusammenhingen. Die Femeprozesse sollten, das war jedenfalls der Eindruck, der im Volk erweckt wurde, eine Antwort auf die Korruptionsprozesse Barmat, Sklarek, Kutisker usw. sein, durch die politische Führer von links kompromittiert worden waren. So wurden die Korruptionsprozesse auf der einen und die Femeprozesse auf der anderen Seite zu einem Kampffeld, auf dem der innerpolitische Streit zwischen den Parteien von rechts und links ausgetragen wurde. "Korruption" war das Stichwort der Rechtskreise, "Fememorde", so lautete das Gegenstichwort der Linken. Die Justiz war zwischen die Streitteile von links und rechts gestellt und die Rechtspflege mußte unter diesem Interessengegensatz leiden. Dieser Kampf wurde auf beiden Seiten mit Leidenschaft und Erbitterung geführt. Sonderdezernate wurden beim Polizeipräsidium in Berlin und bei der Staatsanwaltschaft in Moabit eingerichtet. Die Propaganda nahm Formen an, die nicht mehr zu rechtfertigen waren. In die weitesten Kreise drang das Schlagwort von den Fememorden hauptsächlich durch ein Bild, das in einer in Deutschland viel gelesenen illustrierten Zeitung erschien und angeblich eine geheime Sitzung der Feme darstellte. Hinter einem runden Tisch standen drei vermummte Gestalten, die Kapuzen und weiße Kittel trugen. Vor dem Tisch stand der unglückliche Angeklagte mit verbundenen Augen. Auf dem Tisch lag eine Hakenkreuzfahne und stand ein Kruzifix. Im Text hieß es, daß es eine Feme gäbe, welche nach der Art der Ku-Klux-Klan, einer Geheimorganisation, die in den Südstaaten der USA im Zusammenhang mit den Bürgerkriegen eine Rolle gespielt hatte, Tötungen beschließe. Man habe die authentische Fotografie einer Geheimsitzung dieser Feme aufgefunden, die damit der Öffentlichkeit übergeben werde. Das Ganze war entsprechend aufgemacht, um in den Massen zugleich Gruseln und Empörung hervorzurufen. Man trieb also Greuelpropaganda, übertrug damit Kampfmethoden, wie wir sie im Kriege kennengelernt hatten, auf die innerpolitische Auseinandersetzung in Deutschland; und es war die Regierung in Preußen, die zu solchen Mitteln griff! Diese Greuelpropaganda nahm bedenkliche Formen an. Ich entsinne mich z. B. noch eines amtlichen Polizeiberichts, der damals durch die gesamte Presse verbreitet wurde. Darin hieß es, man habe einen Reichswehrsoldaten namens Fromazain verhaftet. Dieser habe in seinem Quartier krank gelegen und in Fieberphantasien dauernd von Leichenhaufen geredet, die in Kloaken geworfen worden seien. Der Mann hätte einen Hund namens Nixe, den er täglich mit Menschenfleisch füttere. Eine wahre Mord- und Verfolgungspsychose wurde erzeugt. Ständig berichtete die Presse von Leichenfunden. Die sechs Verrätertötungen aus der Ruhrkampfzeit (Gröschke, Wilms, Legner, Pannier, Brauer und Sand) wurden durch immer wieder erneute Polizeiaktionen und Pressekampagnen aufgebauscht. Wegen ein und derselben Tötung, z. B. im Fall Gröschke oder Wilms, wurden Dutzende von Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten der Schwarzen Reichswehr wegen Mittäterschaft, Beihilfe oder Begünstigung festgenommen, wobei dann jede Festnahme wieder als besonderer Fall hingestellt und zu einer neuen Pressekampagne und zu neuen Prozessen verwandt wurde. Das Volk erkannte, daß es sich bei all diesen Strafverfolgungen um eine großangelegte politische Aktion handelte und mißbilligte diese Form politischer Justiz. Die Greuelpsychose nahm solche Formen an, daß auch falsche Selbstbezichtigungen vorkamen. So beschuldigte sich ein ehemaliger Leutnant der Schwarzen Reichswehr namens Thom, daß er Gröschke ermordet habe. Das Tragische war, daß er noch etwa ein Dutzend Kameraden, Offiziere und Soldaten, in die Angelegenheit mit hineinzog, so daß diese Leute monatelang in Untersuchungshaft saßen. Als endlich der wirkliche Täter, Fahlbusch, aus Amerika herübergeholt wurde, klärte er den Fall sofort auf. Er hatte den Gröschke getötet, und zwar ganz allein. Alle anderen waren unschuldig verfolgt worden. Thom aber erklärte auf Befragen, wie er denn zu diesem falschen Geständnis gekommen sei, er sei von einem bösen Geist besessen gewesen. Was aber das Femebild der illustrierten Zeitung anbelangt, so wurde schließlich bekannt, daß es ein künstlich gestelltes Bild des Sonderdezernates der Berliner Polizei war. Man ermittelte die vier Polizeibeamten, die da als vermummte Femerichter und Angeklagte fotografiert waren, und die Presse veröffentlichte ihre Namen. Das Femebild, das so viel Erregung im deutschen Volke erzeugt hatte, war also eine Fälschung, und sogar eine amtliche Fälschung! In Wirklichkeit hatte es eine Feme niemals gegeben. Die Fememorde waren damit als Propagandaerfindung entlarvt, wie es im ersten Kriege die Legende von den abgehackten Kinderhänden gewesen war. Daraus erwuchs dann ein innerpolitischer Kampf, bei dem Übertreibungen auf beiden Seiten vorkamen und keinerlei Rücksicht auf außenpolitische Schädigung und Gefährdung genommen wurde. Das Bedauerlichste aber war die innerpolitische Verhetzung, die das deutsche Volk in zwei Teile zerriß. So erreichte die Politisierung der Justiz nach 1924 durch die Femeprozesse in Deutschland ihren ersten krisenhaften Höhepunkt. Sie zeigte schon alle Merkmale der Entartung der politischen Prozesse, wie sie nicht sein sollen: Mißbrauch der Rechtspflege zu politischen Zwecken durch eine falsche Handhabung des Legalitätsprinzips, Lenkung durch Sonderdezernate der Polizei- und Staatsanwaltschaften auf Weisung der obersten politischen Stellen, und eine weit über das zulässige Maß hinausgehende Propaganda. Der Schaden, der dadurch in der Rechtspflege angerichtet wurde, und den der Reichsjustizminister Dr. Bell damals selbst als Vertrauenskrise der Justiz bezeichnete, wird aber erst dann völlig klar, wenn man die sogenannten Femeprozesse im Rahmen der Gesamtliquidation der blutigen Kriegs- und Nachkriegskämpfe betrachtet. Der erste Weltkrieg war in Deutschland durch eine Generalamnestie für alle mit dem Krieg zusammenhängenden Straftaten abgeschlossen worden. Es war das Verdienst der Volksregierung unter Ebert, daß sie bereits am 12. November 1918, am Tage nach dem Waffenstillstand, durch Notverordnung eine Generalamnestie für alle mit dem Kriege zusammenhängenden Verbrechen, einschließlich der Morde und aller Gewalttaten, erließ (RGBl. 1918 S. 1303). Interne Kriegsverbrecherprozesse, wie sie nach 1945 das deutsche Volk so sehr beunruhigt haben und noch heute beunruhigen, hat es daher nach dem ersten Weltkriege in Deutschland nicht gegeben. Dagegen war die Reichsregierung durch die Siegermächte gezwungen worden, am 18. Dezember 1919 ein Gesetz über die Verfolgung von Kriegsverbrechen und -vergehen zu erlassen, in dem das Reichsgericht als erste und letzte Instanz für diese Verbrechen für zuständig erklärt wurde. Die Alliierten haben damals eine Liste von 1800 Kriegsverbrechern aufgestellt. Davon hat das Reichsgericht ganze sechs für schuldig befunden. Auf diese Tatsachen hat der Bundestagsabgeordnete Merten der SPD in der Kriegsverbrecherdebatte vom 17. September 1952 vor dem Bundestag in Bonn hingewiesen (Bundestagsdebatten 1952 S. 10.500). Die äußere Generalamnestie für Krieg und Nachkriegswirren wurde erst durch das Londoner Abkommen vom 1. September 1924 erreicht. Man hat es dann aber versäumt, in Deutschland auch eine alles umfassende Abschlußamnestie für die inneren Nachkriegswirren zu erlassen. Zwar hatte Severing, der als preußischer Innenminister mit Hilfe der Freikorps nach dem Kapp-Putsch im März 1920 den Rotgardistenaufstand im Ruhrgebiet niederschlug, den Angehörigen der damaligen Roten Armee durch das Bielefelder Abkommen eine Generalamnestie versprochen. Die verhafteten Rotgardisten, auch solche, die wegen Mordes angeklagt waren, wurden darauf sämtlich freigelassen und die Verfahren eingestellt. Aber das Reichsgesetz vom 4. August 1920, das dann zur Durchführung des Bielefelder Abkommens erlassen wurde, nahm die vorsätzlichen Tötungs- und Gewaltverbrechen von der Amnestie ausdrücklich aus. Über den Umfang der Gewalttaten auf seiten der Roten Armee im Ruhrgebiet geben am besten die Bücher von Severing: Im Wetter- und Watterwinkel (Bielefeld 1927) und von Spethmann Zwölf Jahre Ruhrbergbau (Berlin 1928) Auskunft. Severing schätzt die Zahl der damals von den Angehörigen der Roten Armee getöteten Personen auf etwa 1000, denen nur ganz wenige Tötungen durch Angehörige der Freikorps gegenüberstehen. Es war nun nach dem Bielefelder Abkommen ganz unmöglich, alle diese Tötungen in nachträglichen Strafprozessen zu verfolgen. Das Preußische Justizministerium erließ deshalb unmittelbar nach Abschluß des Bielefelder Abkommens am 19. April 1930 (JMI 4929) folgende Verfügung: "Der Herr Reichsjustizminister hat in der Sitzung der Nationalversammlung vom 14. dieses Monats folgende Ausführungen über die Verfolgbarkeit von Personen gemacht, die in Abwehr des verbrecherischen Kapp-Putsches ihrer besseren Überzeugung nach ihre Pflicht dem Volke gegenüber und zur Verteidigung der Verfassung zu tun glaubten: 'Auch insoweit wird bei verständiger Prüfung meiner Überzeugung nach in der Regel anzunehmen sein, daß der subjektive Tatbestand, d. h. das Bewußtsein von der Rechtswidrigkeit des Verhaltens, keineswegs vorliegt, selbst wenn man den objektiven Tatbestand einer strafbaren Handlung feststellen könnte.' Das kommt natürlich ganz besonders auch für diejenigen Leute im Ruhrgebiet in Frage, die dort lediglich deshalb zu den Waffen gegriffen haben, weil sie der wirklichen oder vermeintlichen Überzeugung waren, gegen Kappsche Truppen zur Unterstützung der Regierung und für die Verteidigung der Demokratie zu kämpfen." Das war eine allgemeine Anweisung an die Staatsanwaltschaften zur Ausübung des Ermessens bei Würdigung des subjektiven Tatbestandes. Man billigte den Rotgardisten putative Staatsnotwehr zu. Man erließ aber keine entsprechende Anweisung zugunsten der Freikorpskämpfer, die der Staat damals zur Rettung der Republik herbeigerufen hatte. Auf dieser ungleichen Ausübung des Ermessens durch die obersten Strafverfolgungsbehörden beruhen letzten Endes die Fememordprozesse, die dann als politische Prozesse in Preußen aufgezogen wurden. Diese Prozesse stellten die Gerichte vor schwierige Probleme. Das trat zum ersten Mal in dem Prozeß Linzemeyer vor dem Schwurgericht Bielefeld zutage. Linzemeyer war Gerichtsoffizier im Freikorps Roßbach gewesen und hatte die Baltikumkämpfe mitgemacht. In dem Durcheinander, das 1920 nach dem Kapp-Putsch entstand, hatte die Reichswehr, um die im Anschluß an den schnell gebrochenen Rechtsputsch von Kapp und Genossen entstandenen Linksputsche in Berlin, Sachsen, Mecklenburg und vor allem im Ruhrgebiet niederzuschlagen, die Freikorps mobilisiert, die als letzte Überbleibsel des alten Kriegsherees [sic] sofort verfügbar waren. In Mecklenburg hatte man das Freikorps Roßbach wieder aufgestellt, das die Bezeichnung "Reichswehrbrigade" bekam. Diese Truppe hatte unter der Herrschaft des Standrechtes, das damals ordnungsgemäß verhängt war, in Mecklenburg und in Essen je zwei Erschießungen vorgenommen, bei denen Linzemeyer als Gerichtsoffizier fungierte. Linzemeyer, der von Beruf Dekorationsmaler war und vom Gerichtswesen nichts verstand, hatte es verabsäumt, bei den standrechtlichen Verfahren das hierfür vorgesehene Protokoll aufzunehmen. Er wurde deshalb jetzt wegen Mordes angeklagt. Das Schwurgericht nahm aber nur fahrlässige Tötung an, weil Linzemeyer infolge seiner Unkenntnis der militärgerichtlichen Vorschriften es fahrlässig versäumt habe, das erforderliche Protokoll anzufertigen. Die fahrlässige Tötung aber fiel unter das Amnestiegesetz vom 4. August 1920. Linzemeyer wurde also freigesprochen. Das eigentliche Rechtsproblem war aber das der putativen Staatsnotwehr. Mußte man diese, die man den Rotgardisten zubilligte, nicht auch bei den Freikorpskämpfern, die doch für die Republik kämpften, anerkennen? Namhafte Rechtsgelehrte, wie Geheimrat Oetker, Geheimrat Krückmann u. a. traten in überzeugenden Rechtsgutachten für diese These ein. Wie schwierig die Lage war, in die die Gerichte durch diese Prozesse versetzt wurden, zeigte das Wilmsurteil des außerordentlichen Schwurgerichts Berlin vom 26. März 1927, wodurch der Oberleutnant Paul Schulz und mehrere andere Angehörige der Schwarzen Reichswehr auf Grund von Indizien wegen Tötung des vermeintlichen Verräters Wilms zum Tode verurteilt wurden. Schulz war der eigentliche Chef der Schwarzen Reichswehr und Verbindungsmann zu der offiziellen Reichswehr. Er wurde daher für die Tötungen, die in der Schwarzen Reichswehr vorgekommen waren, verantwortlich gemacht, bestritt aber bis zuletzt, einen Befehl zur Tötung von Verrätern gegeben und von der Reichswehr erhalten zu haben. In dem Urteil heißt es: "Andererseits ist aber zu berücksichtigen, daß sie die Tat nicht aus eigennützigen Gründen begangen haben, sondern weil sie in den verworrenen Zeiten der Ruhrbesetzung und der Inflation glaubten, eine gute Sache im vaterländischen Interesse und im - wenigstens stillschweigenden - Einverständnis mit der Reichswehr durchzuführen. Der gute Glaube kann jedenfalls diesen Angeklagten nicht abgesprochen werden." Hier wird zum ersten Mal von einem deutschen Gericht ein Rechtsproblem berührt, das auch die französischen und belgischen Gerichte nach dem ersten und zweiten Weltkrieg beschäftigt hat und im französischen Recht als Handeln aus Vaterlandsliebe, Patriotismus-Exzeß oder moralische höhere Gewalt - force majeure morale - behandelt wird. Gegen diese Entscheidung wandte sich der damalige Chef der Reichswehr, der Generaloberst von Seeckt, indem er erklärte, das Urteil werde vom Standpunkt einer höheren Gerechtigkeit aus den Angeklagten nicht gerecht. Ein auf diese Erklärung gestütztes Wiederaufnahmegesuch des Oberleutnants Paul Schulz wurde von dem Berliner Gericht durch Beschluß vom 9. Januar 1929 verworfen. In diesem Beschluß wird gesagt: "Die wahre Schwierigkeit liegt darin, daß die Gerichte nach dem Gesetz gezwungen sind, Vorgänge der Geschichte mit dem Maßstab von Gesetzesbestimmungen, welche für normale Zeiten bestimmt sind, zu bewerten... Generaloberst von Seeckt vertritt die Auffassung, im Jahre 1928 seien die Grundlagen zu einer gerechten Beurteilung, nämlich die genaue Kenntnis der Zusammenhänge und volle Inrechnungstellung der außergewöhnlichen Verhältnisse des Jahres 1923, nicht vorhanden und sie könnten im ordentlichen Strafverfahren auch unmöglich geschaffen werden. Deshalb müßten sich Fehlurteile ergeben. Den Angeklagten werde im höheren Sinne nicht ihr Recht. Richtig ist, und das meint auch wohl nur der Generaloberst von Seeckt, daß die außergewöhnlichen Verhältnisse des Jahres 1923 im ordentlichen Strafverfahren bei Berücksichtigung der Schuldfrage keine Berücksichtigung finden können. Er empfindet dies als einen Mangel, die Erkenntnisse als Fehlurteile vom Standpunkt höherer Gerechtigkeit. Das Problem ist hier von dem Generaloberst von Seeckt klar erkannt und im bestimmten Sinne gelöst. Diese Problemstellung deckt sich durchaus mit der Auffassung des unterzeichneten Gerichts. Zur Lösung des Problems kann das Gericht, wie bereits ausgeführt, keine Stellung nehmen." Hier ist die Schwierigkeit festgestellt, die sich für die Gerichte bei der politischen Justiz ergibt, die Unzulänglichkeit unserer normalen Gesetze für die Lösung des "Problems des Außerordentlichen", insbesondere für die Liquidation des Krieges und der Nachkriegswirren, die Notwendigkeit, im Wege der Gnade oder Amnestie einen Ausgleich zu schaffen und der "höheren Gerechtigkeit" zum Siege zu verhelfen. Das Reichsgericht hat schließlich durch Urteil vom 8. Mai 1929 (RGSt. 63, 215 ff.) bei den Prozessen der Schwarzen Reichswehr grundsätzlich die Möglichkeit der Annahme von putativer Staatsnotwehr bejaht,26 und das Schwurgericht Schwerin zog dann aus diesem Urteil die praktische Konsequenz, indem es im Falle des Leutnants Eckermann das Vorliegen putativer Staatsnotwehr auch in tatsächlicher Hinsicht annahm und Eckermann freisprach. Dieses Urteil rief einen Sturm der Entrüstung bei den Gegnern hervor. Im mecklenburgischen Landtag wurde die Absetzung und Bestrafung der Richter verlangt. Der Wirrwarr, der aus den Femeprozessen entstand, wurde immer größer. Die Justizkrise in Preußen nahm gefährliche Ausmaße an. Da entschlossen sich verantwortungsbewußte Kreise aus allen Lagern des Rheinlandes, aus Anlaß der Rheinlandräumung die Reichsregierung und den Reichstag um eine Generalamnestie zu bitten, die auch unter die Bürgerkriegskämpfe aus den Jahren 1920 und 1923, die mit dem Ruhrkampf zusammenhingen, einen letzten Schlußstrich ziehen sollte. In Essen bildete sich 1929 ein überparteilicher Ausschuß, dem führende Männer von den Deutschnationalen bis zu den Kommunisten, erste Persönlichkeiten der katholischen und protestantischen, aber auch der jüdischen Welt beitraten und der Reichsregierung eine Denkschrift einreichten, die das ganze Problem der Nachkriegsprozesse behandelte. Der Appell an die Reichsregierung und den Reichstag hatte Erfolg. Am 24. Oktober 1930 kam als verfassungsänderndes Gesetz mit mehr als Zweidrittelmehrheit im Reichstag das Gesetz über die Rheinlandamnestie zustande, das endlich die so lange erstrebte allgemeine Befriedung brachte, zugleich aber auch ein böses Kapitel politischer Justiz abschloß. Die Femeprozesse waren noch keine nationalsozialistischen Prozesse gewesen. Sie waren eine Auseinandersetzung zwischen der gesamten Linken und der gesamten Rechten. Im Mittelpunkt stand die Reichswehr, und zwar die reguläre Reichswehr unter von Seeckt und die Schwarze Reichswehr, die aus den Freikorps hervorgegangen war. Von den politischen Parteien interessierte sich für die Femeprozesse besonders die Deutschnationale Volkspartei. Dazukamen auch einige Führer der NSDAP. Es ist zwar richtig, daß später viele von den Freikorpsführern zur NSDAP stießen, es wäre aber falsch, die Femeprozesse selbst schon als eine Angelegenheit dieser Partei anzusehen.
Die letzten Jahre der Weimarer Zeit aber waren in starkem Maße von Prozessen
erfüllt, an denen Nationalsozialisten als Angeklagte beteiligt waren. Soweit es sich dabei
um Saalschlachten oder andere Verstöße gegen die Ruhe und Ordnung oder
ähnliche Gesetzesverletzungen handelte, war gegen diese Prozesse an sich nichts zu
sagen.
Die Fülle dieser Prozesse, die täglich die Spalten der Zeitungen füllten, und
die Art ihrer Durchführung rief jedoch starke Beunruhigung hervor. So wurden diese
Prozesse in ihrer Gesamtheit doch als eine politische Angelegenheit empfunden und mit
Unbehagen verfolgt. Ich habe keinen persönlichen Einblick in diese Prozesse genommen,
da ich an keinem dieser Prozesse, die jetzt wirkliche nationalsozialistische Prozesse waren,
beteiligt war. Ich kann diese Prozesse also nur nach der Presse beurteilen und weiß, wie
schwer es ist, Prozesse auf Grund von Presseberichten darzustellen. Es dürfte aber
zutreffend sein, daß viele der Prozesse, die dann die Nationalsozialisten nach 1933 gegen
politische Gegner durchführten, eine Revanche für die Prozesse waren, denen sie
selbst vor 1933, in der sogenannten Kampfzeit, ausgesetzt gewesen waren.
24Deutsche Juristenzeitung 1928, S. 276 ff.
...zurück...
25Handwörterbuch der deutschen
Rechtswissenschaft von Stier-Somlo, Bd. 7, 1931, unter "Femeprozesse". ...zurück...
26Grimm, Grundsätzliches zu den
Femeprozessen, München 1928. ...zurück...
|