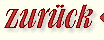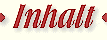|
 Politische Prozesse 1933 Die politischen Prozesse von 1933 waren also eine Vergeltung für das, was die neuen Machthaber in der Weimarer Zeit an ähnlichen Prozessen erlebt hatten, und diese Revanche vollzog sich nach dem Schneeballsystem. Das war eine große Enttäuschung, hatten doch führende Nationalsozialisten vor 1933 die politischen Prozesse als Mißbrauch der Justiz bezeichnet. Aber es scheint ja nun einmal so, daß die Menschen nie aus begangenen Fehlern lernen, und daß es der Fluch der bösen Tat ist, daß sie fortzeugend Böses muß gebären. Ich hatte selbst im Jahre 1932 zweimal Gelegenheit gehabt, mich mit Hitler persönlich über das Problem der politischen Prozesse auszusprechen. Das geschah zunächst bei einem Besuch, den Hitler zusammen mit seinem damaligen Pressechef Walter Funk mir im Mai 1932 in meiner Wohnung in Essen machte, und sodann im August 1932, als ich mit der Familie zur Erholung in Berchtesgaden war, und Hitler mich zu einem Gegenbesuch in seinem damals noch bescheidenen Haus auf dem Obersalzberg einlud. Der eigentliche Anlaß zu dieser Aussprache war eine Denkschrift, die ich damals über die Notwendigkeit der deutsch-französischen Verständigung und die friedliche Überwindung der Probleme von Versailles ausgearbeitet hatte, von der Hitler durch meinen Klienten aus den Femeprozessen, Oberleutnant Paul Schulz, der inzwischen in die Reichsleitung der NSDAP eingetreten war, Kenntnis erlangt hatte. Hitler kam bei dieser Gelegenheit von sich aus auf die politischen Prozesse, die er verurteilte, und die Notwendigkeit einer Rechtserneuerung zu sprechen. Er wollte wissen, was ich von der Behandlung der Rechtsfragen im nationalsozialistischen Parteiprogramm hielte. Ich sagte, ich sei der Meinung, daß dieser Punkt nicht gerade glücklich formuliert sei. Er richte sich gegen das römische Recht. Es hätte besser geheißen: "Gegen das volksfremde Paragraphenrecht." Denn ich glaubte ihn so verstanden zu haben, daß sein Kampf um die Rechtserneuerung dieses Ziel habe. Er bejahte das. Ich erwiderte, dann sei die Formulierung gegen das römische Recht schlecht gewählt. Denn der römische Prätor habe ja genau so wie er einen Kampf gegen das Buchstabenrecht geführt, als er gegen das Sakralrecht der Priester die Einrede von Treu und Glauben eingeführt habe, die auch heute noch die Grundlage unseres Zivil- und Handelsrechtes sei. Das gute alte römische Recht sei nur immer wieder durch Formaljuristen verdorben worden. Volksnahes Recht sei daher, wenigstens dem Geiste nach, immer noch die Rückkehr zum einfachen Recht des römischen Prätors, wie es im Corpus juris romanum Justinians niedergelegt sei. Der Leitsatz der preußischen Könige: "Suum cuique" - "Jedem das Seine" - stamme von Ulpian. Keinesfalls dürfe der Kampf um die Rechtserneuerung in den zünftigen Juristenstreit zwischen Romanisten und Germanisten ausmünden. Er verstand mich und sagte: "Sie dürfen die Formulierungen des Parteiprogramms nicht buchstäblich nehmen! Was ich gemeint habe, ist: Fort mit dem volksfremden Paragraphenrecht! Im übrigen ist doch alles noch im Fluß. Wir wollen eine Revolution durchführen und dazu sollen uns alle helfen. Sorgen Sie selbst dafür, daß Ihre Ideen auf die Gestaltung der Dinge Einfluß gewinnen! Das beste Recht ist für uns gerade gut genug!" Wir sprachen dann auch von dem Schlagwort: "Recht ist, was dem deutschen Volke nützt", das schon damals Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen, namentlich in Juristenkreisen, war und auf die verschiedenste Weise ausgelegt wurde. Hitler sagte, daß auch das nicht wörtlich gemeint sei. Er wende sich nur gegen die Überbetonung der Individualrechte in der liberalistischen Zeit und wolle das Primat des Gemeinwohls wiederherstellen. Ich wies darauf hin, daß dann Friedrich der Große in der Einleitung zum Preußischen Allgemeinen Landrecht etwas Ähnliches gemeint habe, wenn er festgestellt habe, daß bei einem Konflikt zwischen privatem und öffentlichem Interesse immer das öffentliche Interesse den Vorrang habe. Er sagte: "Das ist genau, was ich wünsche!" Ich bemerkte: "Dann ist das ja auch nichts anderes, als was schon die Römer forderten, als sie die Forderung aufstellten: Salus publica suprema lex - das öffentliche Wohl ist das höchste Gesetz." Hitler erwiderte: "Jawohl, ich will nichts anderes." Ich habe an dieses Gespräch später oft zurückgedacht, wenn ich die Entwicklung auf dem Rechtsgebiet unter Frank und Freisler beobachtete. Wenn es bei dieser ersten Auslegung, die mir Hitler, wie mir damals schien, gutgläubig gab, geblieben wäre, wäre alles gut gewesen. Aber das hätte Weisheit und Mäßigung in der Anwendung solcher Rechtsgedanken erfordert. An dieser Weisheit und Mäßigung hat es gefehlt. Es fehlte an den Männern, die diese Grundsätze in vernünftiger Form durchzuführen verstanden. Auch hier setzten sich später die Elemente, die den Satz zu einem Zerrbild eines Rechtssatzes machten, durch. Ich war nach diesen Gesprächen, die ich 1932 mit Hitler und anderen führenden Persönlichkeiten der Reichsleitung wie Frick, Gregor Strasser und Buch über Rechtsfragen gehabt hatte, der Überzeugung, daß Hitler, wenn er zur Macht käme, sich bemühen werde, das Recht von der Belastung durch die Politik zu befreien. Es kam leider anders. Mit den KZ's und den Judenmaßnahmen fing es an. Immerhin wurden 1933 die Rechte der Verteidigung noch so respektiert, daß es mir gelang, bei dem ersten in Essen verhafteten jüdischen Rechtsanwalt Gottschalk nicht nur die sofortige Besuchserlaubnis, sondern noch in der ersten Nacht seine Freilassung durch den sonst so scharfen Gauleiter Terboven zu erwirken, und als dann Freisler ins Preußische Justizministerium einzog und dort sogleich den Dezernenten der Politischen Abteilung, der in den Femeprozessen mein sachlicher Gegner gewesen und bei der NSDAP einer der bestgehaßten Juden war, ins Konzentrationslager schickte, gelang es mir, ihn zu befreien. Hiervon abgesehen brachte aber das Jahr 1933 eine Verfolgung der politischen Gegner, wie wir sie bis dahin in Deutschland nicht gekannt hatten. Sie richtete sich in erster Linie gegen die Beamten und Politiker des früheren Regimes. Die Republik von Weimar hatte 1918 von legislativen und administrativen Säuberungsmaßnahmen allgemeiner Art gegenüber den Beamten des vorangegangenen Regimes noch abgesehen. Sie hatte das Berufsbeamtentum unangetastet gelassen. Jetzt gab es zum ersten Mal eine Säuberungsaktion durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Danach sollten alle Beamten entfernt werden, die nicht wegen ihrer beruflichen Eignung, sondern wegen ihrer Parteibeziehungen zu ihren Ämtern gekommen waren. Das waren die sogenannten "Parteibuchbeamten". Die Durchführung des Gesetzes lag in erster Linie dem Innenministerium ob. Die Beamten, die so aus ihren Stellungen entfernt wurden, weil sie für das neue Regime untragbar waren, wurden meist mit vollem Ruhegehalt entlassen. Es gab aber auch Fälle, in denen das Ruhegehalt aberkannt wurde, und die für die Betroffenen bitter waren. Ich habe in jener Zeit zahlreiche Beamte aller Verwaltungszweige in ihren Säuberungsverfahren vertreten und oft auch in Berlin im Innenministerium verhandelt. Die so aus den Ämtern ausgeschalteten Personen waren in ihrem Fortkommen oder Berufsleben nicht behindert. Sie konnten Rechtsanwälte und Steuerberater werden oder in die Wirtschaft übergehen, d. h. in die freien Berufe. Die politische Säuberung im administrativen Wege, die sich 1933 nach dem Umschwung vollzog, hielt sich also noch in erträglichen Grenzen. Sie überschritt nicht das Maß dessen, was auch in demokratischen Ländern bei einem Regimewechsel als Umstellung oder Revirement üblich ist. Sie war in keiner Weise mit dem zu vergleichen, was sich nach 1945 in Deutschland ereignet hat. Sehr viel ernster aber als diese administrative Säuberungsaktion war die Tatsache zu beurteilen, daß der Nationalsozialismus, der vorher die politische Justiz so scharf bekämpft hatte, sich sogleich nach der Machtergreifung auch der politischen Justiz zur Bekämpfung der Gegner von gestern bediente. Das geschah zunächst in der Form der Korruptionsprozesse. Später haben auch die Devisenprozesse und die Klösterprozesse diesem Zweck gedient. Das waren alles Prozesse des gemeinen Rechtes mit politischem Hintergrund. Es war die typische Form der "getarnten" politischen Prozesse, wie sie nicht sein sollen. Ein formalrechtlicher Grund des gemeinen Rechtes lag fast immer vor, wenigstens ließ er sich konstruieren. Aber der formalrechtliche Grund war dennoch nur ein Vorwand. Man übte das Ermessen einseitig aus, weil man die politischen Gegner treffen wollte. Die Anklagebehörden würden, wenn es sich nicht um politische Gegner gehandelt hätte, nicht so scharf vorgegangen sein. Man knüpfte an die Entwicklung der Jahre 1924 bis 1930 an. Damals waren die Gegner der Nationalsozialisten in Korruptionsprozesse nach der Art der Barmat-, Kutisker- und Sklarekskandale verwickelt gewesen. Jetzt hatte die Wirtschaftskrise der Jahre 1928 bis 1932 in manchen Kreisen Korruptionserscheinungen gezeitigt, die aus den Zeitumständen zu erklären waren. Diese wurden nun zu groß aufgezogenen Korruptionsprozessen gegen politische Gegner ausgenutzt, die dadurch kompromittiert werden sollten. Das führte 1933 selbst zu Ausschreitungen und Terrormaßnahmen. SA-Leute erschienen in Gerichtssälen und versuchten, die Richter unter Druck zu setzen. Politische Stellen wie Gau- und Kreisleitungen nahmen Einfluß auf Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte und Rechtsanwälte. Einer der ersten Prozesse, durch die nach der Machtergreifung politische Gegner zur Strecke gebracht werden sollten, war der Görreshausprozeß in Köln, der im Rheinland größtes Aufsehen erregte. Das Görreshaus war der katholische Verlag im Rheinland, in dem unter anderem die Tageszeitung der rheinischen Zentrumspartei, die Kölnische Volkszeitung, erschien. Dieser Verlag hatte sich in der sogenannten Prosperityzeit übernommen. In den Jahren 1925 bis 1928 war Deutschland durch amerikanische Anleihen geradezu überschwemmt worden. Unter der Einwirkung dieses Goldzustroms war es in der ganzen deutschen Wirtschaft zu einer Hochkonjunktur gekommen, die sich mit der der Gründerjahre nach 1871 vergleichen ließ, als die Zahlung der französischen Kriegsentschädigung eine industrielle Überentwicklung in Deutschland hervorrief, die später in einem Zusammenbruch endete. So war es auch in der Prosperityzeit von 1925 bis 1928, die sich als Scheinblüte erwies und der Vertrauenskrise nicht standhielt, die 1930 begann, als Frankreich gegen die deutsch-österreichische Zollunion Sturm lief, die österreichische Kreditanstalt zum Erliegen kam, und schließlich der allgemeine Bankenkrach von 1931 über uns hereinbrach. In dieser Zeit des Prosperitytaumels hatte die Geschäftsleitung des Görreshauses, die sich damals eine der modernsten Druckereien zulegte, Anschaffungen gemacht, die ihr später Schwierigkeiten bereiteten. Das Unternehmen erwies sich als nicht krisenfest und brach in dem allgemeinen Rückschlag zusammen. Die Geschäftsführer und der Direktor der Deutschen Bank in Köln, der der Geldgeber gewesen war, wurden verhaftet und wegen betrügerischen Bankrottes verfolgt, mit ihnen aber zugleich auch der erste Vorsitzende der rheinischen Zentrumspartei, der als Vorsitzender des Aufsichtsrates in dem Verlag einen Ehrenposten hatte, der allgemein angesehene Justizrat Hugo Mönnig in Köln. Es war klar, daß der Eifer, mit dem der Prozeß aufgezogen wurde, hauptsächlich darauf zurückzuführen war, daß man der größten Partei des Rheinlandes, dem Zentrum, einen Schlag versetzen wollte. Der Prozeß wurde von seinen Urhebern mit einer außerordentlichen Leidenschaft geführt. Die örtliche nationalsozialistische Presse nahm eine scharfe Stellung ein. Über eine Woche standen wir während dieses Prozesses geradezu unter dem Trommelfeuer dieser Presse, die ganz besonders Mönnig als den Kölner Zentrumsführer angriff, aber auch die Verteidigung nicht verschonte. Der Prozeß, an dem noch mehrere Angeklagte beteiligt waren, und in dem die bekanntesten Kölner Rechtsanwälte als Verteidiger mitwirkten, wie Justizrat Schmitz, Rechtsanwalt Klefisch, Justizrat von Coellen u. a., nahm so hitzige Formen an, daß einer der weniger beteiligten Angeklagten der Verzweiflung anheimfiel und sich während des Prozesses in seiner Zelle erhängte. Es war nicht der einzige Fall dieser Art, den ich in politischen Prozessen erlebte. In der Weimarer Zeit hatte sich in einem Femeprozeß in Stettin das gleiche ereignet. Es ist für einen Verteidiger, der an solchem Prozeß teilnimmt, auch wenn der betreffende Angeklagte nicht der eigene Klient ist, erschütternd zu sehen, wohin der Zusammenbruch des Vertrauens in den Staat und seine Rechtspflege Menschen, die sich zu Unrecht angeklagt fühlen, bringen kann. Den ersten Abschluß der Verhandlungen brachte die Anklagerede des Staatsanwalts. Es war an einem Sonnabendmorgen. Die Beweisaufnahme war am Tage vorher zu Ende gegangen. Fast drei Stunden hatte der Staatsanwalt gegen die Angeklagten gedonnert, alles schwarz in schwarz gemalt und kein gutes Haar an den Angeklagten gelassen, um ihr volksschädliches Verhalten an den Pranger zu stellen. Die Presse, nicht nur aus dem Rheinland, sondern dem ganzen Reich, war vertreten. Es war inzwischen fast 12 Uhr geworden, aber das Gericht wollte die Verhandlung noch nicht schließen und jetzt dem ersten Verteidiger das Wort erteilen. Der aber erklärte sich außerstande, sofort zu plädieren. Er sei mit der Vorbereitung nicht fertig und bäte, die Verhandlung bis Montag zu vertagen. Da meldete ich mich zu Wort. Ich bat, die Sitzung für eine Verteidigerberatung auf fünf Minuten zu unterbrechen. Der Bitte wurde entsprochen. Eine allgemeine Spannung breitete sich über den Gerichtssaal. Im Beratungszimmer der Verteidiger sagte ich den Kollegen, daß wir unter keinen Umständen das Gericht, die Presse und Zuschauer jetzt am Wochenende unter dem Eindruck der Rede des Staatsanwaltes auseinandergehen lassen dürften. Die Sonntagszeitungen dürften nicht nur mit dem "Schuldig!" des Staatsanwalts angefüllt sein. Wenn niemand zum Plädoyer bereit sei, wolle ich in die Bresche springen und eine Art Vorplädoyer für die gesamte Verteidigung halten, das für alle Angeklagten gültig sei. Ich wollte eine zusammenfassende Darstellung über das Thema "Prosperitytaumel" geben und damit die Hintergründe klarstellen, auf Grund deren die Vorgänge, die hier erörtert würden, allein zu begreifen seien. Als wir den Gerichtssaal wieder betraten, bat unser Senior, Justizrat Schmitz, namens der Gesamtverteidigung, mir das Wort zu einem Vorplädoyer über das Thema "Prosperitytaumel" zu erteilen, was sofort genehmigt wurde. Ich hatte vortreffliches Material, Ziffern, Beweise, Statistiken, Aussprüche führender Männer des In- und Auslandes. Auf einmal fühlten sie alle, daß dieser Prozeß ja der Prozeß der Prosperityzeit war, nicht das Verschulden einer Einzelfirma oder der einzelnen Angeklagten, sondern gesamtdeutsches Schicksal, Zeitgeschichte, aber kein Kriminalfall. Da bekamen die Sonntagszeitungen ein ganz anderes Gesicht. Die Anklagerede verschwand fast ganz, aber in großen Schlagzeilen hieß es überall: "Prosperitytaumel". Die Erörterung hatte Niveau bekommen. Am Montag darauf kam ich zum Plädoyer für Mönnig selbst. Es war deutlich zu merken, daß die Atmosphäre entspannt war. Justizrat Mönnig, der nur das Beste gewollt hatte, traf keine Schuld. Als ich geendet hatte, erhob sich spontan das Gericht. Niemand sagte mehr ein Wort. Das Gericht kehrte nach kurzer Pause zurück. Es verkündete den Beschluß: "Der Haftbefehl gegen Justizrat Mönnig wird aufgehoben." Mönnig wurde sofort in Freiheit gesetzt. Es war ein erfreuliches Zeichen von Richtermut. Auch die Partei sah jetzt ein, daß Mönnig im Recht war. Das war wohl auf die einsichtsvolle Haltung des Kölner Gauleiters zurückzuführen, der erkannt hatte, daß man das Rheinland gegen sich haben würde, wenn man weiter in dieser Weise gegen Justizrat Mönnig vorginge. Der Görreshausprozeß gegen den Zentrumsführer Mönnig war der Korruptionsprozeß für Köln. Der Korruptionsprozeß für Düsseldorf aber sollte der Prozeß gegen den katholischen Volksverein von Mönchen-Gladbach werden. Bei der Verfolgung des Volksvereins handelte es sich um eine ähnliche Sach- und Rechtslage wie beim Görreshausprozeß. Auch hier waren infolge der besonderen Verhältnisse der Prosperityzeit Schwierigkeiten aufgetreten, die nun der Geschäftsleitung als Untreue und Betrug ausgelegt wurden. Auch hier war zu erkennen, daß die Verfolgung nur eingeleitet und groß aufgezogen wurde, weil man die wichtigste Zentrale des politischen Katholizismus kompromittieren wollte. Die Anklage richtete sich gegen den Geschäftsführer des Volksvereins, den Generalsekretär van der Velde, den späteren Bischof von Aachen, dann aber auch gegen den Aufsichtsrat, an der Spitze den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, den früheren Reichskanzler Dr. Marx, der in London 1924 als Prototyp des ehrbaren deutschen Mannes erschienen war, zu dem das Ausland nach dem Kriege wieder Vertrauen gefaßt hatte. Wie konnte man eine solche Persönlichkeit als korrupt hinstellen? Außer Marx waren noch die früheren Reichsminister Dr. Stegerwald und Dr. Brauns angeklagt und ein Mitglied der Zentrumspartei, das in Wirtschaftskreisen führend war, Dr. Lammers in Berlin. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Anklageschrift von über 100 Seiten verfaßt, die den Angeklagten zugestellt wurde, bevor sie auch nur ein einziges Mal verhört worden waren. Der Reichskanzler Dr. Marx, den ich seit dem Ruhrkampf und besonders seit dem Londoner Kongreß kannte und verehrte, bat mich, seine Verteidigung und die der Mitangeklagten zu übernehmen. Mit mir wurde der Kölner Strafverteidiger Klefisch, den ich vom Görreshausprozeß her kannte, als Verteidiger bestellt. Ich besuchte, zusammen mit Klefisch, Dr. Marx in Bonn, wo er bescheiden und zurückgezogen lebte. Wir trafen dort auch noch den früheren Reichsarbeitsminister Dr. Brauns an. Auch in diesem Fall war die Anklage leicht zu widerlegen. Sie war auf übereifrige Berater der Gauleitung Düsseldorf zurückzuführen und hielt einer kritischen Betrachtung nicht stand. Wir stellten den Antrag auf Nichteröffnung des Hauptverfahrens und reichten bei der Wichtigkeit der Sache eine Abschrift dieses Antrages direkt an das Preußische Justizministerium in Berlin ein. Der maßgebende Mann im Preußischen Justizministerium war inzwischen Dr. Roland Freisler geworden, der als Staatssekretär unter dem Justizminister Kerrl, der kein Jurist war, der eigentliche Justizminister war. Ich habe die Sache dann im Preußischen Justizministerium dem Mitarbeiter von Freisler, Ministerialrat Dr. Krug, vorgetragen. Er billigte das Vorgehen von Düsseldorf nicht. Das Verfahren wurde eingestellt. Mein Mitverteidiger, Rechtsanwalt Klefisch, hatte bald darauf noch persönliche Schwierigkeiten. Er war ein tüchtiger Verteidiger, und seine Tätigkeit war daher einigen Dienststellen unbequem geworden. So ließ ihn die Zollfahndungsstelle in dieser Zeit ungeklärter Rechtsverhältnisse in einer Zoll- und Steuersache, in der er als Verteidiger tätig war, eines Tages kurzerhand verhaften mit der Begründung, daß die Tätigkeit des Verteidigers dem Fortgang der Ermittlungen abträglich sei. Als ich von diesem skandalösen Vorgang hörte, richtete ich ein langes Telegramm an den Reichsjustizminister Dr. Gürtner. Es hatte sofort Erfolg. Dr. Klefisch wurde freigelassen, und es erging eine allgemeine Anweisung, daß Verteidiger wegen der Ausübung ihrer Funktionen nicht verhaftet werden dürften. In diesen aufgeregten Zeiten hatte bald jede Stadt ihren politischen Korruptionsprozeß. In Essen richtete sich das Vorgehen gegen den früheren Zentrumsbeigeordneten Dr. Meurer. Dr. Meurer hatte in der Stadtverwaltung Essen, in der sehr viel zu tun war, eine wichtige Stellung eingenommen. Er war Verkehrsdezernent, hatte das Ausstellungswesen, daneben noch andere Dezernate. Er war ein ausgesprochenes Arbeitspferd gewesen, dem der Oberbürge[r]meister stets all das aufbürdete, was bei anderen Dezernenten nicht unterzubringen war. Als Verkehrs- und Ausstellungsdezernent mußte er viele Reisen machen und hatte dadurch erhebliche Auslagen. Er war so mit Arbeit überlastet, daß er oft des Morgens gleich vom Zuge aus ins Büro ging, und dann dort sofort mit neuen dringlichen Sachen überfallen wurde, so daß er nicht immer die Zeit fand, als erstes seine Unkostenrechnung aufzustellen, sondern dies mehr und mehr seinem Personal überließ. Nun wurde behauptet, daß die Unkostenrechnungen nicht in Ordnung seien, eine Methode, die leider damals gegen Beamte, die politische Gegner waren, auch sonst oft angewandt wurde. So war auch der Prozeß gegen Meurer recht bedenklicher Art. Das war, soweit die Anklage in Betracht kam, politische Justiz, die jetzt mit Eifer gegen die Männer des Weimarer Systems gerichtet wurde, von denselben Kräften, die sich vor 1933 über die politische Justiz beklagt hatten. Nach einer langen Voruntersuchung brach die Anklage auch im Falle Meurer in der Hauptverhandlung zusammen. Es war nicht erfreulich, Hunderte von kleinen und kleinsten Kostenrechnungen nachzuprüfen. Ein großer Zeugenapparat wurde aufgeboten. Alle Zeugen traten für Meurer ein, an dessen Sauberkeit und Rechtschaffenheit nicht zu zweifeln war. Der Vorsitzende war ein korrekter Richter. Meurer wurde freigesprochen. Die öffentliche Meinung, auch unter den vernünftigen Parteigenossen, war gegen den Prozeß, den man als Unrecht empfand. Ein ähnlicher Prozeß wie gegen Dr. Meurer in Essen wurde gegen den Bürgermeister Schlanstein in Münster durchgeführt. Man rechnete die Unkostenrechnungen nach, hauptsächlich Reisekosten, und beanstandete Kleinigkeiten. Er sollte auf Reisen Spesen gemacht haben, die er als Beamter nicht in dieser Höhe hätte machen dürfen. Darin sollte Untreue liegen. Nun wurde auch er verfolgt. Er hatte im Säuberungsverfahren gut abgeschnitten und war mit vollem Ruhegehalt entlassen worden. Das hatte nicht genügt. Man wollte ihn ganz erledigen. Schlanstein wurde zu Gefängnis verurteilt. Es folgte das Disziplinarverfahren. Aber die Disziplinarkammer bei der Regierung in Münster sprach Schlanstein frei, und auf Grund dieses Urteils der Disziplinarkammer und des dort eingereichten neuen Materials gelang es, auch im Strafverfahren einen Wiederaufnahmeantrag durchzudrücken. Das Strafkammerurteil wurde aufgehoben und Schlanstein nunmehr auch im Strafverfahren freigesprochen. Es fand auch eine Aussprache und Versöhnung mit dem neuen nationalsozialistischen Oberbürgermeister in Münster statt, der einer der Urheber der Strafverfolgung gewesen war. Dazukam der Prozeß gegen den Oberbürgermeister Dr. Zimmermann von Gelsenkirchen-Buer. Zimmermann hatte sich im Ruhrkampf besonders verdient gemacht. Ich hatte ihn vor dem französischen Kriegsgericht in Recklinghausen verteidigt und dort seine Freisprechung erzielt. Ich hatte ihn ferner vertreten, als er im Zusammenhang mit dem blutigen Sonntag von Buer als Geisel erschossen werden sollte. Zimmermann war Demokrat. Er hatte in der sogenannten Kampfzeit wiederholt Schwierigkeiten mit dem nationalsozialistischen Stadtverordneten von Gelsenkirchen, Dr. Meyer, gehabt. Nun wurde Dr. Meyer sein zuständiger Gauleiter. Er war entschlossen, Zimmermann, mit dem er zahlreiche Differenzen gehabt und auch ein Beleidigungsverfahren ausgefochten hatte, zu erledigen. Ich hatte auch Zimmermann schon im Säuberungsverfahren vor dem Innenministerium vertreten und dort trotz des Widerspruchs des Gauleiters erreicht, daß Zimmermann mit vollem Ruhegehalt, also in allen Ehren, entlassen worden war. Damit gab sich Dr. Meyer nicht zufrieden. Er wollte Zimmermann durch ein Disziplinarverfahren um seine Ruhegehaltsansprüche bringen. Alle Streitigkeiten, die in der Kampfzeit ausgefochten worden waren, wurden nun als Korruptionsfälle herangezogen, für die Zimmermann verantwortlich sei. Das war der typische Fall einer Vergeltung, die sich auf der Ebene eines Prozesses vollzog. Zimmermann wehrte sich energisch. Der Gauleiter griff wiederholt in das Verfahren ein. Er erklärte, daß der Fall Zimmermann für ihn eine Prestigefrage sei. Aber die Disziplinarkammer bei der Regierung in Münster sprach Zimmermann frei. Der Gauleiter Meyer legte Berufung ein. Der Dienststrafsenat des Preußischen Oberverwaltungsgerichtes in Berlin verwarf die Berufung. Den Gauleiter Meyer habe ich später kennengelernt. Der Zufall wollte es, daß er in Hamm in einen Zug nach Berlin einstieg, den ich in Essen genommen hatte, und den Sitzplatz mir gegenüber einnahm. Es kam zu einer offenen Aussprache, und er gab mir schließlich recht. Er war ein ehrlicher Mensch, der zugänglich war und bescheiden lebte. Wenn alle Gauleiter wie er gewesen wären, wäre sicher manches besser gelaufen. So wurden 1933 in zahlreichen Prozessen die Bürgermeister und Oberbürgermeister der Städte in politische Prozesse verwickelt, die fast überall ähnlich gelagert waren und ähnlich verliefen. Sie wurden teils als Strafverfahren, teils als Disziplinarverfahren geführt. Zu den wichtigsten Disziplinarverfahren dieser Art gehörte das Verfahren gegen Dr. Adenauer, dem man seine Geschäftsführung als Oberbürgermeister der Stadt Köln vorwarf. Dr. Adenauer wurde in diesem Verfahren vollkommen gerechtfertigt. Das Verfahren gegen ihn wurde auf meinen Antrag eingestellt. In Düsseldorf wurde zu gleicher Zeit ein ähnliches Verfahren wegen Korruption gegen den Oberbürgermeister Dr. Lehr, der zur Deutschnationalen Volkspartei gehört hatte, durchgeführt, dort allerdings in der Form eines Strafverfahrens. Auch dieses Verfahren endete mit einer Rechtfertigung. Die Eröffnung des Hauptverfahrens wurde durch Beschluß des Oberlandesgerichts abgelehnt. Die Korruptionsverfolgung des Jahres 1933 zeigte ganz ähnliche Formen der politischen Justiz, wie wir sie bei den Femeprozessen der Jahre 1925 bis 1930 gehabt haben. Wieder gab es Sonderdezernate bei den Staatsanwaltschaften für die Korruptionsprozesse gegen politische Gegner, wie es vor 1933 Sonderdezernate für Femeprozesse gegeben hatte. Der Druck, der auf die Staatsanwaltschaften und indirekt auch auf die Gerichte ausgeübt wurde, ging aber damals mehr von den Gauleitungen aus. Von einer einheitlichen Lenkung der Staatsanwaltschaften durch die Justizministerien konnte noch nicht die Rede sein. Eine letzte Form der Verfolgung politischer Gegner in der ersten Zeit des Nationalsozialismus waren die Verfahren vor den Parteigerichten. Von diesen ist mir besonders das Verfahren gegen den Brauereibesitzer Simon von Bitburg bedeutsam erschienen. Die Gebrüder Simon, angesehene Bürger von Bitburg in der Eifel, Inhaber der bekannten Brauerei "Simonbräu", hatten als Katholiken in den Jahren 1920 bis 1923 der rheinischen Zentrumspartei angehört, die zu damaliger Zeit von dem Prälaten Dr. Kaas in Trier geleitet wurde. Einer der Inhaber war nach 1933 der Partei beigetreten. Er wurde jetzt von einer Gruppe extremer Parteimitglieder, die sich im Endziel wohl des guten Unternehmens bemächtigen wollten, als Separatist bezeichnet, der aus der Partei ausgeschlossen werden müsse. Sie legten Gutachten radikaler Politiker vor, wonach die Organisation Kaas als eine Gruppe des sogenannten legalen Separatismus anzusehen sei, also alle, die mit Kaas etwas zu tun gehabt hätten, Landesverräter seien. Diese Elemente drangen mit ihrer These bei dem Kreisgericht Bitburg durch. In der Berufungsinstanz vor dem Gaugericht in Koblenz bin ich als Sachverständiger tätig gewesen und habe die Gutachten erster Instanz, die der damaligen Parteidoktrin entsprachen, widerlegt. Das Gaugericht Koblenz folgte meiner Auffassung und sprach Simon frei. Die prozeßrechtliche Verfolgung der politischen Gegner nahm schließlich ein solches Ausmaß an, daß ich mich im September 1933 entschloß, eine Eingabe an Hitler zu richten, in der ich eine Generalamnestie für alle politischen Gegner, insbesondere für die Korruptionsprozesse, forderte. Nach dem totalen Sieg der Bewegung, so führte ich aus, sei eine totale Befriedung erforderlich. Diese könne nur dadurch erreicht werden, daß ein endgültiger Schlußstrich unter die Vergangenheit gezogen würde. Ich verfaßte eine größere Eingabe, in der ich auf die Denkschrift des Essener Amnestieausschusses von 1930 Bezug nahm, und die Notwendigkeit eines Schlußstriches mit völkerrechtlichen, staatsrechtlichen, historischen und politischen Gründen belegte. In Kapitel 6 der neuen Denkschrift betonte ich unter der Überschrift: "Revolution und Evolution", daß die Revolution beendet und in das Stadium der Evolution überführt werden müsse. Evolution bedeute Wiederaufbau. Der Wiederaufbau von Staat, Wirtschaft und Arbeit verlange aber Ruhe und inneren Frieden. Das fortgesetzte Aufrollen von Prozessen, die Vorkommnisse der überwundenen Zeitepoche zum Gegenstand hätten, beunruhige die Menschen und lasse keinen wahren Frieden aufkommen. In Kapitel 8 heißt es dann unter "Korruptionsamnestie": "Darüber hinaus drängt sich aber die Notwendigkeit weiterer Amnestiemaßnahmen bei solchen Gesetzesverletzungen auf, die für die überwundene Zeitepoche typisch sind, und zu zahlreichen Prozessen geführt haben, die die Öffentlichkeit in höchstem Maße beunruhigen. Dazu gehören in erster Linie die Korruptionsprozesse. Die Korruptionsprozesse, deren große Bedeutung für die deutsche Rechtspflege und das öffentliche Leben überhaupt schon dadurch gekennzeichnet wird, daß zu ihrer Erledigung besondere Dezernate eingerichtet wurden, hängen mit den besonderen Verhältnissen der jetzt überwundenen Zeit zusammen." In Kapitel 12 der an Hitler gerichteten Denkschrift wies ich auf die Unmöglichkeit einer restlosen Korruptionsverfolgung hin. Ich führte S. 14 der Denkschrift aus: "Wenn aber nur einzelne Korruptionsprozesse durchgeführt werden, so muß diese Tatsache erst recht eine Belastung des Rechtsempfindens und des Vertrauens in die Rechtspflege herbeiführen, die dem Staatswohl nicht nützlich ist. Die Erfahrungen mit der politischen Justiz des verflossenen Systems haben gezeigt, wie schädlich eine solche Auswahljustiz ist. Die Vertrauenskrisis der Justiz der verflossenen Zeit ist zum großen Teil auf dieses Auswahlsystem zurückzuführen, das im Volke die Vorstellung eines Sündenbockverfahrens hervorrief; und einer der schwersten Vorwürfe, die gegen die politische Justiz des früheren Regimes erhoben wurden, war gerade der, daß diese Justiz von Zeit zu Zeit je nach den politischen Bedürfnissen gewisse Prozesse aufzog. Ein solcher Eklektizismus ist für eine geordnete Rechtspflege untragbar. Entweder müssen alle Korruptionsprozesse restlos und gleichartig durchgeführt werden oder es muß, wenn dies nicht möglich ist, sobald der oben zu 11 gekennzeichnete Zweck der Korruptionsverfolgung erfüllt ist, ein Schlußstrich unter die ganze Korruptionsverfolgung gesetzt werden." In Kapitel 14 behandelte ich das Interesse der Rechtspflege: "Die intensive Verfolgung von besonderen Straftaten, die einer bestimmten Zeitepoche, einem überwundenen System, eigen sind, durch besondere Abteilungen der Strafverfolgungsorgane, bedeutet immer eine Belastung der ordentlichen Rechtspflege. Die Gerichte werden vor das schwierige Problem der strafrechtlichen Behandlung des Außergewöhnlichen gestellt. Ich darf in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen verweisen, die ich in meiner Denkschrift von 1930 zu Nrn. 2, 3, 4, 26, 27, 29, 33, 35 und 45 gemacht habe, die natürlich nicht ohne weiteres auf die jetzigen Zustände übertragen werden können, aber manche Gedanken grundsätzlicher Art enthalten, die auch heute noch Beachtung verdienen. Genau so wie das Femeproblem ein Problem der strafrechtlichen Behandlung des Außergewöhnlichen war, ist auch in gewissem Sinne der Prosperitytaumel ein Problem des Außergewöhnlichen, das vom Richter kaum gelöst werden kann, aber einer Lösung durch die Amnestieinstanz bedarf." In Kapitel 17 wird der Grundsatz der Rechtsgleichheit behandelt. Der Denkschrift, die das Datum des 24. September 1933 trägt und 22 Kapitel und 28 Seiten umfaßt, war das Plädoyer über Prosperitytaumel im Görreshausprozeß beigefügt. Ich habe also in der Hitlerzeit genau so gegen die politische Justiz gekämpft, wie ich es in der Weimarer Zeit getan hatte. Ich versandte die Eingabe an Hitler, den Reichspräsidenten Hindenburg, die Justizministerien und sonstige oberste Dienststellen im Reich und in der Partei und erhielt nach einiger Zeit den Besuch eines höheren, mir wohlwollenden Parteiführers, der mich warnte. Mein Vorgehen könne als Komplott ausgelegt werden. Ich ließ mich aber nicht beirren und bin auch in keiner Weise deswegen behelligt worden. Einen unmittelbaren Erfolg hat mein Schritt damals nicht gehabt. Aber es kam doch zu einer Entspannung. Die Korruptionsverfolgung hörte auf. Das Jahr 1933 war ein Jahr der Revolution. Das ist vielen Deutschen damals nicht ganz klargeworden. Aber auf dem Gebiet der politischen Justiz machte sich das Revolutionäre doch bemerkbar. Ich war durch die Erfahrungen, die ich damals auf dem Gebiet der politischen Justiz machte, zunächst sehr erschreckt worden, sah aber doch, daß die Bemühungen der Gutgesinnten nicht ohne Erfolg blieben. Die Richter, die sich in der Weimarer Zeit der Politisierung der Justiz widersetzt hatten, zeigten sich auch jetzt ihrer hohen Aufgabe als Hüter des Rechtes im besten Sinne gewachsen. Das hatte ich in den Prozessen Mönnig, Marx, Meurer, Adenauer, Lehr, Zimmermann und Schlanstein gesehen. Die Eingriffe in die Justiz, die zu Anfang vorkamen, hörten auf. Unter den Staatsanwälten, die als weisungsgebundene Beamte eine andere Stellung einnahmen wie die Richter, gab es, zumal unter den jüngeren, einige Eiferer, aber die Mehrzahl, auch der Staatsanwälte, blieb rechtsstaatlichem Denken zugänglich. Es gab auch unter ihnen solche, die bis zuletzt leuchtende Beispiele der Objektivität waren. Das Innenministerium nahm in der Säuberung eine korrekte Haltung ein, auch das Reichs- und Preußische Ministerium der Justiz unter dem Reichsjustizminister Dr. Gürtner und dem Staatssekretär Dr. Schlegelberger taten alles, um die Rechtspflege unabhängig zu erhalten. Die Klagen über die Konzentrationslager hörten auf, nachdem diese Lager in die Verwaltung der staatlichen Behörden übernommen waren. So gewann ich immer mehr die Überzeugung, daß die Dinge einen guten Lauf nehmen würden, wenn alle Gutgesinnten mitmachten, daß sie allmählich aus dem revolutionären Stadium in das Stadium der Evolution und der Wiederherstellung des Rechts übergehen würden. Diese meine optimistische Meinung über die Entwicklung zu geordneten Zuständen in der Rechtspflege erhielt allerdings in den beiden nächsten Jahren noch einmal einen Stoß, zunächst durch die Ereignisse des 30. Juni 1934, sodann nach der Rückgliederung des Saargebietes im März 1935. Man gewährte damals zwar eine Amnestie nach beiden Seiten. Aber das hinderte nicht, daß die extremen Elemente in der Partei und der Gestapo im Saargebiet eine ähnliche politische Justiz herbeizuführen versuchten, wie wir sie 1933, besonders im Rheinland, erlebt hatten. Das geschah diesmal hauptsächlich in der Form von Devisenprozessen, und man beging im Eifer die Ungeschicklichkeit, gerade solche Persönlichkeiten wegen Devisenvergehen zu verfolgen, die sich im Saarkampf für die deutsche Sache Verdienste erworben hatten. Die Eiferer aber verlangten, daß der "politische Katholizismus" getroffen werden sollte. Das Saargebiet gehörte zur Diözese Trier. Im Saargebiet galten jedoch vor der Rückgliederung die deutschen Devisengesetze nicht. Die Diözese hatte zwei Währungen. Da gab es in der Verwaltung der Diözese zahlreiche schwierige Fragen, die zu Verfolgungen wegen Devisenverstößen Anlaß geben konnten. Das benutzte man jetzt, um ausgerechnet die Mitarbeiter des Bischofs von Trier zu verfolgen. Ich fuhr nach Berlin, und es gelang, diese Prozesse zur Einstellung zu bringen. Allmählich hörte diese politische Verfolgung auf. Die Prozesse wegen Korruption, Devisenvergehen und die Klösterprozesse wurden seltener. Es schien, als ob wir einer Befriedung entgegengingen. Ein politischer Prozeß besonderer Art, den man nicht übergehen kann, wenn man die politischen Prozesse der ersten Hitlerzeit schildern will, war der Reichstagsbrandprozeß. Diesem Prozeß habe ich als Beobachter der Reichsregierung beigewohnt. Meine Aufgabe war, den zahlreichen Juristen, die zu dieser Sache aus dem Ausland erschienen waren, über alle Fragen des deutschen Rechtes Aufklärung zu geben. Ich nahm als nichtbeamteter Beauftragter der Reichsregierung am Tisch der Regierungsvertreter Platz und arbeitete aufs engste mit dem Vertreter des Reichsjustizministers, Reichsgerichtsrat von Dohnany, zusammen. Reichsjustizminister Dr. Gürtner hatte seinen persönlichen Referenten von Dohnany zu den Verhandlungen entsandt. Dieser hatte darüber zu wachen, daß der Senat des Reichsgerichts, der diesen Prozeß zu entscheiden hatte, in voller Unabhängigkeit Recht sprechen und von keiner Seite unter Druck gesetzt werden könne. Auch mir wurde jede Möglichkeit der Unterrichtung gegeben. Ich erhielt täglich die Sitzungsprotokolle. Ich hatte ständigen Kontakt mit den übrigen Prozeßbeteiligten, namentlich auch mit dem mir wohlbekannten Verteidiger von Torgier, Rechtsanwalt Dr. Sack, Berlin. Ich konnte somit den Ausländern, die dem Prozeß beiwohnten, Auskunft über alle den Prozeß berührenden Fragen geben. Ich habe selten einen Prozeß erlebt, der mit solcher Gründlichkeit geführt worden wäre, und bei dem alle Beteiligten so sehr bemüht waren, die Unabhängigkeit des Gerichtes so sicherzustellen, wie dies hier geschah. Das schien 1933 besonders deshalb nötig, weil wir in diesem Jahre in vielen Fällen erlebt hatten, daß SA- oder Parteileute auf die Gerichte Druck ausgeübt hatten. Im Reichstagsbrandprozeß aber ging man in dem Bestreben, die Unabhängigkeit der Rechtspflege zu wahren, so weit, daß man auch die Zusammensetzung des Senats ganz der normalen Geschäftsordnung des Reichsgerichts überließ. Auch das Reichsgericht selbst und sein Präsident nahmen keinen Einfluß auf die personelle Besetzung des Gerichts, obwohl bekannt war, daß der als Jurist sehr tüchtige Vorsitzende des zuständigen 4. Strafsenats, Senatspräsident Dr. Bünger, aus Gesundheitsgründen der Aufgabe, einen solchen turbulenten Prozeß zu führen, nicht gewachsen war. Ich war immer der Auffassung, daß es keine glückliche Einrichtung sei, daß solche die Öffentlichkeit erregenden politische Prozesse in erster Instanz vor dem Reichsgericht verhandelt würden. Das Reichsgericht war als höchstes Gericht des Reiches, das sich hauptsächlich mit Rechtsfragen zu beschäftigen hatte, berufen, über die Rechtsgleichheit im Reiche zu wachen. Für die Verhandlungen in erster Instanz waren die Strafkammern da, die nach ihrer personellen Zusammensetzung geeigneter waren, solche Prozesse rasch und befriedigend durchzuführen. Dieser Prozeß, dessen politische Bedeutung klar war, durfte die Autorität des Reichsgerichts nicht belasten. Er mußte von allen Nebensächlichkeiten befreit und durfte nicht durch viele Wochen hingeschleppt werden. Als weitere Beobachter und Regierungsvertreter nahmen an dem Prozeß noch teil: Ein Rechtsanwalt aus Berlin als Vertreter von Göring und der Chef der preußischen Presseabteilung Sommerfeldt und sein Vertreter Rechenberg, ferner als Vertreter des Reichspressechefs Dr. Dietrich der Baron Duprel. Diese Herren, die als Regierungsvertreter dem Prozeß beiwohnten, habe ich während der wochenlangen Dauer des Prozesses sämtlich genauer kennengelernt, besonders von Dohnany und Sommerfeldt. Mit ihnen war ich täglich zusammen, sowohl in Berlin wie in Leipzig. Gisevius habe ich dabei niemals gesehen, auch nicht seinen Chef Diels. Im Prozeß war von einer Einflußnahme der Gestapo nichts zu merken. Die Gestapo war dort in keiner Weise vertreten. Die Behauptung von Gisevius, daß er als Beauftragter der Gestapo an den Verhandlungen im Reichstagsbrandprozeß teilgenommen habe, ist unwahr und von seinem Chef Diels gebührend zurückgewiesen worden.27 Die Haltung der Angeklagten war verschieden. Torgier verteidigte sich gut. Er war ruhig, würdig und sachlich und wußte sich die Sympathien des Gerichts zu verschaffen. Dimitroff verteidigte sich in der Sache selbst überhaupt nicht, sondern versuchte, aus der Verhandlung eine politische Diskussion zwischen Bolschewismus und Nationalsozialismus zu machen; die beiden anderen Bulgaren Popoff und Taneff traten völlig zurück. Mein erster Eindruck, als ich mich mit dem Prozeßstoff vertraut gemacht hatte, war der, daß die Täterschaft van der Lubbes als Brandstifter nachgewiesen sei, aber gegen Torgier und die Bulgaren nur Indizien vorlägen, die zu einer Verurteilung nicht ausreichen würden. Ich habe diese Auffassung auch den Regierungs- und Parteistellen gegenüber, die mich danach befragten, sogleich offen zum Ausdruck gebracht, und niemand hat versucht, mir eine gegenteilige Ansicht aufzunötigen. Man kann geteilter Meinung darüber sein, ob es klug war, bei so schwachen Indizien die Anklage gegen Torgier und Dimitroff zu erheben. Der Entschluß zur Anklage hielt sich aber im Rahmen sachlichen Ermessens. Die Indizien waren ernsthaft genug, daß sie eine Anklageerhebung ermöglichten. Torgier hatte am Brandtage als letzter Abgeordneter das Reichstagsgebäude verlassen und Dimitroff wurde von verschiedenen Zeugen belastet, wobei man über den Wert dieser Belastungen allerdings verschiedener Ansicht sein konnte. Im übrigen war aber an diesem Prozeß mancherlei zu beanstanden. Zunächst die Lex van der Lubbe, ein Sondergesetz, das mit rückwirkender Kraft für Brandstiftung die Todesstrafe einführte, die es vorher bei Brandstiftung nicht gegeben hatte. Ein Entrüstungssturm erhob sich darüber in der ganzen Welt. Deutschland verletzte das Prinzip "nulla poena sine lege" - "keine Strafe, die nicht in einem zur Zeit der Tat gültigen Gesetz vorgesehen war". Das hinderte die Siegermächte 1945 nach dem deutschen Zusammenbruch nicht, in Nürnberg in noch viel schlimmerer Weise gegen den gleichen Grundsatz zu verstoßen. Der Reichstagsbrandprozeß war, das ist nicht zu bestreiten, ein politischer Prozeß. Er war es schon wegen seines Gegenstandes und nach der Art, wie er aufgezogen wurde. Es ließ sich aber auch nicht leugnen, daß für die Erhebung der Anklage gegen die Kommunisten Torgier, Dimitroff, Popoff und Taneff, gegen die nur Indizien vorlagen, doch wohl politische Momente den Ausschlag gegeben haben dürften. Zu beanstanden war ferner, daß die Anklagebehörde die Verhandlungen nicht auf den eigentlichen Prozeßstoff, den Reichstagsbrand, beschränkte, sondern ganz allgemein auf die kommunistischen Betätigungen ausdehnte. Der Prozeß hätte in l bis 2 Wochen abgeschlossen werden müssen. Was interessierte, war die Frage: "Wer hat das Reichstagsgebäude in Brand gesteckt?" Statt dessen beschäftigte man in den letzten Wochen den Senat des Reichsgerichts mit langen Berichten von Polizeikommissaren aus allen Gegenden Deutschlands über Anschläge der Kommunisten, die nichts mit dem Reichstagsbrand zu tun hatten, so daß schließlich auch die Mehrheit des deutschen Volkes jedes Interesse an den Verhandlungen verlor. Dieser Prozeß war weder ein Prozeß des Nationalsozialismus, noch des Kommunismus. Er war der Reichstagsbrandprozeß. Man hätte bei dem Thema bleiben sollen. So wurde es den Gegnern leichtgemacht, den Prozeß einen "Schauprozeß" zu nennen. Diese Bezeichnung verdient aber der Reichstagsbrandprozeß, soweit es um den eigentlichen Prozeßstoff ging, bestimmt nicht. Der Prozeß um die Täterschaft bei der Brandstiftung und um die Hintermänner wurde vom höchsten Gericht des Reiches sachlich verhandelt. Dagegen war ein ausgesprochener Schauprozeß das Privatunternehmen, das damals in Paris und London in Szene gesetzt und ohne jede Berechtigung "Reichstagsbrandprozeß" genannt wurde. Dieses Privatgericht, das da in Paris und London tagte, war von niemandem bestellt, der dazu befugt gewesen wäre. Einige Politiker, die damit offensichtlich bestimmte Ziele verfolgten, setzten sich zusammen und konstituierten sich kraft eigener Autorität als Gericht. Irgendwelche Ermittlungen zum Prozeßstoff oder Tatzeugen standen ihnen nicht zur Verfügung. Als Unterlage hatten sie nur das sogenannte "Braunbuch", ein für die Propaganda zusammengestelltes Schriftstück, in dem die These verfochten wurde, die Nationalsozialisten hätten das Reichstagsgebäude selbst in Brand gesteckt, um einen Vorwand zu haben, die kommunistische Partei zu verbieten. Wenn dem wirklich so gewesen wäre, hätte man sicher ein Sondergericht eingesetzt, das im Schnellverfahren van der Lubbe abgeurteilt hätte. Dann hätte man nicht das Reichsgericht mit der Sache befaßt und vor diesem höchsten Gericht des Reiches einen langwierigen Prozeß durchgeführt, der erst Monate später begann, als Hitler alle politischen Ziele bereits erreicht hatte, und der erst im Dezember 1933 abgeschlossen wurde. Es war m. E. ein Fehler, daß das Reichsgericht auf Antrag des Oberreichsanwalts die Behauptungen des Braunbuches so ernst nahm, daß es über alle Einzelheiten dieser Propagandadarstellung Beweis erhob und sie damit allgemein bekanntgab. Das Braunbuch hatte behauptet, daß Göring der Brandstifter sei. Göring hatte damals als Präsident des Reichstages soeben das Reichstagspräsidentenpalais bezogen, das vom Reichstagsgebäude durch eine Straße getrennt war. Das Reichstagsgebäude und das Reichstagspräsidentenpalais hatten eine gemeinsame Heizungsanlage, die durch einen unterirdischen Gang verbunden war, in dem Rohre lagen. Diesen allgemein bekannten Umstand benutzten die Verfasser des Braunbuches, um zu behaupten, daß Göring aus seiner Wohnung im Reichstagspräsidentenpalais die Brandstifter durch den unterirdischen Gang in das Reichstagsgebäude geschickt habe. Selbst die Namen der Brandstifter wußte das Braunbuch im einzelnen zu benennen. Es griff in aller Eile zu den "Fememördern", die aus den früheren politischen Prozessen bekannt waren: Oberleutnant Paul Schulz und Edmund Heines, der Polizeipräsident von Breslau geworden war. Man vergaß, daß Schulz schon im Dezember mit Gregor Strasser aus der Partei ausgeschieden war. Ausgerechnet diesen Mann, den er glühend haßte, so daß er ihn am 30. Juni 1934 ermorden lassen wollte, sollte Göring zu einer so delikaten Aufgabe ausgesucht haben! Dazukam, daß auch zwischen Schulz und Heines kein Vertrauensverhältnis bestand. Schließlich war Schulz am Tage des Reichstagsbrandes in einem Sanatorium in München, Heines aber in Gleiwitz. Außerdem sollten der Graf Helldorf und der SA-Führer Ernst als Brandstifter beteiligt gewesen sein, die wiederum mit Schulz nichts zu tun hatten. Diese Schilderung war im Braunbuch entsprechend aufgemacht und mit Zeichnungen versehen, die den unterirdischen Gang zeigten. Sogar die einzelnen Brandstifter waren aufgeführt, wie sie, mit Fackeln in der Hand, den Gang durcheilten. Darunter stand die anspruchsvolle Unterschrift: "Nach amtlichen Unterlagen zusammengestellt." Diese Schrift hatte nichts Überzeugendes. Vor dem Reichsgericht aber ließ man alle im Braunbuch genannten Zeugen aufmarschieren: Schulz, Heines, Graf Helldorf, Ernst und schließlich auch Göring und Dr. Goebbels. Nie ist wohl die Verschiedenartigkeit dieser Männer so stark zum Ausdruck gekommen wie bei dieser Zeugenvernehmung, bei der Göring völlig die Selbstbeherrschung verlor, während Dr. Goebbels durch sein überlegenes Auftreten auch bei den Gegnern Anerkennung hervorrief. Der bedeutendste Vorgang aber war der, als das Gericht, gefolgt von allen Auslandsvertretern und Journalisten, zur Augenscheinseinnahme schritt und den ominösen unterirdischen Gang besichtigte. Das begann in der Heizungsanlage des Reichstags. Von dort ging es unter der Straße durch den Gang zum Palais des Reichstagspräsidenten. Der Gang endete in der Wohnung des Pförtners des Palais, die im Kellergeschoß lag. Dort war der Gang durch eine eiserne Tür verschlossen. Wir durchschritten die geöffnete Tür und standen im Wohnzimmer der Pförtnersleute. Dort empfing uns der Pförtner und seine Frau im Sonntagsstaat. Alles drängte sich in dem engen Raum um die Pförtnersleute, die der Senatspräsident Dr. Bünger nun als Zeugen vernahm. Er begann: "Zu welcher Partei gehören Sie? Sie sind doch sicher Nationalsozialisten?" "O nein", lautete die Antwort, "wir sind Sozialdemokraten. Wir Berliner Portiers sind alle Sozialdemokraten." Darauf der Präsident: "Aber jetzt wohnt doch Hermann Göring hier. Hat er nicht verlangt, daß Sie der Partei beitreten?" "Nein", antwortete der Zeuge, "Göring hat mich kommen lassen und gefragt, was ich wäre. Ich habe erwidert: Sozialdemokrat. Darauf hat er gesagt: 'Es ist gut. Die Hauptsache ist, daß Sie Ihre Arbeit ordentlich versehen'." Schon diese Szene, die ganz spontan vor sich ging, wirkte stark auf die Auslandsvertreter. Dann kam die entscheidende Frage: "Wie war es an dem fraglichen Tag?" Und nun schilderten, zuerst der Mann, dann die Frau, den Verlauf des fraglichen Nachmittags und Abends: "Wir saßen hier im Zimmer. Wir hatten noch Bekannte zu Besuch. Wir tranken Kaffee und später noch Bier. Wir waren immer anwesend. Da sehen Sie die Tür zum Heizungsgang. Wer sie benützen will, muß hier durch, durch unsere Wohnung. Ich allein habe die Schlüssel. Die Tür ist immer verschlossen. Es ist den ganzen Nachmittag und Abend niemand da durchgegangen. Wenn das geschehen wäre, hätten wir das sehen müssen. Am Abend, als es dunkel war, hörten wir von draußen her Geschrei. Wir gingen auf die Straße und sahen, daß der Reichstag brannte." Die Zeugen wurden beeidigt. Ihre schlichte, einfache Art machte tiefen Eindruck. Ein hoher Jurist aus einem der neutralen Länder stand neben mir. Als die Vernehmung beendet war, gab er mir die Hand, desgleichen dem Präsidenten Dr. Bünger. Er bedankte sich für alle Unterrichtung, die ihm zuteil geworden sei. "Jetzt ist alles geklärt", so sagte er, "die Behauptung, daß die Nationalsozialisten den Reichstag angezündet hätten, ist widerlegt." Er kehrte am Abend in seine Heimat zurück. Wie erstaunt waren wir, als wir wenige Tage danach in der Zeitung lesen konnten, er habe bei seiner Rückkehr ein Interview gegeben, daß er dem ganzen Prozeß beigewohnt habe und auf Grund seines persönlichen Eindrucks die Erklärung abgeben könne, daß in diesem Prozeß der Beweis dafür erbracht sei, daß die Nationalsozialisten den Reichstag angezündet hätten. Das Ergebnis des Reichstagsbrandprozesses glaube ich wie folgt zusammenfassen zu können: 1. Die Schuld des van der Lubbe war erwiesen. Er durfte aber nicht zum Tode verurteilt werden. Die Verantwortung hierfür trägt nicht das Gericht, sondern der Gesetzgeber. 2. Die Indizien gegen Torgier, Dimitroff und die anderen Bulgaren reichten nicht aus. Sie wurden mit Recht freigesprochen. 3. Die These des Braunbuches über die durch Göring vom Reichstagspräsidentenpalais aus erfolgte Brandstiftung wurde widerlegt. Damit ist auch die Giseviussche Darstellung, die ja auch nur eine verbesserte Braunbuchlegende und schon von Diels28 abgetan ist, hinfällig. 4. Van der Lubbe muß Helfershelfer gehabt haben. Wo diese zu suchen sind, wurde nicht geklärt. Es ist weder eine kommunistische, noch nationalsozialistische Beihilfe erwiesen. Van der Lubbe hatte in der Voruntersuchung ein Geständnis abgelegt und die Brandstiftung in allen Einzelheiten geschildert. Er war an dem fraglichen Abend über die Rampe, die dem Bismarckdenkmal gegenüberlag, in das Reichstagsgebäude eingestiegen, indem er eine der großen Scheiben des äußeren Flures zerbrach. Der Einbruch erfolgte von der Seite aus, wo die Inschrift "Dem deutschen Volke" angebracht war. Er hatte dann sogleich eine Fackel entzündet und lief mit der brennenden Fackel den Flur entlang, der zum Reichstagsrestaurant und der Vorhalle zum Sitzungssaal führte. An dem Flur waren lauter Fenster, so daß der Vorgang von draußen gesehen werden konnte. Seine Darstellung wurde durch Augenzeugen bestätigt, die von der Straße her das Einsteigen van der Lubbes beobachtet hatten. Sie benachrichtigten sofort die Polizei, Feuerwehr und die Pförtner des Reichstagsgebäudes. Van der Lubbe wurde an Ort und Stelle angetroffen, wo er wie ein Rasender im Sitzungssaal des Reichstags und den Gängen umherlief und mit brennenden Gegenständen weiter Feuer anlegte. In der Hauptverhandlung verweigerte van der Lubbe jede Erklärung und hielt den Kopf stets gesenkt. Das war nach Ansicht der Ärzte, die ihn während der ganzen Voruntersuchung und Hauptverhandlung stets beobachteten, eine reine Verteidigungstaktik. Die Ärzte waren der Auffassung, daß die Darstellung, die van der Lubbe in der Voruntersuchung gegeben hatte, durchaus glaubhaft sei. Es waren zwei gewissenhafte ältere Amtsärzte, keine Parteifanatiker. Sie lehnten die Möglichkeit, daß man van der Lubbe Drogen gegeben oder sonst in unzulässiger Weise auf ihn oder die Ärzte eingewirkt hätte, entschieden ab. Ich habe mich auch persönlich während des Prozesses mehrfach mit ihnen unterhalten und habe ihre Darstellung für überzeugend gehalten. Obwohl nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung feststeht, daß van der Lubbe das Feuer allein angelegt hat, muß er Helfershelfer gehabt haben. Das war auch die Meinung der im Prozeß hierzu vernommenen Sachverständigen. Denn der Sitzungssaal bestand fast nur aus Holz, Bänken, Türen usw. Es waren wenig leicht brennbare Gegenstände, wie Vorhänge, Teppiche usw. vorhanden. Es muß also kurz vor der Brandlegung in den stillen Stunden des Spätnachmittags jemand die Bänke und Tische des Sitzungssaales durch Bestreichen mit Benzin oder einem ähnlichen Stoff präpariert haben. Wer das war, ist nicht festgestellt. So einwandfrei die Braunbuchlegende von der Brandstiftung durch die Nationalsozialisten im Reichstagsbrandprozeß widerlegt wurde, hat sie doch den Prozeß überdauert. Es gibt in politisch bewegten Zeiten, wie wir sie in unserer Generation erlebten, Legenden, die sich hartnäckig durchsetzen, gegen die kein Gegenbeweis durchzuführen ist, und die somit Geschichte werden. "Mundus vult decipi" - Die Welt will betrogen sein. Dieser alte römische Satz gilt auch heute noch. Wir haben solche Legenden genügend erlebt. Sie gehören zum eisernen Bestand der modernen Propaganda. Ein Beispiel dafür ist die Emser Depesche. Sie soll gefälscht sein. Die wenigsten wissen, welche Bewandtnis es im einzelnen damit hat. Genug: "Bismarck hat die Depesche gefälscht und damit Preußen in den Krieg mit Frankreich getrieben!" Das Urteil von Nürnberg, das in seiner Sachdarstellung über die Machtergreifung mit dem Reichstagsbrand beginnt, läßt die Frage, wer den Reichstag angesteckt hat, offen.29 Aber es gibt heute Deutsche, die sich die Legende so zu eigen gemacht haben, daß sie Gegendarstellungen nicht mehr zugänglich sind. Eins hat jedenfalls der Prozeß gezeigt, daß man mit einer noch so sorgfältigen Prozeßführung eine politische Legendenbildung nicht verhindern kann. Diese Erfahrung wirkte sich in der weiteren Entwicklung der Rechtszustände in Deutschland ungünstig aus. Dieser Prozeß war nach demokratischen Spielregeln geführt worden. Das Ergebnis gab aber denen recht, die Hitler gegen die "Juristen" der "liberalistischen" Welt aufbrachten. Das Mißtrauen Hitlers gegen diese Form der Justiz wuchs. Die Männer, die damals, wie Gürtner, Funk u. a. zur Führung eines einwandfreien Prozesses geraten hatten, waren in ihrer Autorität nicht gestärkt. Die Entwicklung zu Volksgerichtshof, Sondergerichten und Polizeistaat ist m. E. durch nichts so gefördert worden, wie durch die Enttäuschung, die der Verlauf und die Auswirkung dieses Prozesses bei Hitler hervorrief.
Dazu mag auch die Erkenntnis beigetragen haben, daß die Propaganda, die mit diesem
Prozeß verbunden worden war, sich letzten Endes nicht günstig ausgewirkt hatte.
Das
gilt für die Propaganda nach innen und außen. Die viel zu breit angelegte
Rundfunkübertragung der Sitzungen des Reichsgerichts wurde von der Mehrheit des
Volkes als Übertreibung empfunden und in dieser Form abgelehnt. Es ist allerdings
für den Intellektuellen schwer, die Wirkung der Propaganda auf die Massen richtig zu
beurteilen. Das Auftreten von Göring, das von allen, die dabei waren, als peinlich
empfunden wurde, wirkte sich auf die Massen in Deutschland anders aus. Man empfand es wie
eine Erlösung, daß hier endlich einmal jemand dem Gegner gründlich die
Meinung gesagt hätte.
27Diels, Lucifer ante portas, Stuttgart 1950,
S. 158. ...zurück...
28Diels (Anm. 27), S. 198 ff. ...zurück...
29Das Urteil von Nürnberg, München
1946, S. 18. ...zurück...
|