
[383]
Die Deutschen in
Übersee
Paul Rohrbach
Um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert war die Pfalz durch die
französischen Mordbrennereien geplagt, und die Bevölkerung litt
auch unter dem wechselnden Glaubensdruck ihrer bald katholischen, bald
protestantischen Fürsten. Dazu kam der furchtbar kalte Winter von 1708
auf 1709, in dem alle Reben und Obstbäume erfroren. Englische koloniale
Spekulanten, die Siedler für ihren Landbesitz in Nordamerika brauchten,
benutzten die herrschende Verzweiflung und schickten Agenten nach der Pfalz,
um die Leute zur Auswanderung zu bewegen. Im Frühling und Sommer
1709 fuhren etwa 14 000 Pfälzer auf Schiffen und
Flößen den Rhein hinab, fanden Überfahrt nach England und
sammelten sich in London. Dieser Schwarm meist armer Leute war der englischen
Regierung unerwünscht. Der eine Teil wurde nach Deutschland
zurückgeschickt, andre brachte man nach Irland und steckte sie als Arbeiter
in die irischen Leinewebereien; gegen tausend starben auch auf englischem
Boden. Nur ein Rest, etwa 4000 Seelen, kam schließlich nach New York,
wurde gleich an die Indianergrenze geschickt und dort gewissenlosen
Großgrundbesitzern und Spekulanten zur Ausbeutung überlassen.
Schließlich rettete sich der eine Teil aus der drückenden
Knechtschaft, indem er einer Einladung der Mohawkindianer folgte, die mit den
Deutschen gern Handel treiben wollten und ihnen umsonst reichlich Land im Tal
des Mohawkflusses überwiesen. Ein anderer Teil wagte, gleichfalls
befreundeten indianischen Führern folgend, die Fahrt auf dem durch
unbekannte Gebirge und Urwälder nach Pennsylvanien
hinabströmenden Susquehanna-Fluß und gelangte so in eine Gegend
in der Nähe der heutigen Stadt Harrisburg, in den Vorbergen der
Alleghanies. Dort gab es noch reichlich freies und fruchtbares Land.
So entstanden zwei voneinander getrennte Gebiete deutscher Siedlung auf
nordamerikanischem Boden. Die Niederlassung im Mohawktal blieb auf dies
Gebiet beschränkt, entwickelte sich aber kräftig als eine deutsche
Enklave in der rückwärts gegen die Küste von
englischen Kolonisten, vorwärts, gegen die großen Seen
hin, noch ganz von Indianern bewohnten Waldregion. Der ganze Osten
der heutigen Vereinigten Staaten war damals noch von Urwald erfüllt, in
dem die Indianer ihre Jagdgebiete hatten. Es mußte harte Rodungsarbeit
geleistet werden, und es gab auch fortwährende Kämpfe mit den
Indianern, in denen die Pfälzer Kolonisten zu einem harten und starken
Geschlecht heranwuchsen, das seine Büchse ebenso gut zu gebrauchen
wußte wie Pflug und Axt. Eine viel größere Ausdehnung als im
Mohawktal gewann das Deutschtum in Pennsylvanien. Hier wuchs es durch
fortdauernde Zuwanderung und reichliche natürliche Vermehrung so
kräftig an, daß zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges der
Vereinigten [384] Kolonien gegen
England ein Drittel der Gesamtbevölkerung von Pennsylvanien deutscher
Herkunft war. Die Pfälzer in Pennsylvanien wohnten meist geschlossen,
bewahrten ihre heimische Mundart und wirtschafteten auf die von Hause
mitgebrachte Art, die der Landwirtschaft der englischen Kolonisten weit
überlegen war.
Von der Gesamtbevölkerung der nordamerikanischen Kolonien zur Zeit des
Unabhängigkeitskrieges - sie betrug damals etwa zwei
Millionen - machten die Deutschen vielleicht ein Zehntel aus. Es ist daher
unbegreiflich, wie die in vielen Veröffentlichungen kolportierte Legende
entstehen konnte, es habe sich einmal die Frage erhoben, ob die amtliche Sprache
im Kongreß der Vereinigten Staaten Deutsch oder Englisch sein solle!
Manchmal wird dies Märchen auch nur von der Legislatur von
Pennsylvanien erzählt mit dem Hinzufügen, die Stimmen für
Deutsch und Englisch seien gleich gewesen, und ein Deutscher habe den
Ausschlag für Englisch gegeben. Davon hat selbst in Pennsylvanien nie die
Rede sein können, denn die englischen Kolonisten waren auch dort nicht
nur doppelt so zahlreich wie die Deutschen, sondern aus ihnen rekrutierte sich
auch weit überwiegend das geistig führende Element und die
politisch maßgebende städtische Bevölkerung. Ein
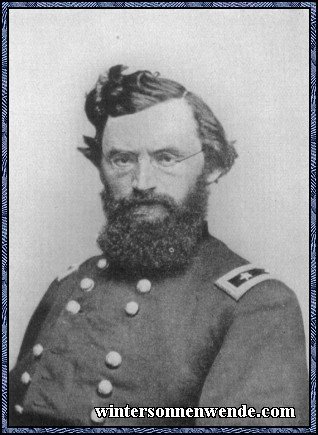
[385]
Karl Schurz,
deutscher politischer Flüchtling
und amerikanischer Staatsmann.
|
geschichtlicher Anhalt für die Entstehung jener in sich unmöglichen
Erzählung existiert nirgends. Wohl aber ist es Tatsache, daß die
Deutschen von New York, und nicht minder die von Pennsylvanien, am
Unabhängigkeitskrieg mit dem Herzen und der Waffe ebenso beteiligt
waren wie die Mehrheit der englischen Kolonisten. Die Pfälzer Bauern vom
Mohawktal warfen unter ihrem Führer Nicolaus Herchheimer im
September 1777 in dem blutigen Gefecht von Oriskany eine überlegene
Macht von englischen Regulären und verbündeten Indianern unter
dem Obersten St. Leger, die von Kanada her anrückte, entscheidend
zurück, und diese Niederlage führte bald darauf zur Kapitulation des
englischen Generals Bourgoyne bei Saratoga im Staat New
York - dem ersten großen Erfolg der Amerikaner. Das Verdienst der
Deutschen hat der Oberbefehlshaber George Washington dankbar anerkannt. In
Pennsylvanien konnten ganze Regimenter aus deutschen Freiwilligen gebildet
werden, und ein Deutscher, Peter Mühlenberg, ursprünglich Pfarrer
in dem Städtchen Woodstock in Virginien, nahe der pennsylvanischen
Grenze, wurde einer der bedeutendsten Generale des
Unabhängigkeitskrieges.
Die Pfälzer im Mohawktal verloren ihr Deutschtum schon in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Heute erinnern an sie nur noch einzelne
Ortsnamen und eine oder die andre bei den Bewohnern erhaltene deutsche
Liedermelodie. Auf dem Monument von Oriskany aber, wo die Gefallenen
verzeichnet stehen, liest man lauter deutsche Namen. In Pennsylvanien waren
ausgedehnte Landstriche noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts deutsch.
Hier hatte sich in der Tat ein kräftiger und geschlossener Typ von
Übersee-Deutschtum entwickelt. Jetzt ist er im Aufgehen im
gewöhnlichen Amerikanertum begriffen, aber noch nicht ganz
verschwunden. Das "Pennsylvania Dutch" ist echtes Pfälzisch, vermischt
mit englischen Lehnworten. Die ältere Generation spricht es noch heute zu
Hause; die jüngere spricht Englisch, singt aber noch manchmal die alten
mundartlichen Lieder. Auch in manchen Kirchen wird noch ein Teil des
Gottesdienstes in deutscher Sprache gehalten. Es gibt eine ziemlich reiche
poetische und erzählende Literatur in der Mundart, die sogar Gegenstand
der Pflege auf der Universität von Pennsylvanien [385] in Philadelphia ist.
Eine Anzahl hervorragender Amerikaner, darunter bekanntlich auch
Präsident Hoover, ist pennsylvanisch-deutscher Herkunft.

[387]
Aus dem nordamerikanischen Bürgerkrieg.
Das deutsche Ohioregiment kämpft siegreich bei Somerset.
|
Reste älteren Siedlungsdeutschtums auf nordamerikanischem Boden gibt es
auch noch in Texas. Dort machte in den vierziger Jahren des
19. Jahrhunderts eine deutsche Adelsgesellschaft unter dem
Präsidium eines Fürsten
Solms-Braunfels den Versuch zu einer Art deutscher Staatengründung.
Texas gehörte damals noch nicht zur Union. Das Unternehmen
mißglückte völlig, doch kamen einige tausend deutsche
Einwanderer nach Texas. Die Mehrzahl ließ sich in der Siedlung
Neu-Braunfels nieder, und dort wird auch noch teilweise Deutsch gesprochen.
Kleinere Bezirke mit einer vorwiegend deutschstämmigen
Farmbevölkerung gibt es auch in Dakota, wohin Tausende von deutschen
Kolonisten aus Südrußland nach Aufhebung ihrer
Militärfreiheit auswanderten.
In Kanada ist das Deutschtum im allgemeinen zerstreut. Nur an einer Stelle hat es
sich bis zur Gruppensiedlung verdichtet, und zwar in den deutschen
Mennonitenkolonien in der Provinz Ontario. Ihre Angehörigen stammen
ebenfalls aus den deutschen Siedlungen in Südrußland, unter denen
es viele Mennoniten gab. Die kanadischen Mennoniten deutschen Stammes bilden
eine wirtschaftlich gesunde, aber geistig etwas rückständige
Gemeinschaft. Das Gefühl der Bekenntnisgemeinschaft überwiegt
bei ihnen das deutsche Bewußtsein.
In den landläufigen Angaben über das Deutschtum im Auslande
begegnen oft phantastische Zahlen über die
Deutsch-Amerikaner. Obwohl wir es hier mit dem überseeischen
Siedlungsdeutschtum zu tun haben, und die in den Vereinigten Staaten wie in
Kanada zerstreut lebenden, meist zur Stadtbevölkerung gehörenden
Deutschen von rechtswegen für uns nicht mit in Betracht kommen, so
halten wir es doch für wichtig, die völlig falsche Vorstellung zu
korrigieren, als ob es in Nordamerika 8 oder 12 oder womöglich gar
20 Millionen "Deutsche" gäbe. Bei jeder Volkszählung
werden in den Vereinigten Staaten diejenigen Einwohner besonders
aufgeführt, die selbst im Ausland geboren sind oder von eingewanderten
Eltern stammen. Eine der letzten Zählungen ergab 8 Millionen
Personen, die in diesem Sinne, also einschließlich der zweiten, bereits in
Amerika geborenen Generation, deutscher Herkunft waren. Es ist aber leider
unmöglich, die Nachkommenschaft aus Deutschland eingewanderter Eltern
noch im gewöhnlichen Sinne als Deutsche zu betrachten. Die Kinder
bewahren nur in seltenen Fällen das Deutsche als Umgangssprache.
Weitaus die Mehrzahl spricht nur Englisch und fühlt sich restlos
amerikanisch. Diese Millionen zum überseeischen Auslandsdeutschtum zu
zählen, ist daher bloße Fiktion. Es mag, hochgerechnet, in ganz
Nordamerika heute noch zwei Millionen [386] Menschen geben, fast
alles Eingewanderte, die Deutsch als Muttersprache reden. Ihre Zahl wird von
Jahr zu Jahr kleiner, und bei den herrschenden, gegen das Deutschtum beinahe
prohibitiven Einwanderungsgesetzen wird das
Deutsch-Amerikanertum, falls nicht ganz unerwartete Umstände eintreten,
in längstens einem Menschenalter der Vergangenheit angehören.
Damit soll nicht gesagt sein, daß es unter den deutschstämmigen
Amerikanern zukünftig kein Gefühl deutscher Herkunft mehr geben
wird. Gerade um dies Gefühl unter den geistig Höherstehenden zu
pflegen, hat sich die "Steuben-Gesellschaft von Amerika" gebildet, so genannt
nach jenem Offizier aus der Schule Friedrichs des Großen, der als
amerikanischer General aus Washingtons wenig kampftüchtigen Milizen
erst brauchbare Soldaten machte. Die Steuben-Gesellschaft will den Stolz auf
deutsche Herkunft wecken und erhalten. Für die Frage des Deutschtums ist
es aber charakteristisch, daß ihre Verhandlungssprache englisch ist, weil sie
sonst zu der Mehrzahl der Menschen, die sie beeinflussen will, gar keinen Zugang
fände.
Im ganzen sind vom Beginn der amerikanischen Registrierungen im Jahre 1820
bis zum Weltkrieg rund fünf Millionen Deutsche nach den Vereinigten
Staaten eingewandert; außerdem einige Hunderttausend nach Kanada. Nach
der Berechnung des deutschamerikanischen Professors Faust konnte man um die
Jahrhundertwende, bevor die romanische und slawische Einwanderung ihre
Höchstzahl erreichte, annehmen, daß der Anteil des deutschen Bluts
im Volk der Vereinigten Staaten zwischen 27 und 28 Prozent betrug.
Natürlich durfte das nicht so verstanden werden, als ob damit über
ein Viertel aller Amerikaner rein deutscher Herkunft gewesen wären;
vielmehr hatten sich deutsches, angelsächsisches, irisches und sonstiges
Blut im ganzen ununterscheidbar miteinander gemischt. Konfuse Leser haben aber
Faust so verstanden, als ob er, auf Grund der damaligen Gesamtzahl der
Bevölkerung der Vereinigten Staaten, von 18 bis 19 Millionen
"Deutschen" in Amerika hätte sprechen wollen. Diese unsinnige Ziffer
spukt noch bis heute in allen möglichen Reden und Artikeln.
Ein ganz anderes Bild steht vor uns, wenn wir uns dem
südamerikanischen Deutschtum zuwenden. Im September 1824
landeten die ersten Einwanderer aus Deutschland bei Porto Alegre im heutigen
brasilianischen Staat Rio Grande do Sul und gründeten als
ihren ersten Platz die Kolonie São Leopoldo. Das war also nur zwei Jahre
nach der brasilianischen Unabhängigkeitserklärung. Auf
Rio Grande folgte die deutsche Siedlung in den beiden andern
Südstaaten, Santa Catharina und Paraná. Nimmt man die zerstreut
lebenden Deutschen in São Paulo und die mehr isolierten Siedlungen in
Espirito Santo hinzu, so wird man heute das gesamte brasilianische Deutschtum
auf dreiviertel Millionen Köpfe veranschlagen können, wovon
über 80 Prozent in mehr oder weniger geschlossenen deutschen
Siedlungsgebieten leben. Reichlich die Hälfte lebt in Rio Grande
do Sul, ein Viertel in Santa Catharina. In diesen beiden Staaten machen die
Deutschen je 20 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Wirtschaftlich
bedeuten sie mehr, politisch dagegen viel weniger als diesem Prozentsatz
entspricht.
Die deutschen Ansiedler sind zum größten Teil Bauern. Als sie in den
brasilianischen Urwald kamen, hieben sie sich breite Durchhaue, Schneisen oder
Pikaden, durch die Baummassen und wählten sich zu beiden Seiten ihre
Grundstücke. Daher spricht man noch [387] heute in
Rio Grande von der Kaffeschneiz, der Batatenschneiz, der
Pommernschneiz usw. Aus den ursprünglichen Pikaden sind aber schon
lange stark befahrene Landstraßen geworden, an denen sich viele Stunden
weit auf dem fruchtbaren Boden reiche Bauerngehöfte hinziehen. Aus den
sogenannten "Stadtplätzen", die meist in der Mitte der Pikaden angelegt
wurden, wo Kirche und Schule, Wirtshaus und Kaufladen, Tanzboden,
Schmiede usw. ihre Stelle fanden, sind stattliche Ortschaften geworden. Sehr stark ist die
natürliche Vermehrung. Familien von zwölf und mehr Kindern sind
keine Seltenheit.
Die erste Generation mußte überall mit
großen Schwierigkeiten kämpfen. Heute, wo schon das dritte, hier
und da schon das vierte Kolonistengeschlecht auf blühendem, durch eigene
und der Väter Arbeit geschaffenem Kulturboden sitzt, ist von diesen
Anfangsmühsalen nichts mehr zu merken. Es findet dauernd Zuwanderung
aus Deutschland statt - nur im Augenblick ist sie wegen der
Weltwirtschaftskrise auch durch die brasilianische Regierung
gesperrt - und der neue Ankömmling stößt nicht auf
leichte Verhältnisse. Alles gute Siedlungsland ist zunächst mit
dichtem Walde bedeckt, und nur der im Lande geborene Kolonist weiß, wie
er mit dem Urwald umzugehen hat. Ist ein neues Landlos erworben, so wird der
Sohn, der sich dort niederlassen soll, von Brüdern und Verwandten
begleitet, die ihm bei der Arbeit helfen. Eine Hütte wird roh gebaut, schon
am nächsten Tage krachen die Axtschläge im Walde. Mit breiten
Messern wird zunächst das dichte Unterholz abgehauen, und dann werden
mit einer Schnelligkeit und Geschicklichkeit, die man gesehen haben muß,
um daran zu glauben, die dicksten Urwaldstämme niedergelegt, von denen
jeder im Fallen noch ein halbes Dutzend vorher angeschlagener kleinerer
Bäume mitreißt. Schon nach einigen Wochen sind das Unterholz und
das kleine Astwerk trocken und werden verbrannt. In vier oder fünf Jahren
sind auch die dicken Stämme und die im Boden gebliebenen
Stümpfe vermodert. Von da ab kann glatt ge- [388] pflügt werden;
vorher wird mit Hacke und Pflanzstock gearbeitet. Das Ganze ist ein Vorgang, so
voll Kraft und Selbstverständlichkeit, wie ein Naturereignis. In je
fünfzehn Jahren schätzungsweise verdoppelt sich auf
natürlichem Wege die Zahl der deutschen Siedler in Südbrasilien. Im
Jahre 1950 kann es in Rio Grande schon über eine Million und in
ganz Brasilien über zwei Millionen Deutsche geben.

[389]
Ein deutscher Landmesser im brasilianischen Urwald.
|
Ich habe fast alle wichtigeren deutschen Siedlungsgebiete in Südamerika
besucht. Vielleicht darf ich hier nach meinen Aufzeichnungen eine Schilderung
der Verhältnisse in und bei den bekannten deutschen
Kolonistenstädten Joinville und Blumenau, beide im Staat Santa Catharina,
geben. Was man dort sieht, ist typisch für ganz Südbrasilien.
Joinville wurde vor etwa siebzig Jahren von einigen hundert Auswanderern
gegründet, die als Kolonisten angeworben waren und sich unter "Brasilien"
auch etwas anderes vorgestellt hatten, als den Mangrovensumpf, in dem man sie,
eine Stunde landeinwärts, von Bord setzte. Hätten sie nur nach
Deutschland zurückgekonnt, kein Einziger wäre dageblieben. Da
aber ausgehalten werden mußte, so wurde ausgehalten,
und das Ergebnis war schon ein Menschenalter später ein freundlicher und
gewerbefleißiger Ort, in den jetzt allerdings auch schon das
einheimisch-brasilianische Element eindringt. Auf viele Meilen im Umkreis dehnt
sich deutsches Bauernland, nur wenig von fremden Einsprengseln unterbrochen.
In und um Joinville ist die Kolonisation abgeschlossen. Noch in der Ausdehnung
begriffen ist dagegen das große Ansiedlungsgebiet, das sich an den zweiten
deutschen Platz, Blumenau, anschließt. Schon in dem Tal, durch das man
von der Santa-Catharina-Bahn nach Blumenau hinauffährt, wohnen fast nur
Deutsche, und wenn man in das Gebiet des Itajahy, des Flusses von Blumenau,
kommt, so kann man sich, bis auf die fremden Vegetationsformen,
überhaupt in Deutschland glauben. Ein reicher Bauernhof folgt längs
der Straße auf den andern, jeder durchschnittlich 100 Morgen
groß, und das flachsköpfige Kindervolk, das uns begegnet, ist so
zahlreich, daß jeder merkt: Kinder sind hier die größte
wirtschaftliche Hilfe! Es sind alles Pommern, die sich hier angesiedelt haben.
Pommerode heißt auch der Platz, wo Kirche, Schule und die nötigen
Geschäfte stehen. Unter den Bananen und Orangebäumen wird
Pommersch-Platt gesprochen, und den größten Teil der abgefallenen
reifen Früchte fressen die Schweine, weil die Menge sonst weder
verbraucht, noch durch Verkauf verwertet werden kann.
Das Hauptgetreide ist Mais. Weizen gedeiht nur ganz unten in Rio Grande, und
Brotmehl kommt meistens aus Argentinien und Nordamerika. Auch die Kartoffeln
sind mittelmäßig. Schweine, Hühner, Enten, Gänse gibt
es im Überfluß. Gepflügt wird mit Pferden oder Ochsen.
Überall sieht man Rindvieh weiden. Wohin man blickt, ist Wohlstand; die
Häuser stattlich und sauber, hinter den Scheiben weiße Gardinen, die
Geräte gut. Alles reitet, Männer, Frauen, Kinder: zum Einkauf, zum
Tanz, zur Kirche, zur Schule. Die Großeltern dieser reichen Bauern kamen
als besitzlose Landarbeiter aus Pommern. Auch sie gerieten bei der Ankunft in
Verhältnisse, so hart, daß alle verzweifelt nach Hause
zurückwollten. Aber daran war kein Gedanke, und so arbeiteten sie sich
durch. Blumenau selbst ist für den Besucher eine noch größere
Überraschung als Joinville. Wer das freundliche, behäbige
Städtchen mit dem norddeutsch-kleinbürgerlichen [389] Bautypus, aus der Mitte
des 19. Jahrhunderts, sieht, der fragt sich unwillkürlich: Aber wie
kommt so etwas nur nach Brasilien? Blumenaus Wohlstand beruht, außer
auf der reichen Landwirtschaft der Umgebung, auch schon auf eigener Industrie.
Es hat Webereien, Möbelfabrikation, Molkereien, Tabakbau. Im
Augenblick drückt auch bei den deutschen Kolonisten in Brasilien die
Weltkrise Wirtschaft und Lebenshaltung nieder, aber die Verhältnisse sind
hier innerlich so gesund, vor allem ist der Absatz der landwirtschaftlichen
Produkte nach den großen Städten so gesichert, daß die
Erholung von selbst eintreten wird, sobald erst die akute Krisenlage
nachläßt.
Das Bild dieses deutschen Kolonistentums im subtropischen Südamerika
wäre unvollständig, wenn wir nicht auch noch von ihrem geistigen
Leben etwas sagen wollten. Im Unterschied von Nordamerika, wo ein
höheres Schulwesen von Anfang an nur in englischer Sprache geduldet
wurde (und auch nur in dieser möglich ist), stand es den deutschen Siedlern
in Brasilien, wie auch in den übrigen lateinamerikanischen Ländern,
frei, sich ein eigenes Schulsystem in der Muttersprache aufzubauen, von der
Dorfschule bis zur gymnasialen Vollanstalt, nur ohne die alten Sprachen.
Vollanstalten mit deutscher Unterrichtssprache gibt es in Brasilien drei: in Rio de
Janeiro, São Paulo und Porto Alegre; außerdem eine ganze Anzahl
Mittelschulen und etwa tausend Volksschulen, davon die meisten in
Rio Grande. Von den letzteren kann allerdings überwiegend
nicht gesagt werden, daß sie auf der Höhe deutscher
Volksschulen in der Heimat stehen. Zwar bessern sich die Verhältnisse
dauernd, aber es ist noch lange nicht möglich, jede Pikadenschule mit einer
fachlich ausgebildeten Lehrkraft zu besetzen und mit ausreichenden Lehrmitteln
[390] zu versehen.
Namentlich unter den älteren Leuten herrscht noch viel Unbildung. Die
meisten von diesen sind nicht imstande, einen verständlichen Brief zu
schreiben oder ein einfaches Buch mit Nutzen zu lesen.
Der vielfach noch nicht befriedigende Stand des deutschen
Volksschulwesens - die Mittelschulen und die Vollanstalt sind durchaus
auf der Höhe - in Brasilien hat zur Folge, daß die jungen
Leute, wenn sie aus der Pikade in die Stadt kommen, wenig Widerstandskraft
gegen die Entnationalisierung zeigen. Weil es an wirklicher, sei es auch nur
einfacher deutscher Bildung fehlt, erliegen sie geistig, vor allem auch
sprachlich, den Wirkungen, die von der zwar sehr oberflächlichen, aber mit
einer gewissen Formeneleganz ausgestatteten gesellschaftlichen Art des
Brasilianertums ausgehen. Schon daß sich der Kolonist in deutscher
Sprache, die er ja meistens auch nur als Mundart gebraucht, über die Dinge,
die außerhalb des Gesichtskreises der Pikade liegen, kaum
ausdrücken kann, ist ein starker Grund dafür, daß er in der
Stadt portugiesisch zu sprechen anfängt.
Der deutsche Bauer ist unpolitisch. Er ist zufrieden, wenn seine Wirtschaft
gedeiht. Von der ganzen Politik interessieren ihn höchstens die Steuern und
der Bau von Verkehrswegen. Dabei wird es auch noch so lange bleiben, wie der
Kolonistennachwuchs sich auf die herkömmliche Art in nicht allzu
großer Ferne ansiedeln kann. Erst wenn kein guter, freier oder billiger
Boden mehr zu haben ist, beginnt eine neue Entwicklung. Wie sie dann vielleicht
bei den südamerikanischen Deutschen verlaufen wird, kann man nach
einem ähnlichen Beispiel vermuten: dem der Buren in Südafrika.
Solange es dort möglich war, immer neues Farmerland zu bekommen oder
die alten Farmen zu teilen, wurden die Burensöhne auch immer wieder
Buren, und die Burentöchter heirateten Burensöhne. Als
aber - erst nach dem südafrikanischen
Kriege - das Farmland knapp wurde, gingen die jungen Buren auch in
höhere Berufe, wurden Juristen, Ärzte, Ingenieure,
Geschäftsleute u. dgl. Damit begann eine große innere
Stärkung des Afrikanertums holländischer Abstammung. Es gewann
seine eigene geistige und damit auch seine politische Zukunft. Bei den deutschen
Kolonisten in Brasilien können die Dinge sich mit der Zeit ähnlich
entwickeln. Eine Schwierigkeit wird freilich immer bleiben, daß selbst in
den drei Südstaaten das Deutsche niemals zur Mehrheitssprache werden
wird. Südafrika ist heute ein zweisprachiges Land, und öfters ist es
wichtiger, dort Afrikanisch zu verstehen als Englisch. Ein ähnlicher
Zustand, in kleinem Maßstabe, hat früher einmal in der Kolonie Blumenau
geherrscht. Man mußte Deutsch können, um dort zu
wohnen. Jetzt aber drückt die brasilianische Regierung auch in den
deutschen Siedlungsgebieten sehr stark auf die Kenntnis des Portugiesischen, ja,
möglichst auf Abschluß der Bildung in der Staatssprache. Eins
muß auf alle Fälle gesagt werden: Was auch kommen mag, die
Deutschen in Brasilien können und werden nie etwas anderes sein als loyale
brasilianische Staatsbürger. Jeder Gedanke daran, mit ihnen jemals in
anderer Weise rechnen zu wollen, wäre unsinnig.
Brasiliens großer Nachbarstaat im Süden ist Argentinien.
Die natürlichen Verhältnisse, Klima und Boden, hätten auch
hier eine deutsche Einwanderung begünstigt. Der soziale Aufbau des
Landes jedoch war und ist noch heute einer kräftigen Besiedlung
hinderlich. Argentinien ist zum weitaus größten Teil ein Land des
Großgrundbesitzes, [391] und die
Eigentümer der Latifundien ziehen es vor, sie in Person oder durch ihren
Verwalter zu bewirtschaften, anstatt Siedlungsland abzugeben. Daher konnte sich
in Argentinien auch nur ein verhältnismäßig unbedeutender
Mittel- und Kleingrundbesitz, so wie er für deutsche und überhaupt
für das Gros der europäischen Einwanderer gepaßt hätte,
entwickeln.
Es sind trotzdem zwei Versuche mit deutschen und auch
deutsch-schweizerischen Kolonisten gemacht worden. Der erste, in der Provinz
Santa Fé, fiel in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die
argentinische Regierung schickte damals einen Agenten nach Europa, der in
Frankfurt a. Main, Basel und Dünkirchen Sammelstellen einrichtete
und etwa zweihundert Familien, im ganzen tausend Menschen, ins Land brachte.
Es sollten fünftausend werden, aber inzwischen hatte die Regierung
gewechselt, und die neue war der Einwanderung nicht günstig. Die Kolonie
erhielt den Namen Esperanza. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gedieh
sie und sandte auch eine Anzahl von Tochtergründungen aus. Alle diese
Siedlungen sind aber heute im Begriff, ihr Deutschtum zu verlieren. Nur die
älteren Leute gebrauchen das Deutsche noch als Muttersprache. Die
mittlere Generation versteht noch Deutsch, bevorzugt aber auch im
häuslichen Gebrauch das Spanische. Bei den Kindern bildet Deutsch als
Muttersprache nur noch eine Ausnahme. Als ich im Jahre 1921 Esperanza
besuchte, konnte der Pfarrer der deutschen evangelischen Gemeinde unter einigen
vierzig Konfirmanden nur an fünf den Konfirmationsunterricht deutsch
erteilen; alle übrigen mußten in spanischer Sprache unterrichtet und
eingesegnet werden. Noch einige Jahrzehnte weiter, und das Deutsche wird in
Santa Fé so gut wie ausgestorben sein.
Günstiger steht es mit dem Deutschtum der seit 1878 nach Argentinien
eingewanderten sogenannten "Deutschrussen". Dies sind ursprünglich
deutsche Kolonisten von der Wolga und aus dem südrussischen
Schwarzerdegebiet, die von dort wieder auswanderten, als ihre Privilegien,
namentlich die Befreiung vom Kriegsdienst, unter der Regierung des [392] Kaisers
Alexander II. aufgehoben wurden. Die meisten, die Rußland
verließen, gingen nach Nordamerika. Andere hatten von Brasilien
gehört und wollten dorthin. Sie hatten Kundschafter vorausgeschickt, aber
als die Masse der Auswanderer in Rio Grande eintraf, erklärten
ihnen die Kundschafter, Brasilien sei kein Land für "deutsche Leute". Sie
hatten die Vorstellung, deutsche Leute könnten im Urwald, wo man erst
viel Arbeit mit dem Umhauen der Bäume hatte, nicht siedeln! Die russische
Steppe, die sie allein kannten, ist ja so gut wie baumlos. So benutzten sie ein
Angebot der argentinischen Regierung, die ihnen Land in der damals noch sehr
entlegenen und dünn bewohnten Provinz Entre Rios anbot. Dort sah
das Land ähnlich aus wie in dem ihnen zur Heimat gewordenen
Südrußland.
Nach einer mir brieflich mitgeteilten Schätzung des Leiters des Deutschen
Volksbundes für Argentinien, Professor Wilfert in Buenos Aires, wohnen
in der Provinz Entre Rios jetzt etwa 40 000 Rußlanddeutsche,
in der Provinz Pampa etwa 15 000. Auf kirchliche Versorgung,
evangelische wie katholische, wird gehalten, aber die Schulverhältnisse
sind mangelhaft; ungünstiger als bei den Deutschen in Südbrasilien.
Es gibt in Argentinien deutsche Vollanstalten und gute Mittelschulen in Buenos
Aires und Rosario (Mendoza kommt hier nicht in Betracht), aber sie werden kaum
von rußlanddeutschen Kindern besucht. Wir sehen ein kräftiges
Bauerntum, das sich der physikalischen und wirtschaftlichen Struktur des Landes
gut angepaßt hat, aber sein geistiger Horizont ist beschränkt, und es
bewahrt sein Deutschtum in der Regel nur dadurch, daß es sich in seinen
Siedlungen gegen fremde Einflüsse stark abschließt.
In jüngster Zeit haben sich deutsche Siedler mit gutem Erfolg in dem
Gebiet von Misiones niedergelassen: dem schmalen Zipfel argentinischen Gebiets,
der sich nach Nordosten zwischen den Paraná und den Oberlauf des
Uruguay hineinschiebt. Die dort von einigen Landgesellschaften ins Leben
gerufenen Kolonien sind nicht rein deutsch, jedermann, der will, kann dort Land
kaufen, aber fürs erste überwiegt deutscher Zuzug, der
großenteils aus Südbrasilien kommt. Der Boden in Misiones ist gut,
das Klima heiß, aber nicht allzu ungesund. Vor allem ist der Absatz durch
die Verbindung auf dem mächtigen Paranástrom nach den
großen Städten am Unterlauf gut. Es hat den Anschein, als ob sich
hier ein wohlhabendes, fast schon tropisches Siedlungsgebiet von vorwiegend
deutschem Charakter entwickeln wird.

[391]
Ankunft deutscher Kolonisten in der Siedlung Eldorado am
oberen Paraná (Argentinien).
|
Den eigentümlichsten Charakter im südamerikanischen Deutschtum
finden wir in Chile. Der Urheber der deutschen Kolonisation in Chile
war ein Ingenieur Philippi, der 1838 ins Land kam, als Major in chilenische
Dienste trat und dann für die chilenische Regierung Einwanderer in
Deutschland anwarb, hauptsächlich in Hessen. Die ersten Familien landeten
im August 1856 in Corral, dem Seehafen von Valdivia. Im ganzen kamen bis zum
Ende der 50er Jahre etwa siebenhundert Familien, dann hörte der
eigentliche Einwandererstrom auf. Vereinzelte Zuzügler kamen noch
später. Von diesen Einwanderern stammen die heutigen
Deutsch-Chilenen ab, deren Seelenzahl zwischen fünfzehntausend und
zwanzigtausend liegen wird. Die in Chile ansässigen Reichsdeutschen
bleiben hierbei, ebenso wie auch in Argentinien und Brasilien,
unberücksichtigt. Fast die gesamte deutsche Einwanderung konzentrierte
sich auf Südchile. Wer heute dort reist, mit der Eisenbahn, [393] im bequemen Wagen,
im Automobil, im Motorboot, der vermag sich nicht leicht eine Vorstellung davon
zu machen, wie es dort noch vor einem halben Jahrhundert aussah. Das ganze
Land war ein zusammenhängendes Waldgebiet, die Wege waren
Waldpfade ohne Brücken und Stege. Zuerst gab es drei Zentren: Valdivia,
Osorno und die Ufer des Llanquihue-Sees. Dies große, schöne
Wasserbecken liegt im Hügelland vor der Cordillere und erinnert etwas an
den Bodensee. Um den See herum haben sich die Besitzverhältnisse noch
so erhalten wie vor siebzig Jahren, als die ersten Kolonisten mit etwas Proviant
und Vieh, mit Axt und Pflug auf ihr Landlos in den großen dunklen,
feuchten Wald gesetzt wurden. In geschlossenem Kranz umgeben reiche
Bauerngehöfte den See, und auch in den Städtchen am Seeufer
hört man überwiegend Deutsch sprechen. Valdivia ist ein
blühender Industrieort mit etwa 30 000 Einwohnern geworden,
davon heute nur noch zehn Prozent Deutsche, aber alles, was hier an Gewerbe
existiert, haben die Deutschen geschaffen. Die Hälfte des Grundbesitzes in
den drei Südprovinzen ist deutsch. In Osorno fragte ich den Pastor nach der
Predigt in der Kirche, ob die Kollekte für die Armen sei? "Arme gibt es bei
uns nicht", war die Antwort!
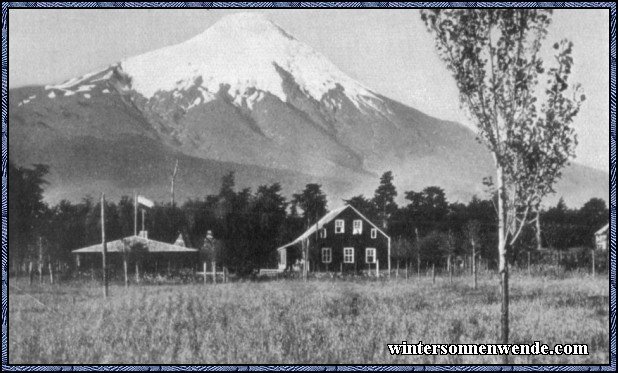
[393]
Deutsche Farm in Chile am Fuß des Vulkans Osuna.
|
Man merkt es beim chilenischen Deutschtum, daß die ersten Einwanderer
zum Teil einer wohlhabenden und entwickelten Schicht entstammten. Unter den
Führern waren verschiedene Akademiker. Eine gewisse
Abbröckelung zum Chilenentum und zur spanischen Sprache ist hier und
da unverkennbar, aber es ist auch noch viel deutsches Bewußtsein
vorhanden. An der Universität von Santiago besteht eine deutsche
Burschenschaft, deren Angehörige alle aus dem chilenischen Deutschtum
stammen. Auch das deutsche Schulwesen in Chile steht hoch. Santiago,
Valparaiso, Concepcion und Valdivia haben je eine Vollanstalt. In den
Oberklassen wird ein Teil der Unterrichtsfächer spanisch (wie in Brasilien
portugiesisch) behandelt, um den Abiturienten der deutschsprachigen Anstalten
die staatliche Abschlußprüfung in der Landessprache und damit den
Anschluß an das akademische Studium im Lande zu ermöglichen.
Außer in Brasilien, Argentinien und Chile gibt es in Südamerika
kaum ein nennenswertes Siedlungsdeutschtum. In Paraguay existieren deutsche
Niederlassungen, aber sie [394] sind unbedeutend. In
Pozuzo, auf der Ostseite der peruanischen Cordillere, existiert schon seit
fünfundsiebzig Jahren eine kleine, ganz isolierte Niederlassung von
Tirolern, die zu keiner wirklichen Lebenskraft gelangt ist. Ein ähnliches
Gebilde ist die Kolonie Tovar in Venezuela, die 1842 von Badenern aus dem
Breisgau gegründet wurde und jetzt etwa hundert schwer arbeitende, aber
deutsch gebliebene Familien zählt.
Außerhalb der beiden amerikanischen Kontinente gibt es kein
Übersee-Deutschtum von größerer Bedeutung, und namentlich
keins von größerer Zukunft - immer abgesehen von seiner
möglichen Entwicklung in den alten deutschen Kolonien. Sehr interessant,
innerhalb ihres kleinen Maßstabes eine ganz außerordentliche
Leistung, sind die Siedlungen der deutschen Templer in Palästina.
Die Tempel-Gesellschaft, eine religiöse Sondergemeinschaft auf
evangelischer Grundlage, zählt in Palästina etwa 3000 Mitglieder in
sechs Niederlassungen; dazu kommt noch eine siebente, kirchlich nicht
dazugehörige. Die Templer haben die blühende
palästinensische Orangenkultur geschaffen, sie haben die ersten
Straßen im Lande gebaut, Handwerk und Gewerbe belebt, Weinbau und
Bienenzucht in die Höhe gebracht. Ihre erste, 1869 gegründete
Siedlung bildet jetzt den deutschen Stadtteil von Haifa. Bis zum Weltkriege waren
sie auf wirtschaftlichem Gebiet der einzige wirkliche Kulturfaktor in
Palästina. Die nach ihnen gekommene zionistische
Kolonisation - ihre Geldquellen liegen überwiegend in Amerika, ihr
Ansiedlermaterial stammt meist aus Osteuropa und spricht den
jüdisch-deutschen Dialekt - hat viel von den Templern gelernt.
Auf dem Boden Südafrikas hat deutsches Blut an der Entstehung
des Burentums einen mindestens so großen Anteil, wie an der des heutigen
amerikanischen Volkes. Allerdings waren daran fast nur deutsche Männer
beteiligt, keine deutschen Frauen. Ein wirkliches Siedlungsdeutschtum entstand in
den vierziger Jahren in Natal. Dorthin wurden durch das deutsche Handelshaus
Jung & Co. gegen 200 Einwanderer gebracht, deren Nachkommen
sich deutsche Sprache und Art überwiegend erhalten haben.

[395]
Altes deutsches Farmhaus in Natal (Südafrika).
|
Einen größeren Maßstab hatte die deutsche Einwanderung im
östlichen Teil der Kapkolonie. Nach der Beendigung des Krimkrieges,
1855, stellte es die englische Regierung den von ihr angeworbenen deutschen
Truppen, hauptsächlich Hannoveranern und
Schleswig-Holsteinern, frei, als Kolonisten nach Südafrika zu gehen.
Mehrere Tausend machten davon Gebrauch. Die ihnen zugewiesenen Landlose
waren klein, die Regierungsunterstützung knapp, aber die Deutschen
setzten sich durch. Ihre Zahl wird jetzt in der Kapkolonie und in Natal zusammen
auf 20 000 Seelen geschätzt. Die meisten sind Farmer; die kleineren
Besitzer bauen Futtermittel, Obst und Gemüse zur Versorgung der
Städte. Der Krieg hat dem deutschen Charakter dieser Siedlungen einen
schweren Schlag versetzt. Die junge Generation ist großenteils im Begriff,
das Deutsche mit dem Englischen zu vertauschen. Deutsche Schulen wurden nicht
mehr eröffnet.
Bis zum Ausbruch des Weltkrieges konnte man auch von einem starken
Deutschtum in Australien, namentlich Südaustralien, sprechen.
Die deutsche Einwanderung dorthin geschah hauptsächlich in den
dreißiger und vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, und zwar waren es
Altlutheraner aus Brandenburg und Schlesien, die sich der vom König
verfügten kirchlichen Union in Preußen nicht unterwerfen wollten
und lieber mit ihren [395] geistlichen
Führern nach Südaustralien auswanderten. Dort bildete sich ein
großer deutscher Siedlungsbezirk, gegen fünfzig Ortschaften, mit
dem Städtchen
Tanunda als Mittelpunkt. Außer in
Südaustralien gab es stärkere deutsche Siedlungen auch in
Queensland. Die Deutschen führten den Weizenbau ein, verbesserten den
Weinbau und die Wollschafzucht und waren nach dieser Richtung hin wirkliche
Kulturpioniere. Man kann sagen, daß die Verhältnisse, wenn auch in
kleinerem Maßstab, sich ähnlich gestaltet hatten, wie in
Pennsylvanien im 18. Jahrhundert. In den Ortschaften wurde deutsch
gesprochen, in den Kirchen wurde deutsch gepredigt, es gab vier deutsche
Tageszeitungen und viele deutsche Klubs, und mancher Brite, der in den
deutschen Ortschaften aufwuchs, lernte deutsch lesen und schreiben.
Dies australische Deutschtum litt aber je länger, desto mehr unter seinen
endlosen kirchlichen Zänkereien, unter dem Mangel eines höheren
Schulwesens und der unausbleiblichen Hinneigung der jüngeren Generation
zum Englischen. Dann kam der Krieg. Die furchtbare Welle von Feindschaft, die
er über alles, was deutsch war in Australien, ergoß, offenbarte die
leider geringe innere Widerstandskraft in den deutschen Siedlungen, so daß
jetzt mit dem allmählichen Untergang ihres deutschen Charakters gerechnet
werden muß.
|