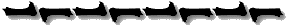|
[15] Der Ausbruch des Weltkrieges offenbart die "Humanität" der "Grande Nation" an den Zivilgefangenen Im Altertum galt jeder Angehörige des Feindstaates unbedingt als Feind und wurde danach behandelt. Rousseau, ein Franzose, war es, der den Grundsatz aufstellte, daß ein Krieg nur auf die Kämpfenden selbst beschränkt bleiben solle. Aber sein eigenes Land fiel im Weltkrieg als erstes in die Methoden des Altertums zurück. Man konnte begreifen, daß die fortgesetzten Niederlagen der Feinde Deutschlands im Anfang des Kriegs zu einer wüsten Spionenjagd auch in Frankreich führen mußten. Daß man dann aber alles, was deutschen Namen trug, auch Wickelkinder, Greise und hoffende Frauen einfing und einpferchte wie das Vieh, war doch im Grunde die Folge einer systematischen und maßlosen Hetze, die schon jahrzehntelang gegen die Deutschen getrieben wurde, ja ihre Anfänge bereits nach dem verlorenen Kriege 1870 hatte. Die Schuld also trugen die Leiter der französischen Politik, nicht das französische Volk selber. Im März 1915 veröffentlichten die Süddeutschen Monatshefte die Schilderung der Erlebnisse einer deutschen Lehrerin, die lange in Frankreich gelebt [16] und gewirkt hatte und bei Kriegsausbruch gefangengenommen wurde. Sie wurde nach ihrer Rückkehr in die Heimat auf die Wahrheit ihrer Angaben hin vom Auswärtigen Amt vereidigt.

Von Fanny Hoeßl in München. Wohl hatten die Bomben, die in Sarajevo geworfen wurden, auch in München die Herzen erbeben gemacht, doch – "das sollen die da unten unter sich ausmachen", dachte ich wie die anderen und schnürte sorglos mein Bündel zur lange ersehnten Ferienreise nach dem Süden Frankreichs, begleitet von meiner Schwester. Am 24. Juli traf ich in Lyon ein. Am nächsten Sonntag nachmittag blickte ich von Fourvière aus, dem berühmten römischen Hügel, hinunter auf das herrliche Stadtbild. In dieser Nacht erlebte ich die erste große Kundgebung gegen die Deutschen, die sich nun Nächte hindurch wiederholen sollte. Ich wohnte zwar in einer Vorstadt, und doch hörte ich mit klopfendem Herzen die gellenden Verwünschungen Stunden und Stunden hindurch: "Conspuez Guillaume! Guillaume à mort! A bas Berlin!" So heulte es ununterbrochen. Die Lampen schwangen mit der ungeheuren Tonwelle, die Saiten der Instrumente zitterten mit, im Telephon klang es nach: "Guillaume à mort!" So müssen die Verdammten in der Hölle fluchen. Scharfer Brandgeruch zog durch das Fenster und als ich es schloß, glühte es rot herunter vom Hügel la [17] Croix Rousse, dem Viertel der canuts, wie man hier die Seidenarbeiter heißt. Da brannten wohl die deutschen, die elsässischen Firmen lichterloh und ihre Besitzer verkrochen sich in irgendeinem dunklen Winkel. In den nächsten Tagen wurden beruhigende Plakate angeschlagen, auch die deutschen Sozialisten forderten ja die französischen Brüder auf, Frieden zu halten. Aber dann kam die Ermordung von Jaurès, dem Urheber dieser Plakate. Ich zögerte noch immer zu fliehen und meinte, wie alle, es würde noch alles anders werden. Am 29. Juli speiste ich abends voll froher Hoffnung in angesehener Gesellschaft mit mir zum Teil bekannten Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften, über deren Unwissenheit in politischen Sachen ich mich jedoch entsetzte. Ich stritt mir mit ihnen den Kopf rot – zu meinem eigenen Schaden, denn keiner dieser Herren hielt es später der Mühe wert, meine flehentlichen Bitten um eine warme Decke, um ein bißchen Wäsche, um eine kräftige Empfehlung zu beantworten. Nun packte ich aber mein Köfferchen. Über die Grenze waren wir ja gleich im Notfalle. – Aber die Rechnung war ohne den Wirt gemacht. Am Samstag, dem 1. August, war die Mobilmachung angeschlagen und zugleich in Riesenlettern die Aufforderung an alle Fremden, die Stadt zu verlassen. Beim Morgengrauen stand ich am Bahnhof mit meiner Schwester, nur mit einer kleinen Handtasche, denn jetzt war mir doch bang geworden. Hundertmal schon hatte ich rechts, links, von allen Seiten murmeln hören: [18] "Les Boches à la lanterne!" Vergebens wollte ich mich durchdrängen und in den Gepäckwagen kriechen. Man faßte mich ab und ein höherer Beamter knirschte: "Il fallait pendre l'avis au sérieux et partir avant!" "Quel avis? Welche Warnung? Will Frankreich den Krieg? Wer sonst?" – "Assez! Sie kommen nicht fort!" – Ich ahnte mein Schicksal, floh zu meinen Akademikern, die gerade von einem Zeppelin erzählten, der – man höre und staune – schon am 2. August über Lyon geflogen und von einem Blériot angegriffen war. Ein Ingenieur der l'École Centrale versicherte, der Zeppelin wäre glatt durchgeschnitten worden wie mit einem Federmesser, "comme avec un canif – ohne Kante". Ich wartete, ob einer der Herren da nicht widerspräche. Ich sah nur triumphierende Blicke. – Der Präfekt, intimer Freund dieser Herren, verkündete durch das Telephon den ersten Zug Gefangener. Und dies mit voller Wahrheit: Am ersten August hatte man in den Grenzdepartements der Vogesen alle Deutschen und Elsässer gefangengenommen, Männer, Greise, schwangere Frauen und Kinder, zwölfhundert an der Zahl, und nach Lyon verladen, wo sie bis zum 6. August hungernd und frierend in den Wartesälen liegen mußten, bis sie mit uns fortgeschleppt wurden. – Die Herren gaben mir für den Präfekten eine Karte, die mein Sesam sein sollte. Doch zunächst eilte ich am nächsten Morgen, dem inhaltsschweren dritten August, zu unserm Konsul. Der war geflohen, nur sein junger Sekretär ist noch da und versucht den Ansturm der verzweifelten Leute zu beschwich- [19] tigen. "Noch ist es Zeit, zu entkommen", meinte er, "aber machen Sie schnell, jede Minute kann Ihnen das Leben kosten. Um elf Uhr geht der nächste Zug nach Genf. Paris gibt eine Frist bis sechs Uhr abends." – Ich eilte zum Präfekten, und mit mürrischer Miene war er daran, mir einen Paß über die Grenze auszustellen, als Verwandte der Herren Lumière. Da kommt der Sekretär herein, und ich – die ich schon aufatmete – höre bestürzt folgendes Gespräch, leise getuschelt: "Soeben kommt Depesche von Paris. Alle Deutschen ohne Ausnahme beider Geschlechter werden verhaftet. Aber die Erklärung soll doch erst heute abend erfolgen?" – "Strenger Befehl! Hier sehen Sie!" – Man studiert die Depesche und der Präfekt sagt: "Und wenn Sie meine eigene Verwandte wären, Sie bleiben als Geisel. Doch ängstigen Sie sich nicht, es wird Ihnen ganz gut gehen." Heimgekommen, erblicke ich an der Apotheke, die unter meinem Zimmer liegt, eine Riesenaufschrift an dem gesperrten Laden: "Schließung der Apotheke wegen des Krieges. Wiedereröffnung am Tage des Kongresses von Berlin am 14. September." Am 4. August abends sind Plakate angeschlagen, daß die Fremden sich bei dem zuständigen Kommissariat zu melden haben. Mit meiner Empfehlung brauche ich nicht wie die anderen Landsleute stundenlang im strömenden Regen mich von der wütenden, teilweise trotz der Morgenstunde schon betrunkenen Menge höhnen zu lassen. Ich werde als erste gerufen. Der Kommissar bedeutet mir brutal, wie er meinen sauf-conduit unterschreibt: "Mei- [20] nen Sie nur ja nicht, daß Sie in die Schweiz kommen. O nein, Sie bleiben als Geisel in der Auvergne. Übrigens geht es Ihnen dort besser als unseren Gefangenen in Deutschland, denen man Beine und Arme abschneidet." (Schon!) "Das glaube ich nicht", behaupte ich fest. "Vous l'avez voulu!" schreit er da und wirft den Stempel so heftig hin, daß er in meinen offenen Schirm kollert. Das bemerken wir aber in unserer Aufregung nicht. Ich finde den Stempel erst später, als ich schon weit weg bin. Dieses corpus delicti hätte mir die Anklage des Hochverrats eintragen können. Verzweifelt patsche ich fort, rufe noch einmal alle hochangesehenen Persönlichkeiten zu Hilfe. Hatte ich doch vierzehn Jahre lang die Erziehung der Töchter aus vornehmen Kreisen beendet, ja sogar junge Offiziere auf Saint-Cyr vorbereitet. "Wir können Sie nicht retten", hieß es furchtsam und feige. Da packt mich der Galgenhumor. Die letzten Stunden der Freiheit will ich ausgenießen und die französische Stimmung studieren. Am nächsten Morgen, dem 6. August, um acht Uhr zwanzig Minuten, sollten die ersten Gefangenen abgeschoben werden. Der bestellte Träger ist um sechs Uhr da und versichert mir hoch und teuer, es ginge in die Schweiz, er habe es überall gehört. Man hat mich genarrt, denke ich in überquellender Freude, wie konntest du glauben, daß Frankreich so niederträchtig an harmlosen Reisenden handeln könnte? – Im Fluge ging es zum Bahnhof, dort packt mich eine Frau am Rocke. Sie führt ein junges achtzehnjähriges Mädchen an der Hand: "Sie [21] gehen in die Schweiz? Bitte, nehmen Sie sich dieser Waise an." Ich nicke zustimmend und schließe mich den anderen an, die daherhuschen von allen Ecken und Enden, viele mit zerschundenen Gesichtern und zerfetzten Kleidern, doch jetzt mit frohen Augen: "In der Schweiz würde man sich schon durchschlagen." Dennoch teile ich die Bemerkung des Beamten mit. Da sitzen wir nun in den Viehwagen und spähen durch die Ritzen hindurch, achtlos des Johlens, des Pfeifens, des Gezisches der tausendköpfigen Menge, die auf dem Bahnsteig sich drängt. – Bei St. Chamond macht die Bahn einen Bogen, rechts geht es in die Schweiz, links – woanders hin. Man atmet nicht mehr, bebend reckt man sich auf den Zehenspitzen, um durch die Spalten den Bogen zu erspähen. "Rechts", keucht einer. – Nein, es war links, und nun – "Gott verläßt keinen Deutschen", hört man eine Stimme vom dunkelsten Winkel des Wagens rufen. Man beruhigt die zitternden Frauen, schiebt eine Türe auf und vorsichtig läßt man die Kinderchen Luft schöpfen. Ach, da stehen an den Fenstern, an den Türen, hunderte von kleinen französischen Spielkameraden und jedes macht ein Fäustchen, so winzig auch das Händlein ist, das die Mutter zusammenballt. Überall dasselbe Bild, nur einmal, vor einem armen Pfarrhaus, zog tief den Schlapphut der greise Priester und grüßte die armen Gefangenen, die nicht wußten, wohin es ging. "Aber Gott verläßt keinen Deutschen nicht", wiederholte unser lustiger Sachse. Mit diesem Spruche schließt er jeden seiner Witze. Zu anderer Zeit hätten wir das wohl unpassend gefunden, aber [22] nun beschwichtigt er die nicht zu bannende Sorge mit kühlendem Hauche von oben. Der Zug hält von Zeit zu Zeit. Schweigsam steigen neue Gefangene ein, den Hut tief über der Stirn, lesen die Namen der Stationen. An den meisten hängt in Kreide gezeichnet der Totenkopf Wilhelms oder er baumelt am Galgen zusammen mit Franz Josef. Endlich, endlich, nach zehnstündiger Fahrt, verläuft sich der Zug im Gleise. Unsere Männer rollen selbst die Türen auf, über Gepäckstücke hinweg nehmen sie die Frauen und Kinder auf die Arme und lassen sie vorsichtig die hohe Böschung heruntergleiten. Soldaten stehen da, unbeweglich, mit finsteren, verbissenen Gesichtern. Wir sind in der Stadt Le Puy, an der Quelle des lieblichsten Flusses Frankreichs, der Loire. Auf dem Hügel rechts streckt die Riesenfigur des heiligen Josef wie beschwichtigend die Hand in die stille Bläue des Himmels; von einer anderen Bergesspitze lächelt Notre Dame de France, ihr segnendes Kind auf dem Arm, zu uns herab. Trotz des schrecklichen Augenblicks sehen wir staunend in die Gebirgspracht hinaus. – "Anstellen!" schrie es nun. Die ansässigen Fremden hatten Gepäck bis fünfzig Kilo mitnehmen dürfen. Ein einziger Wagen ist dafür da, die Frauen nehmen die Kinder auf den Arm, die Männer, von denen viele der harten Arbeit ungewohnt sind, schleppen Taschen, Bündel, Schachteln, oft nur schlecht geschnürt in der Eile der Flucht. Über eine Brücke geht es. Und – da steht uns das Herz still! Über die Ecke müssen wir biegen, wo der Abschaum der Menschheit sich staut. Es ist dasselbe [23] Gesindel, das später unsere Gefangenen so tierisch roh behandeln wird. Mit Hohngelächter wird jeder einzelne von uns gemustert, ein paar besonders Witzige verhängen schon jetzt raffinierte Todesstrafen über die Vorüberwankenden. Glücklich, wer da die Landessprache nicht versteht. "Warte nur, du mit deinem zarten weißen Fleisch, du wirst uns schmecken, wenn wir da oben Schweinskoteletten aus dir braten! – Der da sieht so kitzlich aus, den legen wir in einen Ameisenhaufen! – Wir zünden ihnen das Kloster an zur Freudenfeier über den ersten Sieg! Und diesmal siegen wir, hein, pioupiou?" "Sicher", ruft der Soldat und stößt mit dem Kolben auf, "surtout que nous sommes bien appuyés!" – Stolzes Frankreich, ist die einzige Hoffnung gegen deinen Feind die Hilfe der anderen? Wie in jeder Minute der Aufregung sind meine Sinne geschärft. Für immer sehe ich vor meinen Augen die gedunsenen Gesichter dieser Männer, die wahnsinnigen Gebärden dieser frechen Weiber, und Wort für Wort gellen ihre schamlosen Reden in meinen Ohren wider. Ach, deutsche Soldaten, rettet eure Frauen und Kinder vor solchen Bestien! – Die Gruppe verschwindet, wir erklimmen den steilen Hügel. Ich atme auf, der müde Arm wechselt das Gepäck, ein Herr stützt mich einen Augenblick, dann nimmt er einer blutjungen Mutter das Kindchen ab, so lange, bis sie sich den Schweiß und die Tränen vom Gesicht getrocknet hat. Sieben Tage ist das Würmchen alt. Heute morgen noch lag die Wöchnerin im Spital, nach einer schweren Geburt, die eine [24] Operation benötigte. Um sieben Uhr trat der Arzt an ihr Lager. Er schneidet ihr die Fäden der Wunde ab, impft sie und das Kind und zeigt auf die Straße. "Helfen Sie mir wenigstens das Kleine einwickeln und das Nötigste zusammenraffen", bat sie den Wärter, der verweigert es, bis er sieht, daß sie sich in der Verzweiflung mit dem Kind zum Fenster hinausstürzen will. Das erzählt mir die blasse Frau, während der Offizier eine Pause kommandiert. Wir sind so müde von dem Aufstieg, daß wir uns mitten auf dem Wege niederkauern, auf irgendein Gepäckstück, auf einen Stein am Weg. Neben mir weint herzzerbrechend eine totenbleiche Frau, auch ein ganz kleines Kindchen auf dem Arm, zwanzig Tage alt, mit dem sie in der Nacht, von wütenden Bauern verfolgt, vierundzwanzig Kilometer weit laufen mußte. Doch nun, nach zwei Stunden Wanderns, machen wir endlich halt vor einer hohen Mauer. Der Kopf einer alten Hexe wird sichtbar darüber. Man verlangt ihr die Schlüssel zum Tore ab. Sie findet sie nicht gleich, sie wußte nicht, daß Leute kämen. Die Ruine sei doch seit Jahren unbewohnt. – Die Tore klirren. Einen kleinen Hof durchschreiten wir, dann rasselt ein rostiges Gitter, wir treten in den zweiten Hof, in dessen Hintergrund uns ein mächtiger, fensterloser Bau entgegengähnt. – "In die Mitte", kommandiert der Offizier. Wir drängen uns zusammen – siebenhundert sind wir, wie ich später erfahre. Die Soldaten bilden mit aufgepflanztem Bajonett einen engen Kreis um uns. – Nun werden wir niedergemacht, denkt wohl zitternd [25] ein jeder von uns. – Lautlose, bange Minuten. Dann tönt wieder scharf die Stimme des Offiziers: "Et surtout point de pitié, au premier mouvement tuez les tous!" Unversöhnlicher Haß blitzt aus den Augen des Mannes, man sieht es ihm an, das Niederstoßen wäre ihm eine Lust gewesen. Doch das kommt vielleicht später. – Der Abend ist herabgesunken und man tappt sich in die Schlafsäle hinauf, im zweiten Stock, wo Frauen und Kinder einquartiert werden. Die Soldaten finden im Seitengebäude noch altes Stroh, denn das Kloster, eine Chartreuse, wurde manchmal bei Manövern benutzt, auch haben die vertriebenen Mönche die zerbrochenen Matratzengestelle zurückgelassen. Man drängt sich durcheinander in dem dunkeln Saal, hie und da flammt ein Zündhölzchen auf, eine vorsorgliche Mutter hat ein Stümpfchen Kerze mitgenommen, das erhellt nur spärlich den düsteren, unsäglich schmutzigen Raum. Die Kinder fingen zu weinen an, eine Frau windet sich am Boden in Geburtswehen, junge Mädchen flüchten in dunkle Ecken, denn schon haften gierige Blicke der Soldaten auf ihnen. Ich suche mit den Augen meinen Schützling, der mit tränenverschwollenem Gesicht neben mir herstolperte. Die Kleine lasse ich fürsorglich neben mich lagern. In der Nacht wird sie mit Gewalt weggeholt von den Soldaten, sie und manche andere. Obwohl man in den Kleidern liegt, hat der scharfe Morgenwind, der durch die fensterlosen Rahmen ungehindert streicht, die Glieder blau und starr gefroren, die Kinder haben die ganze Nacht geweint und geschluchzt, eins weckte [26] das andere, ein Säugling ist aber fast nicht mehr wach zu bringen. Mit blauen Lippen liegt er da, bleich und starr wie im Todesschlummer. Doch schon in den ersten Morgenstunden drängten sich die angsterfüllten Männer herein, nach ihren Frauen, ihren Kindern zu suchen und einer der Herren hat Rum bei sich, mit dem er das Kleine reibt und belebt. Warmes Morgensüppchen bekommt keines, ja, es fehlt an Trinkwasser und die Latrinen sind verstopft. Verschimmelte Brotlaibe liegen im Hofe auf schmutziger Erde, und beim Tageslichte gewahrt man so recht, in welch unheimliche Räume man uns gepfercht hat. Ein Nagel ist ein Schatz, ein Bund Stroh ein schwellendes Lager, wer gar eine Reisedecke besitzt, ist ein Fürst. Überall, wohin man sieht, das furchtbarste Elend, Hunger und Tränen. Und doch blicken diese armen Menschen heute froher als gestern. Das nackte Leben wurde gerettet, die tobenden Verwünschungen einer zügellosen Menschenrotte gellen nicht mehr an die Ohren, man darf in die Sonne schauen und kein blankes Messer droht in geballter Faust. Man lebt, man drückt die geretteten Kinder an die Brust und jeder Mitgefangene wird ein Freund. Alle sind wir gleich. Jeder hat eine schreckliche Geschichte zu erzählen, jeder wäre fast um ein Haar noch entkommen. Auf den kleinen Höfen flutet es durcheinander, denn wer nur konnte, flüchtete vor dem Gestank und dem Schmutz hinunter ins Freie. Unser juge de paix kommt an; von jetzt an soll er unser Herrscher sein. Wir haben viele französische Frauen unter uns, Gattinnen von Deutschen [27] und Österreichern, und ihr erstes ist es, dem Amtsrichter zu berichten über die schamlosen Auftritte der Nacht, deren Anblick sogar den reinen Augen ihrer Kinder nicht erspart wurde. Der Amtsrichter wirft sich in die Brust und ruft, "Un Français est incapable de ces choses!" Er selbst soll sich unseren Frauen und Mädchen gegenüber empörend benommen haben. Auch bei uns verging der erste Tag, der zweite, und noch hatten wir keinen Bissen im Magen, ausgenommen vom faulenden Brot dort in der Schmutzlache. Den Soldaten, es sind hundertfünfzig an der Zahl, wird ihre gamelle gebracht, Schweinefleisch mit Erbsen. Die Mütter schleichen heran, näher und näher. Hier der Soldat kann nicht alles essen; der eine meint wohl, ein bébé allemand brauche nur eine Kugel, aber die anderen lassen sich rühren von den blauen Guckaugen, und die Fingerlein lecken die Töpfe so blank, wie nie ein französisches Geschirr es war. Die Männer sehen heißhungrig zu von der Ferne. Am Abend kommt eine Kantine, die eine elende Wassersuppe um 25 Cents das Schüsselchen verkauft. Mir will sie trotz des Hungers nicht schmecken, denn ich habe meinen Bleistift verloren, der mit meinem wohlverborgenen Tagebuch mein größter Schatz ist. Ein Nachbar schenkt mir einen frischgespitzten, und glückselig kritzele ich noch beim letzten Tagesschimmer. Viele der Gefangenen haben mir bedeutsame Dinge erzählt, die ich frisch von ihren Lippen notiere, ehe die Zeit sie verwischt oder verrückt. Die Leute haben schnell mein Notizbuch bemerkt, sind [28] so ängstlich wie ich selber, daß ich es gut hüte, alles Merkwürdige teilen sie mir eifrig mit, damit ich es ja in Deutschland erzähle. Wir sind felsenfest überzeugt, daß wir Frauen freikommen, sobald die Mobilmachung vorüber ist, und vielleicht – ja, gewiß auch die Männer, denn Deutschland wird nicht dulden, daß man das Völkerrecht so verletze. Immer noch habe man vierundzwanzig Stunden Zeit gegeben, aber was für Deutschland eine unsühnbare Hunnentat wäre, für Frankreich ist es "une mesure nécéssaire". Der vierte Tag unseres Aufenthaltes ist ein Sonntag, der 9. August. Da kommt durch den Torbogen ein Karren mit Decken, ganz dünnen freilich, und der Fuhrmann will nur denen eine geben, die "Vive la France!" rufen. Tschechen und Welsche tun es auch. "Vive Hanswurst!" schreien die unseren, sie wissen schon, sie werden nun monatelang auf ein wenig Stroh oder auf dem Boden liegen müssen, und wenn sie klagen, wird man ihnen antworten: "Schiebt euch zusammen, das gibt warm." Und sie kriechen zusammen, hundert bis hundertzwanzig in einem Raum mit niedriger modernder Decke, durch die das Wasser sickert und herunterrieselt an den schwammigen Wänden. Die Haare tropfen nur so des Morgens, denn nur wenige können in der Nacht einen Schirm aufspannen; der meine macht die Runde bei den Frauen im Saal oben, wo ein ganzes Stück Himmel oder schwarze Regenwolke hereinguckt. Aber noch ist es Sommer, und nun hat gar zum erstenmal der Kantinenwirt ein warmes Essen um teures Geld hergerichtet. Es ist ein Tag [29] voll Aufregung. Eine Kommission ist da mit dem Präfekten, seinem Sekretär und dem Bürgermeister. In der Nacht des 2. August sind eine Menge grundloser Verhaftungen vorgekommen. Ich werde auch gerufen, zeige unsere Rundreisebillette und bestreite das Recht, mich als "Gefangene" zurückzubehalten. Da belehrt man mich nun, ich sei gar keine Gefangene, ich solle mich hüten, diesen Irrtum zu wiederholen. Ich sei interniert, voilà tout. Da meine ich, der größte Verbrecher werde nicht härter behandelt als wir. Ich beherrsche die "Phrase" wie ein französischer Journalist, und das wirkt. Man verspricht mir bessere Unterkunft, und der Bürgermeister zeigt sich besonders liebenswürdig. – Am 11. August erst wird etwas Ordnung geschaffen. Ein Dutzend Elsässer bekommen blaue Binden und dürfen nun die Napoleons spielen. Die Bedürftigen erhalten Blechmarken und zweimal des Tages, um elf Uhr und fünf Uhr, werden sie "gefüttert wie die Schweine", sagt ein Trentiner, "nur hätten es die seinen besser!" – Uns allen wird eine Ration Brot zugesprochen, das aber vier Wochen alt, hart und verschimmelt ist. Wir müssen, solange wir noch Geld haben, für die elende Mahlzeit zahlen. Der Wirt meint, wir sollten nicht klagen, denn sonst übernehme Fumet die Kantine, und dann würden wir was erleben! – Wir haben etwas erlebt! – Aus der Stadt dürfen Krämer herauf und bereichern sich in wenigen Wochen, denn sie verkaufen zu Wucherpreisen ihre Messer, Blechschüsseln, Handtücher, Seifen, was man eben auf Robinsons Insel braucht. Unsere Männer arbeiten, [30] was das Zeug hält, um Brunnenlöcher zu bohren und die Aborte, die je acht in einem Hofe liegen, zu richten. Man frage mich nicht, wie man sich bis jetzt beholfen hat... Ich selbst darf mit meiner Schwester und sieben anderen Damen ein Zimmer beziehen, das beste des alten Gebäudes. Es liegt als einziges im Erdgeschoß, und das Fenster, zwar stark vergittert, geht auf einen großen, verwilderten Garten hinaus. Ein einsamer Posten stapft unermüdlich und gelangweilt auf und ab. Mit diesen Wachen werde ich Freundschaft schließen, denke ich, doch zuerst sehe ich mit Staunen mein unerhört luxuriöses Gemach an. Es enthält einen Tisch, eine Schulbank, zwei Stühle, ein Katheder, den wir sofort in ein Waschkabinett umwandeln. Ja, sogar zwei Wandschränke können wir uns teilen. Ich mache ein Brett am Boden los und verberge meine Schätze: eine französische Karte, Briefe, Tagebuch und Geld. Wir putzen, stauben, wischen, zum erstenmal können wir uns waschen, und dann schließen wir Freundschaft mit unseren Zimmergenossen, eine Freundschaft fürs Leben, denn Leid kittet schnell zusammen. Da ist zuerst mit ihrer Tochter eine siebzigjährige Dame. Vier Nächte hat sie auf hartem Boden gelegen. Als sie mit uns ankam, schätzte ich sie auf fünfzig. Heute war sie schon um Jahre gealtert, als gebrochene Greisin verließ sie nach drei Monaten die Chartreuse. Da ist noch eine Ingenieursgattin, deren Mann nach Bordeaux von einer deutschen Firma geschickt war, ihr herziges Bübchen und endlich eine junge Französin, an einen Deutschen verheiratet, die in drei [31] Wochen ihr Erstes erwartet. Gleich uns liegt sie auf einem durchstochenen Untergestell, ohne Kopfkissen, ohne Leinentücher, nur mit einer harten Pferdedecke. Ich hatte den Soldaten Stroh gestohlen und meinen Taschenüberzug zu einem molligen Kissen damit ausgestopft. Das macht man mir schnell nach. Diese Nacht schliefen wir. Wohl krochen die Spinnen über Gesicht und Hände, aus allen Fugen tummelten die Mäuse herbei. Schnecken und Fliegen klebten an den Wänden, aber man war aus den Kleidern geschlüpft und konnte die Glieder dehnen, ohne an den Nachbarn zu stoßen. Um sechs Uhr wird Reveille geblasen, und eine Stunde später meldet sich auch der Arzt, der Geldjäger, wie wir ihn nennen. Unsere Wöchnerin hat ein Krüppelein geboren. Dolores haben es die Eltern nennen wollen, bald wird es des Lebens Elend nicht mehr fühlen. Wir haben noch viele Kranke, ja Schwerkranke. Der Doktor erkundigt sich, wer Geld hat, aber auch dem schreibt er nur hastig ein Rezept – die anderen können "crever", das ist sein und Herrn Fumets Lieblingswort, wenn es uns Deutsche angeht. Einmal windet sich eine hochschwangere Frau in Krämpfen während der Nacht. Ein Deutscher zahlt das Honorar und läßt den Arzt holen. "Einmal und nicht wieder", bedeutet man ihm, "on peut mourir sans moi." – Wie jeden Tag, gibt es auch heute einen Schrecken. "Alles in den Hof", heißt es. Hinter uns schließt man die Säle und Zimmer ab, wir werden zusammengetrieben, dicht auf unseren Fersen drängen sich die Soldaten mit dem Bajonett am Fuß. Wir haben wohl alle [32] denselben Gedanken, denn der Mann neben mir flüstert: "Nur keine Angst, sobald sie zielen, machen wir sie nieder." Aber wir werden nur einzeln abgerufen und nach Waffen untersucht. Wir haben keine, natürlich. – Doch – unsere Pulse klopfen zum Zerspringen. – Dann fliegt die Nachricht durch die Reihen, Rumänien sei Rußland in den Rücken gefallen – was erfinden wir in unserer Not nicht alles – und ich kann herzlich lachen, als ich einen Unteroffizier kommandieren höre: "Du X. gehst dort hin und du Y. stellst dich da her, aber eigentlich ist es mir egal was ihr Kerle treibt." Es ist wahrscheinlich derselbe, der mir in einer der nächsten Nächte folgendes Beispiel von Disziplin liefert. Unser Zimmer liegt an einem langen, hallenden Klostergang, und so höre ich, wie der Posten abgelöst wird, folgendes Gespräch: "Du mußt sagen, wenn ich dich ablöse: Qui vive? – Ach Quatsch, ich kenne dich doch! – Nein, das geht nicht, du mußt es sagen! – Eh bien! Qui vive? – Und was muß ich antworten? – Was weiß ich. – La France, l'Auvergne! – Eh bien, l'Auvergne, mon vieux!" – Wir sind, wie man weiß, in der Auvergne, einem uralten vulkanischen Gebiet, das sonderbare Gebirgsbildungen zeigt und viele Heilquellen aufweist. Der Auvergnate ist als beschränkt verschrien und zugleich als Biedermann bekannt. Erst die letzten Zeiten haben seinen gutmütigen, harmlosen Charakterzug verschoben und verschroben, und wenn er anno siebzig ein gemütlicher Gefangenaufseher war für unsere deutschen Soldaten, heute ist das anders, sehr oft [33] wenigstens. Der 13. August wird mir wohl für immer ganz besonders im Gedächtnis bleiben. Um sieben Uhr abends schon müssen wir uns auf unseren ächzenden Pfuhl niederlassen, kein Licht darf gebrannt werden, im Finstern tappen wir herum. Um acht Uhr kommt die erste Patrouille und hält uns die Laternen unter die Augen. Um einhalb zehn Uhr kommt die zweite Wache und tut dasselbe. Nun ist es wohl fertig, der Soldat hat die Türe zugeschlagen, die man von außen nicht mehr öffnen kann. Da, um Mitternacht poltert es von schweren Gewehrkolben. "Öffnen Sie, öffnen Sie sofort!" Wir schrecken auf. "Nein, nein", rufe ich entsetzt, "wir öffnen nicht!" Wieder hagelt es auf die Türe: "Öffnen Sie sofort oder Sie werden sehen!" – "Wir haben kein Licht, ich kann mich nicht ankleiden." – Da prasselt es, als ob die Türe zertrümmert würde, und nun reiße ich sie auf, im einfachen Nachtkleide, während meine Schlafgenossinnen in lautes, angstvolles Weinen ausbrechen. Da werde ich zornig, alle Furcht vor dem Offizier, dem begleitenden Elsässer und den zwei Soldaten mit den schußbereiten Waffen vergesse ich und rufe laut: Es wäre infam, kranke alte Damen zu erschrecken. Da kommandiert der Offizier: "Soldats, avancez et arrêtez cette dame!" – "Nein", schreie ich, "ich lasse mich nicht arretieren!" Und die Soldaten machen zwei Schritte vor, zwei zurück. Der Offizier wiederholt seinen Befehl, aber lauter und lauter rufe ich: "Und ich, ich lasse mich nicht arretieren!" Zum dritten Male wiederholt der Offizier seinen Befehl, aber die Soldaten finden es [34] wohl lächerlich, eine Frau im Unterröckchen zu verhaften. Und der Offizier sagt endlich drohend: "A demain!" – Morgen kennt er mich nicht mehr, philosophiere ich und beruhige die aufgeregten Schlafgenossinnen. Um acht Uhr morgens donnert es an unsere Tür abermals. Die junge Frau öffnet zitternd. Es ist dieselbe Gruppe wie gestern. – "Wo ist die Dame, die heute nacht geantwortet hat?" – Man stottert etwas. – Ich denke: wenn es nur das Leben kostet, was ist dabei? Und stelle mich. Wieder heißt es: "Soldats, arrêtez cette dame!" Da wende ich mich direkt an den Offizier: "Mein Herr, ich bin lange in Frankreich gewesen und kenne die Franzosen. Ich kann es nicht glauben, daß ein Offizier, un galant homme, Damen bei Nacht überfallen will. Das kann so ein Elsässer tun, wie der da, aber ich wiederhole es, kein Franzose. Ich appelliere an Ihre Ehre." Der Offizier lächelt, verbeugt sich und bittet, ich möge in Zukunft die Türe offen halten. Die Soldatenwirtschaft wird nicht besser mit seinem Abgang. Immer wieder verstecken sich die rohen Burschen in den Strohsäcken der jungen Mädchen, und unsere Männer müssen scharf aufpassen. Sehr peinlich ist es, wenn man in der Nacht krank wird, und man wird es oft, infolge der halbrohen Kartoffeln, Erbsen, Linsen, weißen Bohnen, die unser Abendessen bilden. Meine junge Frau bekommt Krämpfe und muß über den Hof zum Abort. Doch der Soldat läßt sie trotz allen Bittens nicht durch, da, sie kann sich nicht helfen, sie kauert sich vor ihm nieder, kommt voll Scham zurück und schluchzt nun [35] die ganze Nacht. Ich habe Angst, die ständigen Aufregungen möchten eine Niederkunft beschleunigen, man denke sich: ohne Licht, ohne Wäsche, ohne Wasser. Ich frage nicht viel und lasse von nun an den jungen Ehemann in unserem Zimmer schlafen, bis sie später ins Spital kommt. Auch schreibe ich an irgendeine Bekannte einen Brief, in welchem ich unsere nächtlichen Qualen sehr anschaulich schildere, so anschaulich, daß der Präfekt, der meinen Brief gelesen hat, das grausame Verbot aufhebt; aber immer noch begleitet ein Soldat bis dicht an die Türe des Abortes und macht seine Witze dabei. Sie sind gleich frech bei jungen Mädchen und älteren Damen. Am 15. August ist auch großer Feiertag in Frankreich. Wir haben Gottesdienst und die jungen Mädchen singen deutsche Lieder, was Fumet (Fumier – Misthaufen, wie er jetzt genannt wird) später streng verbietet. Die Kirche ist dicht gedrängt. Man weint ganz laut und auch einer alten Exzellenz neben mir, einem greisen Soldaten, rieselt es heiß über den weißen Schnurrbart. Sonst hält er sich tapfer, stößt nie eine Klage aus und verrichtet lächelnd jede niedere Arbeit; hat es sehr gerne, wenn junge Mädchen ihm dabei zuschauen, helfen aber läßt sich der alte Haudegen beileibe nicht, nur beim französischen Sprechen, das er jetzt lernen will, um die träge schleichenden Stunden, die sich ewig dehnenden, zu betören. Einige haben Bücher bei sich. Der Seminarist hat in einem Winkel, von den Mönchen her noch, eine Kiste alter Scharteken aufgestöbert, und [36] wie ich einmal durch den Schlafsaal der Männer wandere, sehe ich mit Staunen, wie sie alle – die deutschen Arbeiter wenigstens – wie die Männer auf dem Boden hocken oder auf dem Bauche liegen, eifrigst zu zweien, zu dreien, in einer französischen, englischen, italienischen Grammatik studieren. Stühle gibt es da nicht, oft kein Stroh. Man liegt auf dem Handköfferchen, wenn man es retten konnte, auf einer Schachtel, zwei haben sich in eine Kiste einlogiert und dünken sich was ganz Besonderes, versichern sie mir lachend. Heute scheint die Sonne warm und hat eine Menge Städter heraufgelockt, die uns durch das Gitter anstarren. Jeder von ihnen hat sicher schon viele Deutsche in der Nähe gesehen, hatte sie liebgewonnen und achten gelernt als gewissenhafte, treue Bürger, die das Land, das sie besiedeln, mit ihrem Fleiß und ihrem Können bereichern. Aber nun haben wir uns mit einem Schlag in ihren Augen verändert. Wir sind reißende Tiere geworden, die man mitleidlos behandeln muß. Das Gitter öffnet sich von Zeit zu Zeit und läßt Offiziersdamen durch, die hoch die seidenen Röcke heben, um durch unsere vor Schmutz starrende Kantine zu wandern. Sie treten in unsere Zimmer, ohne zu klopfen, ohne die Greisinnen zu grüßen, von denen die eine gestern ihr 84. Geburtsjahr feierte. Hochmütig streifen ihre Blicke unsere zerlumpten Lager, und dann bemerken sie fast vorwurfsvoll zu Fumet: "Aber die haben es doch sehr gut: da kann man ein Jahr hier aushalten." Und sie sehen doch Damen vor sich, vornehme Damen, deren Gruß zu erwidern [37] ihnen unlängst eine Ehre gewesen wäre. Oft noch wiederholt sich eine derartige Szene. Auch Damen vom Roten Kreuz besuchen uns, ohne die nackten Füße unserer Gefangenen zu sehen, ihre zerlumpten Kleider, ihr faulendes Stroh. Bitterkeit ergreift uns, als wir einmal einen Spottartikel auf die Deutschen lesen, groß überschrieben: "Trop de Bonbon, trop de chocolat, trop de fleurs." Man macht sich lustig über die Bayern – in Frankreich gibt es nur Preußen und Bayern – welche die ersten Gefangenen so rührend empfangen hätten! Ach, könnten diese Deutschen, denen die Tränen über die Wangen rollten über einen gefangenen Apachen, uns hier in unserem Bettlerelend sehen! Doch gibt es einen Bettler, der so arm ist, wie wir? Am 24. August kommen hier unsere ersten Gefangenen an, dreihundertfünfzig an der Zahl, und die Bauern, die uns die Milch bringen, der Apothekerlehrling, der uns Medikamente und gutherzigerweise auch andere Bedürfnisse verschafft, erzählen aufgeregt von ihrem Empfang in Le Puy. Sie sind meistens verwundet, und doch ziehen die Weiber die Schuhe von ihren Füßen und schlagen sie weich an den gebrochenen Füßen und Armen, und die Männer drängen durch die Soldaten und schlagen mit beiden Fäusten in die zuckenden Gesichter der Wehrlosen. Das erzählen mir die Leute, und ein anderer weiß schon, daß in Lyon unsere Toten nur mehr nachts begraben werden dürfen. Das Gesindel zerschlug die Leichenwagen. Mit eigenen Augen haben später arretierte Gefangene es gesehen, wie Weiber mit Messern auf [38] unsere Soldaten einhieben. Einem davon blieb die Klinge in der Schulter stecken, und die ganze Nacht vernahm man im Zuchthaus, wo die Armen zuerst untergebracht wurden, ihr Stöhnen, ihr Röcheln. Am Sonntag, dem 23. August, ist große Aufregung seit frühem Morgen. Der Besuch des Präfekten wurde angesagt, und man hofft und harrt. Die kleine Kapelle ist wieder gedrängt voll. Der Gottesdienst ist beendet und man wispert mir zu: "Schnell, der Präfekt ist da. Sprechen Sie." Ich bringe auch gleich unser Anliegen nochmals vor, und der Präfekt sagt er hätte meinen Brief an höhere Stelle befördert, in vierzehn Tagen kämen wir fort. Er wäre ja totfroh, uns loszubekommen, er kenne sich schon nicht mehr aus. "Übrigens, Madame, man behandelt Sie ja mit Menschlichkeit?" – "Nein, heißen Sie das Menschlichkeit, wenn wir auf dem Stroh liegen, schlechte Kost essen müssen, nur Mauern, Gitter, Gewehre sehen?" Er zuckt die Achseln. Unter uns war ein Münchner Maler, der unsere Ruine mit so duftigen Farben hinzauberte, daß jeder, der noch Geld hatte, begierig nach solch einem Kunstblatt haschte. Heute aber zeichnete er nicht, sondern besprach aufgeregt die Nachrichten, die man sich zuflüsterte. Die Deutschen schon auf dem Wege nach Paris, ganz Belgien erobert; daher also die drohenden Gesichter der Soldaten, des Offiziers. In einem heimlichen Streifzug hatte ich über meinem Zimmer eine Kammer mit alten Flaschen entdeckt. Den Fund teile ich den Männern mit. Das gab gute Munition im Falle der Not. [39] Es werden später noch "Spione" zugeführt, die mit Frauen und Kindern wochenlang in den schauerlichsten Zuchthäusern saßen, die man mit Fausthieben bearbeitete, um sie zum Geständnis zu zwingen. Es waren das Arbeiter, Dienstmädchen, halbwüchsige Burschen. Einer von ihnen, ein besonders stämmiger Bayer, war aufgefordert worden, sich vor dem Schlafengehen nackt auszuziehen. "Aha", dachte er, "mein Arbeitshemd ist ihnen zu schmutzig, da bekomme ich ein frisches." Und wie er so darauf wartet, kommen drei Polizisten, mit dicken Peitschen bewaffnet. Aber unser Stangel dreht buchstäblich den Stiel um, entreißt ihnen den Prügel und nun geht es an ein Dreschen, bis die drei halbtot zur Tür hinausfliegen. Am nächsten Tag kommt der Kommissär selbst mit drohender Miene. Aber unser Bayer besieht so bedächtig seine Fäuste, daß dem Herrn gruselig wird und er uns schleunigst den Mann zuschickt, der übrigens ein gutmütiger und äußerst tüchtiger Elektrotechniker von Fach ist. Als die anderen Männer nach Korsika verschickt werden, muß er zurückbleiben, denn ohne die deutschen Ingenieure und unseren Stangel bliebe die ganze Stadt Le Puy unbeleuchtet. Am 31. August lassen unsere Soldaten, seit einigen Tagen blutjunge Bürschchen, die es sehr wichtig haben, wohl absichtlich die Zeitung fallen. Wütende Artikel sind in allen. Die Schandtaten der Bayern stinken zum Himmel. Ist es so weit gekommen, daß die Franzosen nicht mehr das Pulver wert sind, sondern daß man sie einfach übers Knie nimmt und die [40] Höslein durchklopft? Norddeutsche fragen uns, ob so etwas den Bayern ähnlich sähe. Wir nicken dreimal ja und freuen uns diebisch, denn endlich werden die Franzosen mit ihrem hartnäckigen Gerede aufhören über die Bayern, die nicht mittun wollen in diesem heiligen Kriege. Solche Hiebe führt Bavaria! Auch in Reims sollen die Preußen sein. Da flüchten sich nachmittags die Frauen und Mädchen in den Schlafsaal, um den Rosenkranz zu beten, o ganz leise, damit uns Fumet nicht hört, der das Weihwasser fürchtet wie der Teufel. Zu was hat er einen Klumpfuß? Er hat es gewittert, beschimpft alle in den gemeinsten Ausdrücken. Nächstens will er uns die Kirche "emmerder". Heute kann es überhaupt niemand mit ihm aushalten. Er gibt zwei Schüsse durch die Fester der Küche, weil dort um acht Uhr abends Licht ist. Die Männer wollten die Kruste Schmutz vom Geschirr wegspülen. Ist er beschämt über den Auftritt? Er bricht in heftiges Weinen aus und sagt, die Deutschen hätten ihm zwei seiner Brüder in Belgien erschossen. Ein Herr drückt später sein Beileid aus bei Frau Fumet. Die blickt erstaunt: Ihr Mann ist einziger Sohn, hatte nie Geschwister, hat auch sonst keine Verwandten im Felde. – Fumet ist nicht der einzige, der sieht, was nicht zu sehen ist. Ein Offizier, der leichtverwundet vom Felde zurückkam, erzählte leidenschaftlich: mit seinen Augen hätte er es gesehen, wie die Deutschen ihre Gefangenen nackt an die Bäume binden und herunterschießen zur Übung. – Am 3. September sind die Männer besonders aufgeregt. Schnell, schnell, ich soll in den [41] Hof kommen; da steht ein Unteroffizier, und sein Regiment soll ich mir merken, 86. Infanterie. Er ist commis voyageur gewesen und erzählt, er sei noch am 8. August in Leipzig gewesen; er wäre durchgekommen, ses papiers étaient en règle, und er blickt verächtlich auf die Männer, die aufgeregt durcheinanderschreien, ihre Papiere wären auch in Ordnung gewesen und ich soll es ja erzählen "daheim". Das Ministerium ist in Bordeaux, erfahren wir dann, Bomben würden über Paris geworfen und ich schreibe mir aus der Zeitung eine sehr ergötzliche Notiz darüber auf. Der Polizist, der die Bombe konstatiert, nimmt folgendes Protokoll darüber auf: Par rapport aux saletés qu'on a jetées dans la ville de Paris, défense par ordre du Préfet, de les ramasser. (Was den Schmutz betrifft, den man in den Straßen von Paris geworfen hat, so verbietet der Präfekt, ihn aufzukehren!) Der Mann bekommt sicher eine Statue! Ein Zahnarzt hat sich heimlich eine Zeitung verschafft, wird erwischt und zu vierzehn Tagen Isolierhaft und vier Stunden täglich Peloton verurteilt, eine gefürchtete Strafe, die darin besteht, daß man unaufhörlich einen engen Kreis abschreiten muß, wie das wilde Tier den Käfig. Jeden Tag stehen solche Strafbefehle an der Mauer. Die Zeit hat bleierne Kugeln an den Füßen, man vertreibt sie sich, wie man kann. Einem unserer Bankiers habe ich eine Patience gelehrt. Er macht sie 57mal am selben Regentag. Aus meinem Zimmer hat man den Tisch genommen und alle anderen Bequemlichkeiten, auch darf kein Mann [42] unsern Gang betreten, selbst wenn es gilt, die kranke Frau, das kranke Kind zu besuchen. Da bestellt man mich heimlich in die Kantine, die uns Frauen, außer zur Tischzeit, verboten ist, und dort deute ich Handschriften in einem Kreis von verblüfften Zuhörern, bis Fumet kommt und wir auseinanderstieben. Gerne möchte ich auch seine Schrift haben als Kuriosum, aber er hat Angst vor meinen Hexenkünsten und ich bin ihm sowieso unheimlich, erklärt er. Man steckt mir seine Signatur zu, die man von einem Strafbefehl herunterriß, aber was interessiert mich schließlich dieser kleine Mann. Den Sedanstag verbringen wir in der Erwartung einer großen Heldentat; nichts dringt zu uns, und am 9. September wird uns sogar ein französischer Sieg von Montmirail angeschlagen. Der Sekretär des Präfekten kommt herauf. Ich werde gerufen, und das Herz pocht mir vor Freude zum Hals hinauf, als ich höre, meine früheren Schüler, nun hohe Offiziere, hätten meine Freilassung durch das amerikanische Konsulat bewirkt. Morgen dürfe ich fort mit meiner Schwester, aber nicht durch die Schweiz. Ich merke, es heißt vorsichtig sein, wie er mich fragt, wohin ich weiterzureisen gedenke. Nach Turin, sage ich. Wo ich mich dort aufhalten wolle? – In einem Kloster, bis ich eine Stellung fände. Gut, er wird die nötigen Papiere besorgen! – Wie ich hinauskomme, ist der Gang voll hin- und herwogender Männer, die sich durch die schimpfenden Wachen gedrängt haben. Die Kunde hat sich blitzschnell verbreitet, daß eine Deutsche fort darf. "Dann kommt die Reihe an [43] uns", leuchtet es hoffnungsfroh in all den feuchten Augen, in die ich blicke – hundert Hände strecken sich mir entgegen und hundert Lippen beschwören mich, ihrer zu gedenken in der Heimat. Jeder hat ein Zettelchen in der Hand, dem Vater soll ich schreiben, den Brüdern, aber vor allem der Mutter. Am nächsten Morgen trifft eine Depesche von Lyon ein, oder von Bordeaux, niemand dürfe fort. Das war eine zerschmetterte Hoffnung für uns alle! – Ich protestiere nach allen Richtungen hin – man unterschlägt die Karten – seit einigen Tagen dürfen wir keine Briefe mehr schreiben. Wir werden alle ganz tiefsinnig, denn neue Gefangene kommen täglich. In meinem Zimmer habe ich nun eine wunderhübsche junge Dame, welche bis jetzt einen permis de séjour hatte; bei einer Ausfahrt geriet sie in die Nähe von Lyon, wurde von der Seite der Dame weg verhaftet und zu uns geführt. Sie ist totenblaß, erschöpft, doch voll Hoffnung! Der Herr Oberst, bei dem sie ist, hat schon nach Bordeaux telegraphiert – trügerische Hoffnung! Am folgenden Tag wird sie auf den Genuß unserer Speisen – sie sind mit Viehsalz und in grünspanüberzogenen Kesseln gekocht –furchtbar krank, kalte Schweißperlen stehen auf der bleichen Stirn. Ich löse mit Gewalt ihre Hand, die die meinige umklammert und fliege zu der Schwester. Wir hitzen Wasser zu Umschlägen, wir kochen Tee, unsere junge Kranke beruhigt sich nach und nach. Am nächsten Morgen wird die Infirmerie geschlossen, der weinenden Schwester wird unter Strafe verboten, sich um Kranke zu bekümmern, ja, Fumet verdäch- [44] tigt sie in gemeinster Weise sittlicher Vergehen und nimmt ihr den Kochofen weg, den einzigen außer dem der Kantine – er braucht ihn für sich. "Man kann doch kein Spital machen für diese boches." Es wird schlimmer und schlimmer. Eine neue Zimmergenossin kommt bald darauf, ein Fräulein von Zamboni, Tochter eines österreichischen Generalmajors und trotz ihrer Jugend schon eine berühmte Bildhauerin. Sie fällt uns fast um den Hals, als wir mit mitleidigen Worten sie begrüßen. Sie hat "wahnsinnig" gelitten, erzählt sie. Auch sie hatte einen laisser-passer – wurde in Lyon ergriffen und mußte zwischen einer Dirne und einem Mörder die Straßen durchwandern. Nie wird sie diese Schmach vergessen, nie mehr wird sie jemandem in die Augen blicken können. Sie mußte mit dem Mädchen in demselben Zimmer übernachten. Und was für eine Dirne es ist, kann ich später sehen. Sie und noch eine andere sind mit uns eingesperrt, ebenso der Mörder, obwohl sie alle drei "Franzosen" sind. Auch unter unseren Elsässerinnen sind Frauen, vor denen man die Augen niederschlägt, aber da ist noch eine Riesenkluft zwischen Sünde und Sünde. Die schlechteste unserer Frauen weicht ihnen scheu, erschrocken aus. Einsam stehen sie am Fenster, abseits nehmen sie ihr Mahl ein und sie haben es bald dahingebracht, daß sie in das zuständige Zuchthaus kommen, wo sie ja auch ein Bett bekommen und nicht diese mörderische Kost. Gut, daß sie gehen, sie haben ekelerregende Krankheiten und schlafen Bett an Bett neben unseren reinen Mädchen. Einmal ihrer schauerlichen Gesell- [45] schaft entronnen, klagt sie nicht viel, obwohl ihre äußerst zarte Gesundheit bald angegriffen ist. Sie weiß sich Ton zu verschaffen und modelliert den feinen Kopf einer Mitgefangenen. Da steckt denn Fumet neugierig seine Glatze zu uns herein, und bald hat er es so weit gebracht, daß man ihn und seine unschöne Gattin ebenfalls knetet. Unserer Künstlerin werden Bettücher und ein Kissen geschickt, und sie darf nun die Mahlzeiten bei Fumet einnehmen, zugleich muß sie natürlich viele spitze Bemerkungen über den Krieg schlucken und die Karte wird gezeigt, wo jeden Tag Joffre einen engeren Kreis um die Deutschen schließt. Und am nächsten Tag oder doch "totsicher in der nächsten Woche" sie umzingeln wird. Wenn sie abends spät zu uns hereinschlüpft, frage ich sie jedesmal, was sie gegessen hat, das tut meinem hungrigen Magen wohl. Ach, die haben es gut! Nur die Reihenfolge der Speisen würde ich mir anders auswählen. Da hat es einen Abend Hammelkotelett, dann Forellen, dann Kalbskotelett, dann gebratene Hühner, Torte, Obst gegeben. Neulich hatte er eine Tafelrunde von zehn Personen mit Champagner traktiert. Und doch erzählt er indiskret, die Regierung zahle ihm seit Monaten kein Gehalt mehr. Er kann es sich leisten mit dem Gelde der Deutschen. Gestern noch hörte ich ihn laut im Gange zu seinem Schreiber sagen: "Jeden Tag bleiben mir 50 Francs übrig, so kosten diese Kerle der Regierung gar nichts. Und da habe ich noch 50 000 Francs in der Tasche, lauter Sparbücher, die sie in ihren Strohsäcken versteckt hatten. Immer noch ist Geld da bei [46] diesen Leuten." Pflichtschuldigst wird der Schlaumeier bewundert. Drüben bei seiner Gattin soll er ja seinen Zäsarenwahnsinn verbergen und äußerst kindlich sein. Allen Ernstes bildet sich der Mann ein, alle Frauen wären in ihn verliebt. Er ist auch sehr liebenswürdig für gewisse Sorten. Einer wirklichen Dame gegenüber benimmt er sich gemein bei jeder Gelegenheit. Er versichert, als Fräulein v. Zamboni ihm das äußerste Elend von einigen von uns vor Augen führt, er würde alles herbeischaffen, was man brauche. Da ergreife ich die Gelegenheit und bitte um ein paar Socken für einen Mann, der sich um sein bißchen Essen barfuß anstellen muß, und um ein Beinkleid für einen anderen, der sich nicht mehr seiner Lumpen wegen aus dem Stroh herauszukriechen wagt. Ich wußte es ja im voraus: es waren nur wieder schöne Worte. Und doch war gleich anfangs vom französischen Roten Kreuz gesammelt worden bei den sales boches, und staunend hatten die Damen die hohe Summe gezählt. Jetzt freilich haben wir kein Geld mehr. Mit Gewalt wird abgenommen, was über 20 Francs ist. Das andere kommt in Gewahrsam, jede Woche darf man wieder 20 Francs verlangen, muß aber davon sein Essen bezahlen, ob man es hinunterwürgen kann oder nicht, auch die Kranken, die gar nichts genießen. Als die Sequestrierung der deutschen Vermögen bekanntgemacht wurde, nehmen das alle, Männer wie Frauen, mit spöttisch-kühlem Lächeln auf: Deutschland wird uns alles zurückgeben! Nur eine Frau, deren Mann im deutschen Heere ist und die drei kleine Kinder [47] bei sich hat, weint bitterlich, weil man vor ihren Augen ihre Möbel verbrannt hat. Am 21. September wachen wir auf mit einer Schneelandschaft und steifgefroren unter unseren dünnen Decken. Wenn es doch wahr wäre, was gestern in einem durchgeschmuggelten Zeitungsausschnitt zu lesen stand. Die Schweiz verwendet sich für unsere Befreiung. Schon soll Deutschland 24 000 Mark für das Reisegeld erlegt haben, Österreich zögert noch. Hoffentlich nicht zu lange, sonst gehen wir zugrunde. Es klopft, und weinende Frauen treten in mein Zimmer. Vor einigen Tagen wurde uns ein großer Sieg verkündet, 150 000 Deutsche waren gefangengenommen, die Russen hatten sich nur von Wien zurückgezogen, weil dort zwanzig Cholerafälle vorgekommen wären, kurz, wir waren verloren. Da summten abends im Schlafsaal, als längst die Lichter gelöscht und die Wachen abgezogen waren, die jungen Deutschen die "Wacht am Rhein". Die Herzen waren so schwer, man mußte die Sorge vom Herzen sich singen, ganz leise, mit dem herrlichen Lied. Am nächsten Tag zeigte ein Elsässer es an. Vier Männer wurden mit gefesselten Händen gleich Schwerverbrechern ins Zuchthaus der Stadt geführt, und mit bleichen Lippen flüsterte man sich zu: "Wer weiß, ob sie je wieder dem Kerker entrinnen." Da baten wir Frauen nun so innig wir konnten, versprachen, einst an den französischen Brüdern in guten Worten und Taten heimzuzahlen, wenn man die unbesonnenen Jünglinge freiließe. Sechzehn lange Tage vergingen, bis sie zurückkamen. Dieser Jubel dann! [48] Ich habe ein Verzeichnis von all den kuriosen Strafen, die es in der letzten Zeit herunterhagelte. Ein Frauenkarzer ist auch eingerichtet worden, denn vier Tage, wer die schmutzige Wassersuppe nicht hinunterwürgt, vierzehn Tage, wer eine Zeitung liest, acht Tage, wer warmes Wasser verlangt und so weiter. Man denke sich unsere Wäsche. Jeden Tag reibt man sich ein Stück in der Waschschüssel aus und hängt sie im Zimmer auf, wo man wohnt zu zehn, zu zwanzig, zu hundert. Und wir haben Kranke und kleine Kinder. Bei diesen sind die Schafpocken ausgebrochen, und sie liegen nun mit den Müttern im sogenannten Kinderzimmer. Ich will einem kleinen Liebling Schokolade bringen und gehe hinauf. Da liegt in jedem Winkel ein zertretener Strohsack und darauf wimmern und weinen zwei, drei, ja vier Kinder, und die Mütter wiegen das Jüngste auf dem Arm. In der Mitte glüht freilich ein Ofen, aber es tropft durch die Decke, und in der Luft schwebt eine Wolke von dem Dunst trocknender Wäsche und verdampfender Feuchtigkeit. Diese Mutter hier mit dem zarten Töchterlein hat ja das Leben verwöhnt, kein Wunder, wenn sie so verzweifelt blickt, aber hier in der Ecke die Wäscherin weint auch voll Weh: "In der Nacht oft wecken mich meine Kinder und schluchzen: Mutter, wir wollen heim!" – Wenn wir nur wüßten, was draußen vorgeht! Aber seit den ersten Tagen vom Oktober haben wir andere Soldaten, ein Korse deklamiert ihnen die Zeitung, schauerliche Ansichtskarten gehen durch die Hände, keine Disziplin mehr wollen sie halten. Fumet schreit, [49] da drohen sie, erst ihn zu erschießen und dann uns in die Luft zu sprengen. Ich höre jedes Wort, das auf dem Gange gewechselt wird. Fumet meint, er wolle doch lieber von einer deutschen Kugel als von einer französischen sterben. Die Soldaten werden außerhalb des Klosters aufgestellt, keiner darf mehr herein, und nun übernehmen die Deutschen die Wache, was natürlich eine Besserung der Lage bedeutet. Ein neuer Zug von Gefangenen ist angekommen. Seit einer Stunde schon stehen 33 Frauen und Kinder frierend im Hof, in der bitterkalten Nacht; noch eine Stunde vergeht, bis man unser Tor geöffnet hat, und dann hallt Kinderweinen durch meinen Gang, man hört Getrippel über die Stiege hinauf. In einen völlig leeren, lichtlosen Raum werden sie geführt, mit schmalen Fenstern, fast an der Decke oben; ein Loch im hinteren Winkel dient als Latrine. Nach und nach kauern sie da, 72 an der Zahl. Eine unter den Frauen darf am Donnerstag den Besuch ihrer Mutter haben. Sie und ihre zwei Knaben winken ihr Lebewohl zur Luke hinaus. Das waren natürlich Signale für die Feinde. – Man denke, wir sind Hunderte von Kilometern vom Schlachtfeld weg. – Die Fenster werden sofort mit Brettern vernagelt; wer es wagt, sich bei dem Präfekten zu beklagen, bekommt 14 Tage Isolierhaft. Man will uns zeigen, wer hier Herr ist! – Bald sind wir die Herren, denkt man jauchzend, denn am 12. Oktober hören wir den Sieg von Arras und daß die ganze Einwohnerschaft als Geiseln weggeführt wurde, als Rache für uns! Spöttisch betrachten wir den Berg von Wolle, den [50] Fumet anfahren läßt und den wir für die Soldaten verstricken sollen. Da müßten schon die französischen Damen mitstricken, meinen wir; o nein, es könnte noch Wolle nachgeschafft werden. Das Stricken macht uns ja Freude, es schlägt die langen Stunden tot; wir haben die letzten Tage schon fleißig genadelt für unsere deutschen Gefangenen unten in der Stadt. Der letzte Zug von ihnen, höre ich, sei nach den langen Märschen so müde, so erschöpft angekommen, daß sie nicht einmal die Hand mehr heben konnten, als man ihnen endlich zu essen gab. Wir haben auch glücklich unsere Socken durchgeschmuggelt, und die gute sœur de charité läßt uns tausendmal danken: "Die deutschen Soldaten sind so dankbar und so geduldig", sagt sie, "und – hätten so reinliche Füße!" Sie hat jetzt viel zu tun, denn eine Masse Neger liegt im Spital mit recht ekligen Gebrechen. Die schwarzen Gentlemen sind sehr zimperlich und entkleiden sich erst, wenn man ihnen eine große spanische Wand vorstellt. Das Hospiz ist so überfüllt, daß man unsere schwerkranken Frauen zu uns zurückschicken muß. Zugleich mit ihnen kommt auch eine 75jährige Greisin an, eine Gräfin Waldern-Traunstein. Mehr als ein halbes Jahrhundert hatte sie die gütige Schloßherrin gemacht. Nun war die Dame halbblind und strickte den ganzen Tag mit den steifen Fingern Socken für französische Soldaten. Was für Verräterei wieder dahintersteckte? Eines Tages erscheinen zu früher Stunde schon die Polizisten bei ihr, nicht einmal ihr Morgenkleid darf sie wechseln. Zweiunddreißig Stunden weit wird sie geschleppt und [51] kommt bei uns mit ihren Hausschuhen an, mit dem Arbeitsbeutel, den sie vom Tisch aufraffte, als man sie überfiel. Sie hält sich tapfer, die alte Dame, und antwortet schlagfertig auf die Anbrüllerei von Fumet. Abends aber sah ich sie ohnmächtig auf unserem Gang zusammenbrechen. Zwei Frauen sind auch noch hinzugekommen, die ein entsetzliches Schicksal bei Mülhausen ereilte. Sie sind schon ganz alte Mütterchen, und ihre Männer waren zittrige Greise, den einen erschlugen die französischen Soldaten weil er, an einen Pferdeschweif gebunden, nicht schnell genug laufen konnte, den andern erschoß man, weil er zu klagen wagte über die Mißhandlung seiner greisen Gattin. Beides ist im ausführlichen Protokoll in Singen niedergelegt und kann von vielen Zeugen bestätigt werden. Sie sind ganz stumpfsinnig über all dem Entsetzlichen geworden, und nun kommt auch für mich ein Tag, der mich wie ein böser Traum bedünken will. In den letzten Tagen waren wir alle samt und sonders krank geworden, wie man später erfuhr, buk man täglich eine Dosis Gift in unser Brot, um uns langsam zu morden. Erst, als unsere Brotreste in der Stadt unten ebenfalls Vergiftungserscheinungen hervorriefen, aber erst nach Monaten, kam man dem Attentat auf die Spur. Die Männer wanden sich in beständigen Krämpfen, die Kinder bekamen dicke, aufgedunsene Backen, litten an Durchfall und Erbrechen, konnten kaum mehr von den Bettchen aufstehen, einige Frauen waren dem Tode nahe, unter ihnen meine Schwester. Da schrieb ich denn an den Präfekten, sagte gleich, wir wären mit vier- [52] zehn Tage Karzer bei der leisesten Klage bedroht, seien aber alle des Lebens müde; man solle uns die Mauer stellen, wir würden nur blinzeln, wenn uns die Sonne blende. Ich erinnerte an den höhnenden Artikel über die Schokolade und die Blumen, die man den Franzosen bei uns zuwerfe und verlangte, wenn nicht zarte Rücksicht, doch das Erbarmen, das man mit Verbrechern hat. Ich erwarte viel von diesem diplomatischen Brief, den ich durch eine Elsässerin heimlich abgeben lasse. An diesem 17. Oktober, nachmittags, ist es, als plötzlich zum Appell geblasen wird. Wie immer, stürzt man sich bang auf den Hof; da steht schon unser dicker Deutscher da, der immer mit einem Scherzwort unsere Briefe verlas, heute blickt er ganz verstört, er macht eine stotternde Einleitung und verkündet endlich, jemand habe geklagt, es sei ja wahr, alle wären wir krank, aber wenn das Essen daran schuld sei, nun, so hätte jetzt Fumet beschlossen, die Kantine ganz zuzumachen und es gäbe nun pure Wassersuppe mittags, pure Wassersuppe abends, die könnten wir auf dem Hofe essen. Fumet kommt, den Revolver in der Hand, zu mir: "Also Sie haben geklagt, sale petite bête, que vous êtes! In Deutschland schneidet man den Frauen Hände und Füße ab, und Sie wagen es, zu klagen? Was tue ich nur mit Ihnen? Wären Sie nicht eine Frau, ich würde Sie sofort erschießen!" Und nun eine Flut von gemeinen Beschimpfungen. Da klingelt es am Telephon von der Präfektur herauf. Fumet verschwindet, im Nu ist mein Gepäck, das schon auf [53] dem Gange stand, um mit mir ins Gefängnis zu wandern, wieder in meinem Zimmer, und ebenso schnell wird die Tür der Kantine geöffnet, denn man meldet, der Sekretär komme selbst, um wegen meines Briefes Rücksprache zu halten. Ich vergesse schnell die furchtbaren Stunden, die ich durchlebt habe, denn ein frischer Speisezettel klebt an der Wand. Anstatt der Linsen, Bohnen, Erbsen, denen man unsere Übelkeiten zuschrieb, sollen nun Reis und Makkaroni kommen. Als einzige Strafe gibt es an diesem Sonntag keinen Kartoffelsalat, der seit drei Wochen unser Feiertagsschmaus ist. Und das ist eine harte Strafe! Auf den Kartoffelsalat, den ein deutscher Koch nach gut deutschem Rezept anmachte, freute man sich die ganze Woche. Man aß ihn blank auf, wenn der Nachbar noch so hungrige Augen machte, man sprach noch am Montag davon. Und als einmal hart war, machten wir so betrübte Gesichter, als ob man uns wieder einen französischen Waffensieg an die Mauer gemalt hätte. – Heute war man nicht ganz so trostlos, denn Fumet hatte mir auf Befehl des Präfekten mitgeteilt, wir sollten uns gedulden, wir kämen schon in einigen Tagen fort. Da hielt ich Hof in meinem Zimmer, denn alles kam und holte sich Trost, obwohl man es nicht mehr recht glaubte, man hatte es schon so oft verheißen. Nun ist wieder eine Woche vergangen und man spricht nicht mehr von Befreiung, aber einer der unsern hat von seinem Brief die Marken abgelöst und darunter eine Siegesbotschaft entziffert: Die Russen sind geschlagen, nur die Serben kann man noch [54] nicht kleinkriegen! Da schmieden wir Kriegspläne, zeichnen in die Luft die sonderbare Bildung des Landes, das ich oft durchreiste; ich beschreibe diese phantastischen Gebirgswindungen, die immer wieder eine Kulisse vorschieben und wieder eine dünne Wand auftürmen, wenn man gerade die vorige niederpulverte. Die Herren Ingenieure erfinden Pläne, um die Hindernisse zu vernichten, und manche Stunde verträumen sie jetzt in Korsika, wohin man sie verschickte und nagen sich die Fingernägel blutig, daß sie nicht mitarbeiten dürfen als Pioniere an den verwegenen Riesenarbeiten, die Deutschlands erfinderischer Geist den andrängenden Millionen von Feinden mit immer neuem Wagemut entgegensetzt. – Die letzten Tage im Oktober bricht ein wahrer Wolkenbruch herunter und man spricht von Überschwemmungen, die nun sicher den zähen Feind vertreiben müssen. Eine halbe Million junger Soldaten marschiert an die Grenze und endlich werden die Deutschen sehen, warum man sie bis jetzt überhaupt "geduldet" hat. Unter den Karten, die Fumet seiner Bildhauerin schenkt, ist besonders eine, auf die er schmunzelnd zeigte; eigentlich sind es zwei Karten, die eine hat die Überschrift: Warum sind die Deutschen im Lande? An der unteren Ecke hält die Republika, leicht geschürzt, eine Angel, auf die sich die Deutschen blind hinstürzen. In der anderen Ecke schreitet bedächtig der russische Bär nach Berlin. Zweite Karte: Überschrift: Wie wir die Deutschen wieder hinausjagen: Republika kehrt den Stiel um, flugs sind die Hunnen wieder über die Grenze, [55] machen aber lange Gesichter, als der russische Bär ihnen in Berlin die Knute zeigt. – Lächelnden Antlitzes kommen unsere Verwundeten an, heißt es in den Zeitungen, gedrückt und traurig schreiten die deutschen Gefangenen einher. Das Letztere glaubt man gerne, wenn man weiß, wie schrecklich die Armen behandelt werden bis zu ihrer Einlieferung. Aber noch nie habe ich einen nur ganz leicht verwundeten Franzosen gesehen, der "strahlenden Auges" daherschreitet. Denn es ist eine wehleidige Nation, und nicht umsonst hat Molière in diesem Lande le malade imaginaire geschrieben. Fumet hatte auch Leibweh dieser Tage zu unserer großen Befriedigung, aber trotzdem ist er sehr neckisch aufgelegt. Er läßt um fünf Uhr früh Reveille blasen, für die Frauen. Ist es das erwartete Telegramm von Bordeaux? Die Kranken sogar tasten in der Dämmerung auf den Hof, aber es war nur ein Scherz und wenn man klagt, so wird er nächstens um vier Uhr blasen, und wer nicht erscheint, bleibt da. Ja, gibt es denn noch einen Schimmer von Hoffnung? Allerheiligen Sonntag ist es, und man denkt schmerzlich der fernen Gräber während der Totenmesse. Da, ein schmetternder Trompetenstoß, die Depesche ist da, morgen darf man fort, man muß nur einen Schein unterschreiben, in dem man erklärt, man gehe wirklich freiwillig fort. Montag in der Frühe werden unsere Köfferlein verladen. Die "Erbschleicher", wie sie sich nennen, kommen zu uns und erbetteln unsere kleine Habe, alte Handtücher, zerrissene Strümpfe, durchlöcherte Schuhe, sogar Schachteln sind Schätze, über die man [56] sich kindlich freut und tausendmal "Vergelts Gott" sagt. Mittags schon müssen wir uns im Hofe aufstellen, wahrscheinlich, damit die Männer sich nicht mehr mit uns besprechen können. Am Morgen schon hatten sie uns aufgetragen, dem Generalkommando mitzuteilen, daß sie zum tiefsten Schmerz ihres Lebens sich nicht an Deutschlands Siegeslauf beteiligen könnten; mein Notizbuch ist voll von Adressen ihrer Feldwebel, denen ich mitteilen sollte, was ihnen am Herzen lag. Um fünf Uhr sollten wir im Zug sitzen, der aber nur kleine Strecken fahren darf, wenn keine tobende Menge ihn überfallen kann. Fumet mahnt auch eifrig, seine Kantine auszukaufen, denn er wittert noch Geld bei uns; aber viele haben nicht mehr einen roten Heller seit Wochen. Trotzdem Österreich und Deutschland zusammen eine Summe von 50 000 Franken als Lösesumme erlegten, mußte man seine letzten Franken hergeben, um das Reisegeld zu bezahlen. Es wird uns aber doch ein kleiner Mundvorrat mitgegeben, und zwar will die Verwaltung noch ein schönes Bild ihres Edelmutes sich bewahren. Im Hof stehen weißgekleidete Köche um die Tische, auf denen Berge von Brot, Feigen und Birnen aufgehäuft sind, in der Mitte aber – als Glanzpunkt französischer Galanterie – eine kunstvoll geschichtete Pyramide von gebratenen Hühnern. Die durften wir anschauen, verkostet hat sie keiner von uns. So wurden wir photographiert. Nun fiel ein feiner Regen, vier Stunden war man auf den Füßen, man konnte nicht mehr stehen vor Müdigkeit, und die Kinderchen [57] fingen zu weinen an. "Ob man Bänke holen dürfe zum Niedersetzen?" – Das fehlte noch, crevez donc! hieß es. Da stellte man sich schon an und es ging zum Tor hinaus. Die Männer hatten alle Schranken durchbrochen und waren bis zum Dach hinauf geklettert; wir sind 200 Personen, einige zwanzig schwer Kranke oder schon über 65 Jahre alte Männer eingerechnet. Viele Frauen durften nicht mit, weil sie keine Papiere hatten. Ich besaß zwar nur meinen Fahrschein, aber mich fragte niemand, man war wohl froh, sich die ewige Klägerin vom Halse zu schaffen. Alle schleppten wir unser kleines Reisegepäck, schleppten schwer mit der einen Hand, zogen ein Kindchen hinter uns nach mit der anderen. Schon ist es dunkel geworden, und die Wege sind bodenlos. Die Kleinen fallen hin, können nicht mehr aufstehen, nun rieselt es gar noch dicht herunter, und wir machen ratlos halt vor einem Düngerhaufen. Doch dort quillt ein Lichtschein aus einem einsamen Häuslein und zeigt uns den Weg. Eine schwarzgekleidete Dame tritt vor die niedere Tür und breitet beide Arme unserm Zuge entgegen: "Meine Tochter, wo bist du?", ruft sie schluchzend. Die Frau mit den beiden Knaben bleibt in der Ferne stehen, sie darf ihr die Hände nicht reichen, sie darf ihr keinen letzten Kuß auf die Lippen drücken, man könnte ja zur selben Zeit ein verräterisches Wort in die Ohren flüstern. – Was wüßten wir zu sagen, wir, die wir seit drei Monaten die lebendig Begrabenen sind? Nur die Knaben umklammern die Großmutter noch, dann keucht man den Hügel hinauf, wo unsere Bahnwagen stehen. Die [58] Kinder sind viel zu erschreckt, um noch zu weinen. Nur unsere 84jährige Greisin bricht jetzt wie leblos zusammen. Da nehmen zwei Soldaten sie unter die Arme und tragen sie hinauf. Dann sind wir oben, man zieht uns in die Abteile hinauf, wir sitzen auf den Bänken, keuchen, zu Tode erschöpft. "Nun ist meine Kraft zu Ende", flüstert die 70jährige Dame mir gegenüber, "das war das Letzte, was ich geben konnte!" Und wir schließen beide die Augen. Als ob er auf sein Stichwort gewartet hätte, kommt da der Sekretär zu uns herein und kommandiert: "Alles aussteigen! Zurück in die Chartreuse!" Man starrt ihn an, die blassen Lippen zwingen sich zu einem Lächeln über den Scherz – nein, es ist keiner, er wiederholt noch einmal den Befehl, und zorniger ein drittes Mal, als er sieht, wir rühren uns gar nicht. Ein mitleidiger Beamter erklärt zögernd, Genf sei schuld, es hätte 5000 Mädchen von Savoyen aufnehmen müssen. – Diese 5000 Mädchen sind heute noch da! – Wie wir zurückkommen? Nicht um alles in der Welt können wir uns noch erinnern. Das Bewußtsein kehrt erst wieder zurück, als wir wieder vor unseren Mauern stehen, wo uns die Männer mit Laternen an der Aufgangstreppe erwarten. Sie nehmen uns das Gepäck, die Kinder ab, sie ziehen uns durch den Gang an Madame Fumet vorbei, die einen Leuchter hoch hält und höhnisch bemerkt: "Déjà de retour, Mesdames?" Wir kommen in unsere leeren Säle, wo nicht einmal eine Decke mehr die zerlumpten Lager verhüllt, und nun entfesselt sich eine Szene, wie man sie in einem Irren- [59] haus erleben kann. Zwei junge Mädchen schlagen eine gellende Lache auf, in die andere einstimmen, eine junge Frau bettelt herzzerreißend um einen Schuß Pulver, andere stoßen unartikuliert Laute aus wie gehetzte Tiere, zwei junge Mädchen liegen starr auf dem Stroh und rühren sich nicht mehr. Der Auftritt ist so erschütternd, daß sogar unsere Gefängniswärter Mitleid haben und herumeilen von Lager zu Lager. Bis zu den Ohren des Präfekten dringt es, und er gibt sein Ehrenwort, Mittwoch kämen wir dann sicher fort. Ein Ehrenwort, das muß ja wohl auch ein Franzose halten, das ist keine Lüge mehr! Doch bald heißt es nur: "Vielleicht!" Und dann verbittet man sich im Reinfall jede Träne, jede Ohnmacht. Wir halten uns tapfer, als man uns am Mittwoch wieder um zwölf Uhr anstellen heißt, wir starren mit brennenden Augen das Tor an, das um vier Uhr – vielleicht! – sich öffnen wird. Hat wirklich eine Minute nur sechzig Sekunden? Vier zeigt die Uhr und zwei Minuten – und das Tor geht nicht auf – doch, es öffnet sich weit, wir eilen hinaus, die Pfade sind zu Bächen geworden, wir achten es nicht, wir wissen den Weg jetzt, wir stolpern, wir fallen, wir raffen uns auf, wir sitzen im Wagen in nassen Kleidern und Schuhen, wir achten es nicht, denn die Lokomotive pfeift und in ununterbrochener Fahrt geht es der Schweiz zu. In St. Etienne überkommt uns noch ein Zittern, man beschützt uns mit einem Stacheldraht vor der sich andrängenden Menge. Am 4. November, nachmittags ein Uhr, sind wir in Genf. Und nicht wie Verbrecher und Diebe ziehen wir da [60] ein, nicht wie ein hungriges, schmutziges Bettelvolk: Wie Fürsten, die vom Exil heimkehren, empfängt man uns dort, etwa zwanzig Herren im Gehrock und weißer Binde. Manchen biederen Schweizer, der noch am Morgen sein Hetzblatt gelesen hatte, hörte ich murmeln: C'est incroyable – femmes agées, de tout petits enfants! Wohl senken wir beschämt die Köpfe, als wir so armselig durch die gaffende Menge wandern, aber in der Turnhalle, wo man uns empfängt, da kann man sich auf einen richtigen Stuhl, vor einen richtigen Tisch setzen, und abends in der Volksküche, da hantiert man mit einem wirklichen Besteck und hat blankes Geschirr vor sich. – Gibt es denn solche Dinge noch auf der Welt? Und jetzt kommt gar ein Herr und ruft, es gäbe ein nationales Gericht: Sauerkraut und Würstchen! Ich denke, die Ohren sausen ihm noch heute von unserm: Hurra! Was müssen aber die Züricher denken, daß wir da zum Abschied nicht unser Hoch schrien? Wir konnten keinen Laut herausbringen, so gerührt waren wir über die Aufnahme. In Zürich, da sind wir schon zu Hause, in unserer jubelnden Familie. Hoffentlich haben sie unsere nassen Augen gesehen! Die Reise von Genf an machen wir mit einem Zug Frauen, die gleich uns als erste aus der Gefangenschaft fort durften; sie waren in den Pyrenäen. Sie erzählen uns so schreckliche Dinge von durchgepeitschten Männern und sterbenden Kindern, daß wir uns stumm anschauen: Wir hatten es gut im Vergleich zu ihnen! In Singen erst sind wir frei. An der Schwelle des Gasthauses, wo wir uns stärken sollen, harren Hun- [61] derte von Menschen, Angehörige der Gefangenen. Eine alte Dame unter diesen bricht jetzt erst völlig zusammen, unter den Trostworten der ihren: Es war zu schwer, sie müssen daran sterben!"
 Die Angaben im letzten Teil dieser lebendigen Schilderung zeigen schon, daß es sich hier nicht um ein Einzelschicksal oder das von der Gruppe der Leidensgefährten allein gehandelt hat. Es sah in Frankreich allgemein so aus, und schlimmer noch. Dem deutschen Roten Kreuz gingen erschütternde Briefe zu. Der verdienstvolle Leiter des Münchener Roten Kreuzes, Dr. Johannes Dingfelder, gab in seinem Büchlein Rotes Kreuz München. Kriegsgefangenen-Fürsorge u. a. den Brief der Frau eines Ingenieurs wieder, den wir hier folgen lassen wollen. "Wir wurden bei dem Versuche, abzureisen, vom Bahnhof (in Paris) zurückgestoßen und unter Beschimpfungen, wie "sales Boches, sales Prussiens!" und dem höhnenden Zurufe: "Euer Wilhelm soll kommen und euch holen!" abgeführt. Der Mob zerstörte Cafés, Hotels, Restaurants und Läden, was nur einigermaßen auf deutschen Ursprung hindeutete. Dann kam die Verschickung in ein Zivilgefangenenlager. Wir wurden am 2. August vom Güterbahnhof in Viehwagen abbefördert. Man versprach uns gute Behandlung und Beförderung an eine neutrale Grenze nach Beendigung der Mobilisation, für die 21 Tage in Anrechnung gebracht waren. Aber welche Enttäuschung! Am Ziele ange- [62] langt, umstellte man uns, etwa 500 Personen, Männer, Frauen und Kinder, mit Militär mit aufgepflanztem Bajonett und brachte uns bei Mondschein in eine Reithalle. Der Boden, mit Stroh bedeckt, diente als Nachtlager. Alles schlief untereinander. Kinder von drei Wochen waren dabei. In der Halle verabreichte man uns eine Kartoffelsuppe – ungenießbar, dann Wasser und Brot. Das Wasser in einem großen Eimer, aus dem alles schöpfte, wer nichts anderes bei sich hatte, mit den Händen. Ich tat kein Auge zu, mein Mann schlief ein wenig. Ich war froh für ihn, denn es hatte ihn furchtbar mitgenommen. Früh um fünf Uhr war schon wieder alles wach. Um sechs gab es Kaffee, der ziemlich gut war. (Wohl aus Versehen! Dr. D.) Zum Waschen stand im Hof ein Sprengwagen, der immer tröpfelte, als Klosetts dienten fünf Waschfässer mit quer übergelegten Brettern, alles für beiderlei Geschlecht. Um sieben ging es wieder auf den Marsch, nach dem Schlosse. Denken Sie aber nicht etwa an eine saubere deutsche Kaserne, sondern alles stand im Zeichen des Verfalls und der Verwahrlosung, voller Staub und Schmutz, Spinnen, Mäusen, Ratten und anderen lieblichen Haustieren. Als Lager diente Stroh, kein Stuhl, kein Tisch, nichts; jeder erhielt einen Teller und Löffel, sonst nichts. Auch hier mußte sich alles durcheinander an einem Brunnen im Hofe waschen. Von Hygiene, wie in diesem ganzen Lande, keine Spur. Auch Decken mußten wir uns für teures Geld selber kaufen, mußten überhaupt alles doppelt und drei- [63] fach zahlen. Dann kamen wir in eine Schule. Die Frau Schulinspektor bewies uns ihre Antipathie auf alle mögliche Weise. So war zum Beispiel das filtrierte Trinkwasser abgesperrt, und man stellte uns einen Wasserleitungshahn, der mit Flußwasser der Loire gespeist wurde, zur Verfügung. Für die "sales Boches" gerade gut genug; für etwa 400 Personen zum Trinken, Kochen, Essen, Waschen ein einziger Hahn! Früh zum Waschen mußte man antreten! Selbstverständlich befanden wir uns unter ständiger Bewachung von Militär und Polizei. Der Polizeikommissar schikanierte uns auf alle mögliche Art und Weise. Dann wurden plötzlich alle Männer von 17 bis 60 Jahren von uns getrennt. Die Männer standen da mit verstörten Gesichtern, wir Frauen lehnten uns auf, aber gegen die inzwischen eingetroffene militärische Eskorte half kein Bitten und Jammern. Als sich die Tore hinter den Männern geschlossen hatten, lachte uns der Beamte aus und nannte uns "vieilles vaches", alte Kühe usw. Nach vierzehn Tagen wurden wir wieder fortgeschafft; der neue Kommandant hatte ein Herz im Leibe und gab uns endlich die Adresse unserer Männer. Diese hatte man in ein Fort gebracht, in finstere Kasematten mit nur spärlichem Licht und Luft. Meistens 50 Mann beieinander, ständig hinter Schloß und Riegel. Für die Bedürfnisse, große und kleine, stand ein Waschkübel im Gefängnis. Denken Sie sich den Gestank in solch einem Raum. [64] Dabei war über die Hälfte an Ruhr erkrankt... Gott sei Dank sind nur wenige, man sagt nur acht, gestorben. In Begleitung einer Wache mit geladenem Gewehr und aufgepflanztem Bajonett wurden die Männer täglich nur 25 Minuten an die Luft geführt. Endlich teilte man ihnen mit, daß sie täglich eine oder zwei Stunden auf einem Platze vor dem Fort spazieren gehen dürften, wenn sie aus ihrer Tasche eine Umzäunung in Höhe von 550 Franken bezahlen würden. Die Ärmsten mußten natürlich zustimmen und legten zusammen, nachdem sie vorher noch 65 Franken abgehandelt hatten. Bei ihrer Ankunft in X. sowie auf der Fahrt bewarfen vorüberfahrende Truppen und das Volk den Zug mit Steinen, Stöcken und verunreinigten ihn in nicht wiederzugebender Weise. Weiber kamen mit siedendem Wasser an, um unsere Männer zu beschütten. Der Polizeihauptmann in X. empfing sie, trotzdem er das Kreuz der Ehrenlegion trug, mit Ohrfeigen und Fußtritten, ließ ihnen Geld, Tabak, Rasiermesser, Taschenmesser usw. abnehmen. Wer eine Quittung verlangte, wurde mit Beschimpfungen und Bedrohungen zur Ruhe gebracht: "Laßt euch die Quittung von eurem Wilhelm ausstellen!" Die Nahrung war absolut ungenießbar. Suppen aus Wasser, Öl und faulen Kartoffeln! Der Souspräfekt konstatierte dies zwar öfter, aber es änderte sich nichts. Sechs Wochen lang hielt man [65] ihnen die Gepäcke vor, sie konnten nichts wechseln. Als man ihnen dann das Gepäck aushändigte, war alles zerbrochen und es fehlten für 22 000 Mark Gegenstände! Wenn eine Kommission kam, wurden sie alle spazieren geführt, die Kasematten gekehrt und gelüftet und jede Berührung mit der Kommission verhindert. Wer an die Gesandtschaft der Vereinigten Staaten reklamierte, wurde in ein finsteres Loch gesteckt bis zu vier Tagen. Darin stand das Wasser und wimmelte es von Ratten. Der Raum war vollständig dunkel. Das Brot mußten sie an einem Bindfaden an die Decke hängen, damit es die Ratten nicht auffraßen. Die Männer lebten fast nur von Brot und Wasser, welches aber auch nicht zulangte, da es in dem Fort kein Wasser gab; es mußte aus dem nächsten Dorf per Wagen herbeigeschafft werden. Für das Geld, das man ihnen abgenommen hatte, konnten sie später in der Kantine Waren schlechtester Qualität zu horrenden Preisen kaufen. Für Briefmarken, Postkarten mußten sie als Deutsche 10 Prozent Aufschlag zahlen, während es in den Zeitungen doch heißt, daß sie portofrei korrespondieren könnten. Endlich, am 10. Januar, kamen unsere Männer zurück, aber wie! Mein Mann hat 28 Kilo abgenommen, und alle sehen aus, wie aus dem Grabe auferstanden. Fremden Leuten, die unsere Männer vom Sommer her kannten, standen die Tränen in den Augen! Ich fürchte sehr, daß sie sich etwas für ihr ganzes Leben geholt haben werden. Hier [66] ist es insofern besser, als wir einen Hof zum Spazierengehen haben und einen freundlichen Offizier. Unsere Nahrung besteht nur aus Bohnen mittags und aus Reissuppe des abends, einen wie alle Tage. Jeden zweiten Tag gibt es 30–50 Gramm Kuh- oder altes Pferdefleisch. Früh Kaffee und genügend Brot. Den Kaffee erst seit Anfang Januar. Einrichtung: Stroh ohne Decken, kein Ofen, kein Licht! Trotzdem Decken aus Deutschland geschickt sind, haben nur wenige welche bekommen. Dies ist aber nicht die Schuld des Offiziers, sondern es ist dem Umstand zuzuschreiben, daß hier Elsässer, Polen oder Leute, die mit Französinnen verheiratet sind, die Posten als Zimmer- oder Etagenchefs bekleiden. Auch mit Liebesgabensendungen, die nicht direkt adressiert sind, wird große Willkür im Verteilen geübt. Durch dieses alles können Sie sich ein Bild machen von unserm Elend und was wir bis jetzt für Unkosten haben. Dabei zahlen die Banken an uns nichts aus, weil wir Deutsche sind. Möchten Sie die Güte haben, diesen Brief einer Zeitung zu vermitteln oder einem Wohltätigkeitsverein, damit man uns irgend eine Unterstützung zukommen läßt. Denn es ist beim besten Willen nicht möglich, jeden Tag Bohnen und Reis zu essen. Erwünscht sind uns neben Geld: Kathreiners Malzkaffee, Zucker, Kakao, Hartwurst oder geräucherter roher Schinken. Dies alles ist hier nicht mit Gold zu bezahlen. Im Namen der vielen Unglücklichen hier bitte ich, ein gutes Wort einzulegen. Ob sonst arm oder reich, hier ist alles [67] gleich bettelarm. Alle Sachen, wie Schuhe, Strümpfe, Kleider usw. würden hier große Freude bereiten und dringender Not abhelfen..."
 Ein deutsches Dienstmädchen erzählt über ihre Erlebnisse in Paris: "Mißhandlungen waren an der Tagesordnung. In unserer Nachbarschaft wohnte ein älterer Mann, ein Elsässer, der gewohnt war, früh gegen sieben Uhr von einem Milchgeschäft Milch zu holen. Am Tage nach der Mobilmachung nun lauerten ihm Leute aus der Nachbarschaft schon um sechs Uhr früh auf, schlugen ihn nieder und mißhandelten ihn derart, daß ihn Schutzleute forttragen mußten. Ich stellte mein Gepäck bei Bekannten unter und begab mich aufs Kommissariat. Man behielt mich gleich da und ich sah, wie anderen Deutschen, die sich eingefunden hatten, alles abgenommen wurde, ja sogar Hosenträger und ein Taschenkamm. Viele wurden geschlagen. Nachmittags um vier Uhr wurden wir vom Polizeirevier zum Depot III, Qai d'Horloge, gefahren. Hier mußten wir Frauen uns in Gegenwart des männlichen Personals vollständig ausziehen, ja, sogar die Haare wurden uns gelöst und untersucht. Dann wurden wir 120 Frauen in einen großen Saal gesperrt, der ausbetoniert und sehr kalt war. Acht Tage mußten wir hier bei Wasser und Brot ausharren. Nachts bekamen wir einen Strohsack ohne Decke. Die ganze Nacht hörten wir Hilferufe, denn man hatte die Kinder von den Müttern gerissen. Vielfach hörte man Schießen, und man sagte, es würden die er- [68] schossen, die keine Ausweispapiere hätten und als Spione angesehen würden. Die Schwester, die bei uns die Aufsicht hatte, forderte uns auf, für die französischen Soldaten zu beten. Unter den Gefangenen befand sich auch ein Mädchen, das ein Verhältnis mit einem französischen Soldaten hatte; dieser bewirkte schließlich, daß das Mädchen freigelassen wurde. Ein gefangener Ingenieur, Rheinländer, und seine zwei Söhne wurden als Spione bezeichnet und erschossen. Wir hörten früh um drei Uhr die Schüsse. Der Ingenieur hatte noch von uns Abschied genommen und gebeten, wir möchten seiner im Gebet gedenken. Die Schwestern bestätigten auch, daß die drei erschossen sind. Die Angst unter uns Frauen war so groß, daß zwei wahnsinnig wurden. Nach acht Tagen wurden wir nach Sables d'Olonne am Atlantischen Ozean gebracht. Wir wurden hier in einem halb verfallenen Kloster untergebracht, das vorher als Kaserne benutzt worden war. Drei Monate mußten wir hier unter den erbärmlichsten Verhältnissen aushalten. In der Frühe bekamen wir Kaffee ohne Milch und ohne Zucker, dazu ein Stückchen Brot, mittags einen Teller Suppe mit Kartoffeln, die man an Schweine verfüttert, abends wieder Suppe mit Kartoffeln. Ab und zu gab es statt der Kartoffeln Leber, die stinkend war und von uns kübelweise vergraben wurde. Manche, die davon aßen, wurden schwer krank. Ein Sergeant hatte die Aufsicht in der Küche. Auf Anordnung des Präfekten durfte bei der Zubereitung der Speisen kein Salz verwen- [69] det werden. Einer der Gefangenen hatte noch auf dem Kommissariat in Paris – wie ich selber gesehen habe – 2000 Frs., sein erspartes Geld, abgegeben. Als er weiterbefördert wurde, erhielt er nur 1500 Frs. Als er den Rest verlangte, erklärte man ihm: "Wenn Sie nicht zufrieden sind, erhalten Sie gar nichts und bleiben hier bei Wasser und Brot." Wir waren hier im ganzen, Männer, Frauen, Kinder, 1500 Gefangene. Viele Männer wurden nach den Kolonien verschleppt. In Sables d'Olonne durften wir kein Wort deutsch sprechen. Eine Ungarin, die die Wacht am Rhein sang, kam in Einzelhaft. Mit den Kleidern kamen wir sehr herunter, denn wir hatten nichts anderes, als was wir am Leibe trugen. Ich hatte wohl gebeten, man solle an die Bekannte, wo ich mein Gepäck untergestellt hatte, schreiben, aber es hieß, die sei verzogen, man wisse nicht, wohin. Von uns Frauen wurden viele geschlagen, am gräßlichsten behandelte man aber die Männer. Und wir Frauen mußten dabei zusehen, das setzte den Nerven fürchterlich zu."
 Als der deutschen Regierung die brutale Behandlung der Zivilgefangenen in Frankreich bekannt wurde, wandte sie sich in einer geharnischten Protestnote dagegen. Die französische Regierung antwortet hochfahrend, man gäbe den Zivilgefangenen Militär bei als Schutz gegen die Bevölkerung, das sei aber eigentlich gar nicht nötig bei dem "würdevollen Verhalten des französischen Volkes". Zur gleichen Zeit jedoch meldete sich ein Ankläger aus dem eigenen Lager. In der Guerre [70] sociale erklärte Gustave Hervé, daß die Geschichte von den Evakuationslägern kein Ruhmesblatt in der Geschichte Frankreichs sei, und er gab aus eigener Anschauung ein Bild von den Leiden der Zivilgefangenen, worin es hieß: "Die unglücklichen Opfer, Männer, Frauen und Kinder, wurden unter dem Johlen der Bevölkerung in Eisenbahnzüge gebracht und in die Waggons eingepfercht. In den für ihren Aufenthalt bestimmten Städten wurden sie zwischen zwei Reihen von Soldaten und Schutzleuten in Lokale geführt, wo nichts zu ihrem Empfange vorbereitet war und wo Männer, Frauen und Kinder wochenlang auf Stroh oder gar dem nackten Boden in widerlichem Durcheinander hausen mußten und wie Sträflinge behandelt wurden. Niemals wird man die Zahl der armen Kinder kennenlernen, die in diesen Zuchthäusern infolge des Elends und der Verwahrlosung starben. – Wie Vieh hat man die Deutschen behandelt bis zum letzten französischen Bahnhof!" Hervé riet dem Parlament, Maßnahmen für eine würdige Behandlung der Internierten zu treffen, "um den guten Ruf Frankreichs und die Ehre der Republik zu retten"! Die Ehre der Republik war längst dahin. – Dr. Baracs-Deltour, ein geborener Ungar, schilderte in seinem Buche Pariser Selbsterlebnisse die "Heldentaten" der Pariser Kriegsgerichte gegen die Spionageverdächtigen. Er war zu Anfang des Krieges als Dolmetscher bei einem solchen tätig gewesen und hatte manchen Unglücklichen aus den [71] Klauen der Richter, die ihre Urteile nach politischen Gesichtspunkten und "höheren Weisungen" fällten, gerettet, bis man ihn und seine ganze Familie, Frau und drei Kinder, dazu den Neffen und das Dienstmädchen als spionageverdächtig verhaftete. Dabei lernte er mit den Seinen zunächst das "würdevolle Verhalten" der französischen Bevölkerung kennen. Dann riß man die Familie auseinander und brachte sie in einem Zuchthaus unter. Jeder einzelne, auch die Kinder (acht, neun und elf Jahre!) wurde mit Erschießen bedroht. Während die Familie dann nach längerer Quälerei freigelassen wurde, verurteilte man ihn selbst unter erfundenen Anklagen – er habe durch seine Kinder Licht- und Drachensignale geben lassen – zu mehreren Jahren Zuchthaus. Dr. Barcas-Deltour hatte während seines langen Aufenthaltes in Paris vor dem Kriege viele einflußreiche Freunde gewonnen. Auch mit Briand und anderen Ministern war er befreundet gewesen. Er hatte sogar einen Orden erhalten. Als er verurteilt wurde, warf man ihm u. a. vor, er trüge diesen Orden, die "Palmen", unberechtigt (obwohl man sich doch in den Listen von der Rechtsmäßigkeit des Besitzes überzeugen konnte!). Alle seine früheren Freunde wollten nichts mehr von ihm wissen; sie verleugneten ihn geradezu. Er wurde den Bütteln übergeben und erst nach einem Jahr qualvoller Leiden "begnadigt". Dieser Ungar empfahl den Deutschen als Morgen- und Abendgebet das "Ceterum censeo" des Römers [72] Cato, der alle seine Ansprachen und Briefe mit dem Worte schloß: "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!" (Im übrigen ist meine Meinung, man müsse Karthago vernichten!) Jedenfalls könne Frankreich nach diesem Kriege nicht mehr als Kulturnation gelten. Die Deutschen, die aus Amerika herbeigeeilt waren, um ihrer Pflicht gegenüber dem Vaterlande zu genügen, die ihre Stellungen, ihre Besitztümer und Pflanzungen in den Vereinigten Staaten, in Chile, Peru, Britisch-Columbien, Kanada usw. verlassen hatten, erlebten auf der Überfahrt das tragische Geschick, daß sie von ihren Dampfern an der französischen Küste heruntergeholt wurden. So wurden die Dampfer "New Amsterdam" (aus Holland!), "Potsdam" und "Noordam" von Deutschen "gesäubert". Es waren insgesamt 4000 Mann, die den französischen Edelmut Wehrlosen gegenüber auf einem Kalvarienweg nach Brest erlebten, wo sie in den Kellern der Festung zusammengepfercht wurden. Die Fenster waren hier mit Eisenbahnschienen "vergittert", so daß nur Ritzen blieben, die kaum Luft durchließen – eine mittelalterliche Quälerei! Die Gefangenen mußten, um hin und wieder einmal frische Luft schöpfen zu können, abwechselnd an das Fenster treten und den Kopf gegen solch einen winzigen Spalt drücken. Die Elsässer, die an ihrem Deutschtum festhielten, haben ein geradezu grauenhaftes Geschick erlebt. Das erzählten die erschütternden Berichte der verschleppten Geiseln aus elsässischen Orten. Solche [73] Berichte fanden sich in Fülle in den Büchern der elsässischen Lehrer Michael Litschgy aus Thann (Les otages Alsaciens-Lorrains) und A. J. Lévèque aus Hartmannsweiler: Erinnerungen aus meiner Kriegsgefangenschaft, ferner des evangelischen Pfarrers Liebrich aus Maßmünster und des katholischen Pfarrers Vikar Gapp aus Lutterbach im Oberelsaß: Die Befreier! – Elsaß-Lothringen von den 'Befreiten' geschildert. Folgendes Erlebnis brachte am 14. September die Straßburger Post:

Von einer Dame aus dem elsässischen Grenzort Saales, die heute noch, nachdem sie auf deutsches Eingreifen hin aus der französischen Gefangenschaft befreit wurde, unter der ihr und ihren Leidensgenossen widerfahrenen Behandlung leidet, ist uns die folgende Schilderung übergeben worden, die, wie ausdrücklich bemerkt sei, nach den mündlich mitgeteilten Einzelheiten nach zu urteilen, die Wahrheit eher abschwächt, als übertreibt. "Es war der 12. August, als wir, meine Mutter, Schwester und ich, in Saales von französischen Gendarmen verhaftet wurden, unter dem Vorwand, ich hätte keine Erlaubnis von Frankreich, die Rote-Kreuz-Binde zu tragen und Verwundete zu pflegen. Die Rote-Kreuz-Fahne, die während der Anwesenheit deutscher Truppen in Saales gehißt war, wurde von der ersten Patrouille schon heruntergerissen, nachdem unser Haus, in dem noch ein schwer verwundeter deutscher Soldat lag, zwei Stunden erfolglos [74] bombardiert worden war. Es wurde nicht gestattet, das Nötigste mitzunehmen, man gab uns zwei Minuten Zeit, dann wurden wir mit aufgepflanztem Bajonett nach dem Rathaus gebracht, wo wir die Nacht auf Steinfliesen verbringen sollten; jedoch stellte uns der Bürgermeister Betten zur Verfügung. Am andern Morgen halb vier wurden wir mit achtzehn Beamten und Bürgern von Saales, wir Frauen auf dem Ochsenwagen, die Männer zu Fuß, vorerst nach Provenchère gebracht, wo wir in einem unglaublich schmutzigen Raum der Gendarmeriestation bis nachmittags auf den Fliesen saßen. Dann begann die Weiterfahrt nach St. Dié und damit der Leidensweg. Es ist mit Worten kaum anzuführen. Die unflätigsten Schimpfworte, Steine flogen uns an die Köpfe, die Weiber benahmen sich, wie ich es nie für möglich gehalten hätte, wütend verzerrte Gesichter, gemeine Gesten bot uns jedes Dorf. Unterwegs begegnete uns das ganze 14. Armeekorps, das nach Deutschland zog, und keiner sparte sich etwas. Von Disziplin keine Spur, sogar die Offiziere machten mit ihren Leuten gemeinsame Sache und beschimpften wehrlose Frauen. Wir konnten nicht durch, weil die Soldaten den Wagen nicht passieren ließen, und waren viertelstundenlang den gröbsten und gemeinsten Beschimpfungen ausgesetzt. Gegen acht Uhr zogen wir in St. Dié ein. Hunderte erwarteten uns vor der Stadt, jeder mit einem Knüppel oder sonst etwas bewaffnet. Bis wir in die Stadt kamen, waren es Tausende geworden. Der Aufruhr war unbeschreiblich. Auf einem Umweg, [75] damit das Volk seinen Spaß an uns haben konnte, wurden wir nach der Gendarmeriestation gebracht. Unser Gendarm war zu schwach, der Volksmenge zu wehren. Unsere Rettung vor körperlichen Mißhandlungen waren zwei elsässische Deserteure vom Reserve-Regiment 99, die begeistert in die Vive la France!-Rufe ihrer "Brüder" einstimmten. Nach einer Personalienaufnahme wurden wir zu Fuß in das Gefängnis transportiert. Hier angelangt, wurden wir Frauen in einem gemeinsamen Schlafsaal untergebracht. Ein Weib, ein Teufel in Menschengestalt, war unser Zerberus. Sie wollte uns die Kleider vom Leibe reißen, meiner Mutter den Ehering und die Ohrringe abnehmen, was wir uns aber doch energisch verbaten. Dann legten wir uns auf Maispritschen "zur Ruhe". Am andern Morgen gab es eine Suppe, die uns laut aufweinen ließ, drei Tage lang lebten wir nur von Wasser und Brot und schliefen. Unsere Hoffnung auf ein Verhör wurde zuschanden. Am 15. August, morgens 3 Uhr, erschien unser Zerberus: Raus, in zehn Minuten geht der Zug! Auf unsere Frage, wohin – Achselzucken. Vom Gefängnis aus ging's mit der Truppe unserer Bekannten aus Saales, zu denen noch einige französische Deserteure hinzukamen, zum Bahnhof. Und am Bahnhof, welche Überraschung, einige bekannte Gesichter deutscher Soldaten, die wir noch am Tag unserer Verhaftung im Sanatorium in Saales gesprochen hatten. Franzosen hatten das Sanatorium geplündert. Viele Verwundete waren bei unserem Trupp, der Rest, der nicht transportiert werden [76] konnte, wurde nach St. Dié ins Krankenhaus gebracht. Viele davon starben unterwegs, weil sie auf Leiterwagen transportiert wurden. Im Zuge erst erfuhren wir unser Reiseziel, die Festung Epinal. Ganze Arbeit, das muß man sagen, gegen wehrlose Frauen, "französische Courtoisie"! Das Gedränge war groß. Unsere Eskorte gab sich alle Mühe, die Angreifenden abzuwehren. Deutsche Frauen Kriegsgefangene! Das war ja auch eine Sensation, die sich keiner entgehen lassen wollte. Sogar Damen, die die Rote-Kreuz-Binde trugen, fanden sich ein; die Neugier siegte über das Feingefühl, und auch hier Beleidigungen. Pfui, das würde eine deutsche Frau nicht tun! Unterwegs auf jeder Station wurde der Zug gestürmt. Der Einzug in Epinal war verhältnismäßig ruhig, was wir zum großen Teil unserer Eskorte verdankten. Nach halbstündigem Marsch durch Epinal tauchte endlich unser "Heim" auf, die maison de la correction. Unsere deutschen Soldaten wurden sofort eingelassen, während wir Zivilisten der Volksmenge überlassen wurden, die uns auch gehörig zur Zielscheibe ihres Spottes nahm, bis sich endlich die Gefängnistüren hinter uns schlossen. Wir blieben 16 Tage im Zuchthaus, in einem unglaublichen Schmutz, ohne die geringste hygienische Einrichtung. Nach zwei Tagen kamen noch andere Frauen und Kinder, darunter eine Mutter von 14 Kindern, vier hatte sie bei sich, von den anderen wußte sie nichts. Die Leute wurden in ihren Häusern einfach in ein [77] Zimmer gesperrt, damit die Franzosen besser plündern konnten. Die Zeit in Epinal machte uns fast wahnsinnig. Die Wärterin erzählte uns jeden Tag die gräßlichsten Geschichten, wie die Unsern verlören und was für Greueltaten sie verrichteten, wie das ganze Elsaß schon französisch sei und vieles andere. Wir glaubten es ja nicht, denn durch ein kleines Loch in den grau gestrichenen Fenstern spähten wir jeden Tag, ob irgendwo Fahnen seien. Jedes Geschrei auf der Straße ließ uns erzittern, wir glaubten immer, es sei Siegesgeschrei. Es war eine böse Zeit für uns. Dann kam eine Lehrerin aus der Gegend von Saarburg. Das arme Wesen hatte Fürchterliches durchgemacht. Allein unter 30 Männern, wurde sie von der Menge besonders aufs Korn genommen und hatte dazu noch gemein gesinnte Eskorten, die sie fortwährend beleidigten. Sie atmete auf, als sie bei uns in Epinal in "Ruhe" saß. Wir ließen uns den evangelischen Pfarrer kommen, er war das erstemal ganz nett, beim zweiten Male schienen die Franzosen eine Niederlage erlitten zu haben, denn sein ganzes Wesen war Haß, der geistliche Firnis war abgefallen. Das ganze Volk ist ja voll Haß. Was wir alles hören mußten über den Kaiser und sein Haus, kann man nicht wiedergeben. So ging's Tag für Tag. Am 27. August, mitten in der Nacht, mußten wir uns eilends fertigmachen, von all den Frauen nur wir drei, und es ging wieder ins Unbekannte. Unsere Leidensgenossen dachten, in die Freiheit, aber damit war es noch nichts. Als [78] wir in die Halle traten, bemerkten wir eine Menge neuer Gesichter. Zu den Saaler Geiseln waren noch die aus der Gegend von Saarburg gekommen, darunter ein 86jähriger Mann und ein in den 70er Jahren stehender Herr mit einem schweren Beinschaden. Wir wurden hinausgeführt, und dann hieß es: Bajonette auf und laden! Und die Kerle luden so, daß wir glauben sollten, es gehe zu Ende. Sie sagten auch, wir würden füsiliert, das hatten wir aber stets die ganze Zeit her gehört, und es machte eigentlich keinen Eindruck mehr auf uns, wir waren immer darauf gefaßt. Am Bahnhof stand eine Unmenge Züge mit Flüchtlingen und Verwundeten. Es hieß, das sei alles die "Arbeit Wilhelms", und die Wut auf den Kaiser kannte keine Grenzen. Ein kriegsgefangener bayrischer Offizier, der in Epinal einstieg, sagte in einem unbewachten Augenblick zu meiner Mutter, wie es mit den Deutschen stehe, "Sieg auf der ganzen Linie!" Es war einer unserer schönsten Augenblicke im Leben, denn nach den Erzählungen der Franzosen war in Deutschland schon längst Hungersnot und Revolution. Was dieser Offizier über seine Behandlung von Baccarat bis Epinal erzählte, war fürchterlich. In Gray kam ein Offizier mit 20 Mann zu uns, der auch seit dem Tage seiner Gefangenschaft nichts zu essen bekommen hatte; den Leuten waren die Achselstücke und Knöpfe abgerissen worden. Offiziere kamen in unser Abteil und beschimpften uns auf die gemeinste Weise. Die deutschen Gefangenen, welche wir bei der Abfahrt von Paray-le- [79] Monial trafen, waren mißhandelt worden und waren teilweise in einem traurigen Zustande. Ein Mann hatte einen Beinschuß, der nach fünf Tagen noch nicht verbunden war. Die Leute waren teilweise kaum transportfähig; nirgends erhielten sie eine Erfrischung. Dann standen wir sechs Stunden im Bahnhof Moulins in glühender Sonnenhitze ohne Wasser, den Insulten der Menge preisgegeben. Gegen sechs Uhr fuhr ein endlos langer Zug mit seltsamen Gestalten ein. Auf den Dächern der Wagen standen verwegene Gesellen, halb nackt, und schwenkten die Trikolore. Es waren Apachen und Zuchthäusler, die als Ersatz für die schwarzen Truppen nach Afrika geschickt wurden. Wie die Katzen kletterten sie an den Wagen herunter und stürmten unsern Zug. Es war fürchterlich. Sie versuchten, die Türen einzuschlagen, Fensterscheiben splitterten; ein verwundeter deutscher Soldat wurde mit dem Kopf nach vorn aus dem Abteil gezogen und mißhandelt. Tausende standen da und heulten und schrien. Ein armdicker Knüppel flog in unser Abteil und verletzte uns. Wir drei Frauen allein... Und draußen dieses Geheul und diese Gesichter, der "Abschaum" der Menschheit. In jener Stunde haben wir das Fürchten gelernt. Wir bebten, bis für jene das Signal zur Abfahrt ertönte, dem sie nur widerwillig Folge leisteten. Gegen elf Uhr nachts langten wir in Clermont-Ferrand an, wo es unmöglich war, uns auszuladen. Tausende von Menschen belagerten den Bahnhof. So standen wir einige Kilometer vom Bahnhof ent- [80] fernt, bis gegen vier Uhr morgens zwanzig von uns mit einer starken Kavalleriebedeckung zum Militärgefängnis gebracht wurden. Die Behandlung war hier anständig; der Kommandant, ein Elsässer, verhörte uns und war empört, daß man mit Frauen und Kindern so verfahren war. Unser Lager war hier wieder Stroh auf Steinfliesen... In der Nacht wurden wir auf einen Truppenübungsplatz am Puy de dome gebracht, und hier – welcher Schreck! – bekannte Gesichter, Beamtenfrauen von Saales mit ihren kleinen Kindern, darunter drei Säuglinge. Meine Schwester, die aus Afrika in einem Sanatorium bei Saales zur Erholung geweilt hatte, war mit ihren beiden kleinen Kindern dort verhaftet worden, ohne das Nötigste für sich und die Kinder mitnehmen zu dürfen. Die Kinder waren dem Verhungern nahe, die Körperchen wund bis aufs Fleisch, das Baby von acht Monaten keine Windeln. Wie kann Frankreich solch unsagbare Brutalitäten verantworten! Außer den elsässischen Geiseln waren noch ungefähr achthundert Deutsche und Österreicher da, meist aus Lyon ausgewiesen. Eine junge Frau mit einem fünftägigen Kinde wurde mitgeschleppt und lag totkrank. Eine andere gebar oben und erwürgte das Kind, eine dritte erhängte sich und ihr Kind, wurde abgeschnitten und mit Fußtritten ins Gefängnis zurückbefördert. Aus dem ganzen Elsaß von Altkirch bis Saarburg waren Grenzbewohner mitgenommen worden, alle nur mit dem Nötigsten bekleidet. Die Männer teilweise schwer mißhandelt. Schuhe und Strümpfe wurden ihnen abgenommen [81] und verbrannt, die Knöpfe von den Kleider geschnitten. Der Arzt der Heilanstalt Lörchingen lag in Baccarat über eine Stunde bewußtlos von Mißhandlungen. Der Arzt des Sanatoriums Saale liegt in Clermont-Ferrand körperlich und seelisch zusammengebrochen im Spital. Diese Herren wurden alle gefesselt, zu je drei Mann abgeführt. Narben der Fesseln waren noch nach Wochen an den Handgelenken zu sehen. Ein Zahnarzt aus Thann lag in einer Baracke auf Stroh an einer Rippenfellentzündung krank ohne die geringste Pflege; selbst Milch verweigerte man ihm. Das Elend der Kinder war herzzerreißend. Auf der Reise gab es drei Tage und zwei Nächte nichts zu essen. Einige Mütter und Kinder wurden in einem Hospital in St. Dié untergebracht, das unglaublich schmutzig war. Die Kinder wurden ihnen abgenommen und bekamen saure Milch. Rote-Kreuz-Schwestern gingen während der Reise mitleidslos an ihnen vorüber. In den Baracken mußten die armen wunden Körperchen auf Stroh liegen... Im Bahnhof von Moulins begegnete uns die schwarze "Elitetruppe", die von französischen Offiziersdamen mit Blumen bedacht, ja umarmt und geküßt wurde! Wir wurden dann unter plötzlichen Höflichkeiten wieder im maison de la correction in Epinal untergebracht und von da im Lastauto zur Grenze geschafft, zur Heimat. Wir wurden mit Brot und Fleischkonserven versehen. Unterhalb Bruyères gerieten wir in deutsches Granatfeuer. Unsere Begleiter und die Chauffeure flüchteten in eine Scheune und ließen uns hilflos auf dem Felde [82] stehen... endlich brachten sie uns wieder drei Kilometer zurück in Sicherheit. Man forderte uns dann auf, die sieben Kilometer bis in die deutschen Stellungen zu laufen. Nach drei Kilometer Wanderung schlug die erste Granate in der Nähe in eine Wiese. Und nun ging's los ins fürchterlichste Feuer. Wir kamen nicht zur Besinnung, die Kinder schrien vor Angst. Zehn Meter von uns krepierte eine Granate. Gegen sieben Uhr passierten wir die letzten französischen Vorposten, die uns versicherten, daß im nächsten Dorfe deutsches Militär sei. Und nun ging's im Sturmschritt den Deutschen entgegen. Es waren unsere braven Bayern. Im Nu waren die Barrieren übersprungen, und ein einziger Schrei der Erlösung aus vierzig Kehlen ertönte. Den rauhen Männern standen auch die Tränen in den Augen. Wir fanden in einem Schloß Unterkunft, dessen Besitzer, ein Herr aus Straßburg, mit Frau und zwei Kindern erschossen worden war von den Franzosen. Die Leichen wurden von den Bayern noch aufgefunden und beerdigt. Am nächsten Vormittag ging's dann in deutschen Lastautomobilen nach Hause wo wir alles zerstört fanden; wir haben keine Heimat mehr...."
 Auszug aus dem Notizbuch des Johann Krippner, früher in Thann: "Thann i. E. Den 7. August sind die Franzosen in Thann eingezogen. Wir sind abends um fünf Uhr zu 83 Mann von Thann verhaftet worden und unter starker militärischer Bedeckung nach Rodern geführt. Den andern Tag ging es unter Gendarmerie- [83] bewachung nach Rodern, wo wir schon als Leichenräuber tituliert wurden. Abends um fünf Uhr per Tram nach Belfort, sind dort mit Fußtritten, Schimpfworten und Faustschlägen empfangen. Die Behandlung war eine äußerst schlechte. Dann Transport von Belfort nach Besançon. Hier wurden wir mittags zu dreien gefesselt, unter dem Hohn und Spott der Bevölkerung nach dem Bahnhof geführt. Auf der Fahrt wurden uns von Gendarmen unsere Wertsachen abgenommen, mit der Bemerkung, solche als ein Andenken aufzubewahren. Am 18. August, abends, kamen wir in Pareil-le-Monial an, von einer großen Volksmenge empfangen. Hier hat man uns die Knöpfe von den Kleidern gerissen, ja sogar die Hosenträger, die Halsbinde, Regenschirm und Schuhbänder hat man uns entrissen und alles verbrannt. Dann haben sie uns die Ketten von den Händen genommen und uns in einen Pferdestall getrieben unter unsäglicher Roheit. Das Brot, das sie brachten, warfen sie in den Mist und schrien: "Da, freßt, ihr Hunde!" Die Eheringe haben sie von den Fingern gerissen, wenn auch das Fleisch dabei mitgegangen ist, daran hat sich keiner gestört. Am andern Tag wurden wir wieder mit Viehketten gefesselt, und zwar so stark, daß das Blut geronnen ist. Dies war für die feingebildeten Franzosen ein freudiges Bild, und wir wurden so photographiert. So kamen wir nach Clermont-Ferrand. Auch in dieser Stadt zeigte das Volk seine Roheit, ja sogar die Gendarmen beteiligten sich daran, stachen [84] uns mit dem Säbel und dem Bajonett und schlug uns mit dem Kolben. Ist ein ein Mann gestürzt und hat nicht mehr weiterkönnen, ist er infolge der Fesseln von den andern mit weitergerissen. Die schlecht beleuchteten Straßen benutzten sie zu ihrer niederträchtigen Handlungsweise. Wir kamen dann in einem halb verfallenen Kloster an, und es war ein Glück, daß die Pforte sofort geschlossen wurde und von der heranstürmenden Menge nicht geöffnet werden konnte. Viele unter uns hatten unter der unmenschlichen Behandlung zu leiden; geblutet haben wir alle. Wir wurden gezwungen, auf dem Steinboden zu schlafen; wer sich aufrichten wollte, wurde mit dem Bajonett zurückgestoßen. Als Nachtessen bekamen wir die ersten drei Tage nichts wie Wasser und Brot und mußten nach diesem Festmahl wieder auf dem Steinboden schlafen. Ein Bürger aus Thann ist von den Ängsten irrsinnig geworden. Er ist in Issoire gestorben..."
 Die hochschwangere Frau des Kreisdirektionsboten Baumann aus Thann wurde mit ihrem 5½ Jahre alten Söhnchen durch französische Gendarmen festgenommen und mit den übrigen sogenannten Geiseln über Bussang und Belfort nach Besançon auf die Zitadelle gebracht. Tage und Nächte mußte sie mit den übrigen Gefangenen auf dem Hof der Artilleriekaserne verbringen. Als ihre schwere Stunde nahte und sie bereits von Geburtswehen befallen war, wurde sie von den Soldaten in einen offenen Kanonenschuppen geschleppt, wo sie auf Stroh gebettet und, von allen Seiten der [85] Zugluft preisgegeben, im Beisein von etwa vierzig Soldaten entbinden mußte. Sie erhielt keine genügende Nahrung, ihr Säugling keine Windeln. Trotzdem hat sie ihr Kind selbst gestillt. Mitleidige Frauen fertigten ihr aus Unterröcken Windeln und Hemdchen für den Säugling. Sie wollte ihn Wilhelm nennen lassen, was ihr aber verboten wurde; da nannte sie ihn Hermann. Ihr 5½jähriger Knabe wurde ihr schon in der Grenzstadt Bussang entrissen; sie hat ihn während der Gefangenschaft nicht wieder zu Gesicht bekommen. Als die Gefangenen durch Besançon geführt wurden, hatte sich mit einer ungeheuren Menschenmenge auch der dortige Bischof eingefunden. Er warf Äpfel, die er aus Kinderhänden nahm, auf die Gefangenen, klatschte in die Hände und schrie: "Bravo, merde la Prusse, mort à Guillaume!" Das wird auch von dem jungen Kaufmannssohn Senf aus Geweiler bestätigt. – Frau Baumann hat diese Angaben vor der Geheimen Feldpolizei im April 1917 in Kolmar gemacht.
 "Es ist immer und überall dasselbe", heißt es in dem erwähnten Buche der beiden elsässischen Geistlichen Liebrich und Gapp: Die "Befreier" Elsaß-Lothringens, "ob es sich um in Frankreich aufgegriffene harmlose Männer, Frauen und Kinder handelt, ob es verschleppte Elsässer sind, überall hören wir dasselbe: eine unsäglich verrohte Presse, die geradezu mit einer sadistischen Phantasie die Bevölkerung aufreizt, der keine Lüge zu gemein, keine Verleumdung zu niedrig ist, um sie gegen die [86] Deutschen zu schleudern. Man bekennt sich sogar ausdrücklich zu dieser Methode. So schrieb Gustav Hervé, vor dem Kriege radikaler Sozialist, in seiner "Victoire" vom 4. Februar 1918: "Alles, was dazu beitragen mag, die Einbildungskraft des Volkes zu rühren, alles, was zu dieser Zeit Zorn und Haß gegen Deutschland von neuem entzünden kann, muß getan werden." Getreu diesem Wahlspruch wälzt sich die Provinzpresse in abscheulichen Schmutzartikeln. Männer, Frauen und Kinder werden beschimpft, bespuckt und geschlagen. Die Lagerkommandanten überbieten sich gegenseitig in Hohn und Mitleidslosigkeit! Ein 72jähriger Elsässer, der vor dem Kriege Gutspächter in der Nähe von Luneville gewesen war, erzählt u. a.: "Wir wurden schon am 2. August verhaftet und gefesselt in Automobilen in Luneville herumgeführt. An allen Straßenkreuzungen und Plätzen wurde halt gemacht, und man verkündete: Seht, das sind die deutschen Spione, die werden morgen erschossen. Am Abend wurden wir in die Kirche von Ain gesperrt. Dort wurden zwei Mann einander gegenüber gestellt und mußten die Daumen aufeinanderlegen, die dann durch Daumenschrauben gefesselt wurden!"
 Wie es in den einzelnen Konzentrationslagern zuging, schildert das Gutachten Meurer an Hand der deutschen Denkschriften, von denen die erste mit den bezeichnenden Worten beginnt, es sei zu berücksichtigen, daß Frankreich, das Land, das sich so viel auf seine Zivilisation zugute tut, offen- [87] bar von Gesundheitspflege und Reinlichkeit keine rechte Vorstellung habe und daß daher Organisation und Ordnung nicht mit demselben Maß gemessen werden kann wie in Deutschland. In Angers waren die Gefangenen wochenlang in Zeltlagern untergebracht, in jedem Zelt, durch das Wind und Wetter freien Zutritt hatten, 50 Personen, Männer, Frauen, Kinder. Am Boden sammelte sich das Wasser; nach vier Wochen wurden kleine, alte Kartoffelsäcke zum Zudecken verteilt. Strafen waren übermäßig hart, Dunkelarrest bei Wasser und Brot, ein Schweinestall Arrestlokal. In Périgueux waren 540 Deutsche in den Schuppen und Arbeitsräumen wie in der Autogarage einer alten, baufälligen Perlenfabrik untergebracht. Die Fensterscheiben waren zerbrochen, das Dach undicht, in das oberste Stockwerk regnete es hinein. Die Aborte waren nur durch Vorhänge abgesperrt, so daß ein entsetzlicher Gestank herrschte. Schlafen auf dem bloßen Zementboden, erst später gab es wenig Stroh, das zwölf Wochen nicht gewechselt wurde, naß, faulig und voll Ungeziefer war. Die Aborte waren vier Löcher im Boden, mit einer Unratsgrube darunter, für die über 500 Menschen. Es gab vorzugsweise ungenießbare Leber, aber auch Büchsenfleisch, nach dessen Genuß Vergiftungserscheinungen eintraten. In Les Sables d'Olonne waren die Abortverhältnisse ähnlich wie in Périgueux, von denen noch berichtet wird, daß den Gefangenen beim Betreten der Verschläge, die für Männer wie Frauen gemeinsam waren, die Jauche [88] entgegenlief. Zum Reinigen dieser widerlichen Löcher wurden hauptsächlich auch gesellschaftlich Höherstehende herangezogen, die auch den Unrat der Wachtmannschaften zu entfernen hatten. Jeder Beschreibung spottete das Essen hier. Das Fleisch, das es gab, war ekelerregend und ungenießbar. Eingeweide, Milz, Herz, Lunge, Leber wurden gekocht, nachdem verschiedentlich ganze Klumpen Eiter herausgeschnitten waren. Das Brot anfangs steinhart und verschimmelt; als es später frischeres Brot gab, war es mit Mehlwürmern durchsetzt. Der Kommissar Materne machte mit Vorliebe Kontrollen, wobei er den Frauen ins Gesicht leuchtete und Bemerkungen dabei machte. In Bouttez-Gache hausten die Gefangenen in einem ausgeräumten Asyl, die meisten mußten auf den Korridoren, eine Anzahl sogar im Freien schlafen, ohne Stroh. In St. Pierre lagen 1200 Leute in einem baufälligen Seminar, dessen zerbrochene Fensterscheiben nicht ersetzt wurden. Dabei wurde nicht geheizt. In Carcassonne war das Brot ungenügend, in den Bohnen und Erbsen fanden sich Würmer; die Kost war absichtlich unzureichend und ungenießbar, damit man sich die Zusatznahrungsmittel kaufen sollte. Ratten- und Mäuseplage herrschte hier, wie übrigens fast überall. Die jungen Mädchen mußten ihre Haftstrafen im Wachtlokal verbüßen; geschlechtliche Vergewaltigungen, an denen sich auch der Direktor und ein Leutnant beteiligten, waren die Folge. Pferdefleisch bildete in sämtlichen Lagern die Regel; in Rodez war es wieder- [89] holt schon in Verwesung übergegangen. Geklagt wurde allgemein über die ekelerregende, widerliche Art der Zubereitung des Essens; man fand Seife in der Suppe, die in grünspanhaltigen Gefäßen gekocht war, so daß sie ganz grau war. Bohnen und Kartoffeln waren häufig nicht gar gekocht; man fand Steine in der Reissuppe, die nach Karbol, Petroleum und Schimmel schmeckte. In Camp d'Avrillé gab es "Hundereis". Alle diese Angaben sind später in Deutschland unter Eid gemacht. Der Verwalter in Rodez hatte auf seinem Zimmer große Mengen von Konserven, sagte aber: "Lieber lasse ich sie hier verschimmeln, ehe ich sie euch dreckigen Deutschen gebe." In Annonay wurde beobachtet, daß eine Bütte, die sonst als Nachtstuhl in den Gängen benutzt wurde, in der Küche zur Aufnahme von geschälten Kartoffeln diente. Auch hier wurde geklagt über Würmer in Gemüsen und Hülsenfrüchten, über Seife, Steine, Schmutz und Grünspan in der Suppe, die hier, wie sonst auch vielfach, mit Soda zubereitet war. Solche und ähnliche "kulturellen" Zustände fanden sich in fast allen Lägern, wie auch in Saintes, in Mongazon (wo die Gefangenen vor ihrer Abreise dazu aufgefordert wurden, ein Schriftstück zu unterzeichnen, in dem dem Präfekten der Dank für die gute Behandlung ausgesprochen wurde); in Saumur, Le Puy, Le Vigan, Ville Franche, auf dem Ponton bei Marseille, in Dijon, Lucon, Pontmaru, Brive und Pontmain. Ein düsteres Bild wird auch aus Casabianda berichtet; in Château d'Anne wurden die [90] Kranken in der Syphilisstation des Marnehospitals untergebracht; der Besen, mit dem man die eitrige Watte und die Verbandsstoffe auffegte, diente auch dazu, den Speisetisch abzufegen. "Bei all diesen Schweinereien", so fährt das Gutachten wörtlich fort, "gehört es aber zum guten Ton in Frankreich, jeden deutschen Gefangenen – wie in den Aussagen immer wieder festgestellt wurde – mit "sale boche" (dreckiger Boche) und "cochon" (Schwein) zu titulieren. Und es muß wiederholt werden, daß sich auch Ärzte und Schwestern daran beteiligten. – Das sexuelle Moment tritt ganz besonders hervor, und Vergewaltigungen und Notzuchtsversuche wurden von Schwarzen und sogenannten gebildeten Franzosen verübt. Aus der Fülle des Beweismaterials sei hier nur einiges hervorgehoben: Die Berichte des Notars Reiffel aus Altkirch im Elsaß, des Professors Kannengießer in seiner Broschüre: "Leidensfahrten verschleppter Elsaß-Lothringer, von ihnen selbst erzählt", und namentlich die Berichte des Grafen Pückler, Oberleutnant der Reserve und Legatationsrat a. D., die alle die französischen Grausamkeiten in ruhiger, sachlicher Weise und darum um so eindringlicher und beweiskräftiger schildern. Von den in Frankreich zu Beginn des Krieges zurückgehaltenen und aus Elsaß-Lothringen verschleppten deutschen Zivilpersonen befanden sich am 1. Februar 1917 noch 5913 Männer, 315 Frauen und 218 Kinder, im ganzen [6446] Personen, in französischen Lagern. [91] Die Vereinbarungen wegen Austausches der Zivilgefangenen waren von der französischen Regierung nicht eingehalten worden, so daß deutscherseits Repressalien ergriffen werden mußten. Selbst auf dem Heimtransport zum Austausch fanden noch Roheitsdelikte statt. Tagelange Eisenbahnfahrten bei Winterkälte in ungeheizten Zügen, schonungsloses Antreiben bei Fußmärschen, mangelhafte Ernährung und andere fahrlässig oder absichtlich herbeigeführte Mängel bildeten den Abschluß der Leiden in den Interniertenlagern Frankreichs. Wie kennzeichnete sie Hervé?
"Wie Vieh hat man die Deutschen behandelt bis zum letzten französischen Bahnhof!" |