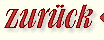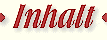|
 Politische Prozesse im Ausland Der Kairoprozeß 1934 Zwischen dem Kairoprozeß und dem Reichstagsbrandprozeß besteht insoweit ein innerer Zusammenhang, als der politisch-publizistische Kampf, der aus Anlaß dieser beiden Prozesse ausgetragen wurde, unter denselben politischen Gegnern stattfand. Man erklärte, daß der Kairoprozeß ein Reichstagsbrandprozeß in verbesserter Auflage sein sollte, und zwar vor einem internationalen Gericht, das im Nahen Osten an einer wichtigen Stelle des Weltverkehrs lag, großes Ansehen genoß und weithin gehört werden würde. Beide Prozesse haben auch das miteinander gemein, daß bei ihnen die Auseinandersetzung in der Presse und der Öffentlichkeit eine größere Bedeutung bekam als der eigentliche Prozeß. An der Spitze der Gegner stand der levantinische Rechtsanwalt Leo Castro, der als einer der aktivsten politischen Rechtsanwälte des Nahen Ostens galt, im Orient in der Antihitlerbewegung eine führende Rolle spielte und auch auf die dortige Presse einen großen Einfluß hatte. Die deutsche Kolonie, die hauptsächlich aus Export- und Importkaufleuten bestand, hatte einen schweren Stand, sich gegen Boykott und Propaganda zu wehren. Das Auswärtige Amt hatte deshalb der Kolonie in Kairo eine Broschüre in deutscher Sprache übersandt, die Aufklärung über die in Deutschland gegen die Juden ergriffenen Maßnahmen bringen sollte. Es war eine kleine, sachlich gehaltene Schrift geringen Umfangs mit einigen Anlagen, die Beweismaterial zur Rechtfertigung der Vorgänge in Deutschland enthielten. Diese Broschüre hatte der Deutsche Klub in Kairo an einige deutschfreundliche Ägypter, die die deutsche Sprache beherrschten, durch die Post gesandt. Die Juden Ägyptens erklärten sich dadurch für beleidigt und erhoben eine Schadenersatzklage vor dem Gemischten Gerichtshof in Kairo (Tribunal Mixte), der auf Grund der Kapitulationen noch als internationale Instanz zwischen Ausländern und Ägyptern Recht sprach und zwar nur in Zivilprozessen. Der Prozeß wurde also als zivilrechtlicher Schadensersatzprozeß aufgezogen und ging auf einen Franken Schadensersatz wegen moralischen Schadens - dommage moral. Diesmal gab es also politische Justiz in der Form eines Zivilprozesses. Verklagt war der Deutsche Klub in Kairo, vertreten durch seinen Vorsitzenden van Meteren. Als Kläger fungierten: ein ägyptischer, ein griechischer und ein italienischer Jude. Ich fuhr, nachdem ich mich mit dem Prozeßstoff vertraut gemacht hatte, Ende 1933 nach Kairo, um der Deutschen Kolonie als Rechtsanwalt beizustehen. Der Gesandte von Stohrer empfing mich aufs beste und brachte mich im Grand Hotel Helouan, am Rande der Wüste, unter, wo ich in aller Ruhe den Prozeß zusammen mit dem Vertrauensanwalt der Deutschen Gesandtschaft und der Kolonie, Rechtsanwalt Dr. Dahm, vorbereiten konnte. Dr. Dahm lag als schwerkranker Mann in Helouan, war aber von einer bewundernswerten Energie und Arbeitskraft bis zu seinem bald darauf erfolgenden Tode. Als weiteren Mitarbeiter hatten wir den Vorsitzenden der ägyptischen Anwaltskammer, Kamel Sedky Bey, gewonnen. Die Klage war auf Beleidigung des Judentums gestützt. Die angegriffene Broschüre hatte in einer ruhigen Sprache die Maßnahmen, die in Deutschland gegen den zu starken Einfluß der Juden bei gewissen Berufen (Rechtsanwälte, Ärzte usw.) ergriffen worden waren, zu rechtfertigen versucht. Zum Beweis waren Statistiken beigefügt. Die Kläger behaupteten, daß diese Statistiken gefälscht seien und leiteten daraus die Absicht der Beleidigung und den bösen Glauben her. Es konnte aber nachgewiesen werden, daß es sich um Statistiken handelte, die aus jüdischen Quellen stammten. In der Hauptverhandlung erhob ich nur den Einwand der mangelnden Klageberechtigung.31 Hier klagten drei einzelne Personen wegen Beleidigung des gesamten Judentums. Das war unzulässig. Das galt schon so im römischen Recht, wo man das als actio ut singuli bezeichnet hatte. An diesem Rechtsstandpunkt, daß einzelne Mitglieder einer großen Gemeinschaft von Menschen nicht berechtigt seien, wegen Beleidigung der Personengemeinschaft als solcher Klage zu erheben, hatten alle Kulturstaaten, Frankreich, England, die Vereinigten Staaten, Italien, Belgien, bis heute festgehalten. Sonst hätten ja auch einzelne Deutsche, die in anderen Ländern als Gäste lebten, wegen aller Beleidigungen Deutschlands, wie sie nun mal in der Pressepolemik der damaligen Zeit vorkamen, Beleidigungsklagen erheben können.
Am Verhandlungstag war der größte Saal des internationalen Gerichts in Kairo
überfüllt. Besonders
die ägyptisch-arabische Juristenwelt war vertreten. In diesem Prozeß war es allein
die Gegenseite, die den Prozeß durch Propaganda zu einem politischen Prozeß
machte, während ich mich in meiner Antwort auf die Rechtsfrage des mangelnden
Klagerechts der drei Kläger beschränkte. Die Klage wurde abgewiesen. Ein
spontaner Jubel erhob sich in
der ägyptisch-arabischen Zuhörerschaft. Ich wurde in das Zimmer der
ägyptischen Anwaltschaft geführt, wo Reden auf Deutschland, seine Wissenschaft
und seine Juristen gehalten wurden. Für uns Deutsche, namentlich für mich, kam
dieser plötzliche Ausdruck der Sympathie der arabischen Welt überraschend. So
war
also auch der Kairoprozeß ein politischer Prozeß, ein Mißbrauch der Justiz zu
politischen Zwecken, aber der Mißbrauch ging diesmal von den Klägern aus,
Privatpersonen, hinter denen einflußreiche politische Gruppen standen. Ich habe meine
Aufgabe in diesem Prozeß als eine rein rechtliche aufgefaßt, und so wurde mein
Auftreten auch von dem Gericht und der öffentlichen Meinung in Ägypten
empfunden. Mein Plädoyer wurde in der in Kairo erscheinenden Fachzeitschrift der
ägyptischen Juristen in breiter Ausführlichkeit gewürdigt.
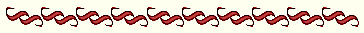 . Die Affäre Berthold Jacob 1935 Der erste politische Prozeß in der Schweiz, mit dem ich Ende 1935 befaßt wurde, war die Affäre Berthold Jacob. Berthold Jacob war ein jüdischer Schriftsteller, der als Mitherausgeber der Weltbühne in der Zeit der Femeprozesse sich durch seine scharfen Artikel in den deutschen Rechtskreisen und bei den Nationalsozialisten in besonderem Maße verhaßt gemacht hatte. Er war nach der Machtergreifung nach Frankreich geflohen und lebte dort als Emigrant. Er wurde bezichtigt, im Sold einer ausländischen Militärverwaltung zu stehen. Es schwebte gegen ihn ein Verfahren wegen Landesverrats. Berthold Jacob war eines Tages an der Schweizer Grenze bei Basel durch die Gestapo verhaftet und nach Berlin gebracht worden. Der Fall erregte Aufsehen in der ganzen Welt. Darauf sah sich die Schweiz veranlaßt, Vorstellungen bei der deutschen Regierung zu erheben, die dann zu einem Schiedsgerichtsverfahren führten. Ich war schon vor 1933 in verschiedenen Schiedsgerichtsverfahren als Schiedsrichter oder Agent, d. h. Sachwalter des Reiches, vorgesehen, und von den betreffenden Regierungen angenommen, insbesondere in einem Schiedsvertrag mit der Schweiz. Ich wurde also in diesem Verfahren als deutscher Agent (Rechtsanwalt) der Schweiz präsentiert. Ein hoher schwedischer Jurist wurde als Schiedsrichter bestellt und beiderseits akzeptiert. Die Schweiz legte mir ihre Akten zur Einsicht vor. Ich überzeugte mich daraus, daß der Vorwurf der Grenzverletzung in der Tat gerechtfertigt war. Die Gestapo hatte Fehler begangen. Ich schlug daher in einem begründeten Gutachten dem Auswärtigen Amt vor, sich nicht auf ein Schiedsverfahren einzulassen, sondern dem Klagebegehren der Schweiz zu entsprechen und Berthold Jacob wieder auszuliefern.
Die Affäre Berthold Jacob war übrigens die einzige Sache, in der ich mit Himmler
persönlich verhandelt habe, und zwar auch mehr durch einen Zufall. Ich war in die
Reichskanzlei bestellt und traf Himmler. Wir waren allein, und er sprach mich an. Da diese
Angelegenheit ihn betraf, habe ich sie ihm vorgetragen und dabei mit meiner Kritik an dem
Verhalten seiner Beamten nicht zurückgehalten. Er nahm meine Kritik in Ruhe auf und
schloß sich meiner Ansicht, daß Berthold Jacob ohne Verfahren wieder ausgeliefert
werden müsse, an, desgleichen Hitler.
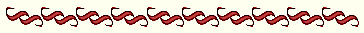 . Der Frankfurterprozeß in Chur 1936 Der zweite politische Prozeß in der Schweiz, an dem ich beteiligt war, war der Frankfurterprozeß, der im Dezember 1936 in Chur verhandelt wurde. Am 4. Februar 1936 wurde der Landesgruppenleiter der Auslandsorganisation der NSDAP in der Schweiz, Wilhelm Gustloff, in Davos ermordet. Täter war ein jüdischer Student, namens David Frankfurter, der aus Vincovici in Jugoslavien stammte. Er war der Sohn eines Rabbiners und streng orthodox erzogen. Er hatte zunächst in Frankfurt a. M. Medizin studiert, aber kein Examen oder Vorexamen gemacht. Nach der Machtergreifung durch Hitler war er nach Bern übergesiedelt, hatte es aber auch dort zu keinem Studienabschluß gebracht. Man fand bei ihm einen Briefwechsel mit seinem Vater und seinem älteren Bruder, der Arzt war, vor, der ein wenig günstiges Licht auf Frankfurter warf, worin der Vater und Bruder ihm heftige Vorwürfe wegen seines Lebenswandels machten und sich von ihm lossagten. Eines Tages verschwand David Frankfurter von Bern. Er hatte sich dort einen Revolver gekauft und auf einem Übungsplatz Schießübungen angestellt. Er hatte sich entschlossen, einen prominenten Vertreter des Nationalsozialismus umzulegen und hatte sich für seine Tat Davos ausgesucht, weil dort Gustloff lebte, und weil er festgestellt hatte, daß es im Kanton Graubünden, zu dem Davos gehörte, bei Mord keine Todesstrafe gab. In der Schweiz war damals das Strafrecht in jedem Kanton noch besonders geregelt. In Davos ging er langsam und bedächtig vor. Er wartete erst mehrere Tage, bis er die Tat ausführte. Am dritten Abend klingelte er an der Tür des Hauses, in dem Gustloff wohnte und fragte Frau Gustloff, die ihm öffnete, ob er Herrn Gustloff in einer dringenden Angelegenheit persönlich sprechen könne. Er habe ihm ein wichtiges Anliegen vorzutragen. Frau Gustloff führte ihn nichtsahnend in das Arbeitszimmer ihres Mannes, der ihn höflich empfing und ihn aufforderte, Platz zu nehmen. Frankfurter setzte sich Gustloff gegenüber. Dann zog er den Revolver heraus, erklärte, daß er Jude sei und sich rächen wolle und streckte Gustloff aus nächster Nähe mit mehreren Schüssen nieder. Er versuchte erst, durch den Kurpark, der in tiefem Schnee lag, zu entfliehen, sah aber bald das Nutzlose einer Flucht ein und stellte sich auf dem Gendarmeriebüro in Davos, wo er festgenommen wurde. Die Voruntersuchung wurde von dem Untersuchungsrichter Dedual aus Chur sorgfältig geführt. In dem kleinen Kanton Graubünden gab es keine ständigen Strafgerichtsbehörden, insbesondere keine permanente Staatsanwaltschaft. Es gab in dem Gerichtsgebäude in Chur nur ein Sekretariat und einen Untersuchungsrichter. Das Gericht selbst aber und die Ankläger wurden von Fall zu Fall berufen, und zwar die Vorsitzenden des Gerichts und die Ankläger aus den Juristen des Landes, die Beisitzer bei wichtigen Sachen womöglich auch aus Juristen, sonst aus angesehenen Laien. Zum Ankläger war hier ein Rechtsanwalt aus Chur namens Dr. Burger und zum Vorsitzenden der hochbetagte Präsident Dr. Ganzoni aus Chur bestellt worden. Die Beisitzer stammten hauptsächlich aus den Kreisen des Hotelgewerbes in St. Moritz und verfügten über Rechtskenntnisse. Dr. Ganzoni war ein ausgezeichneter Jurist von großer Rechtschaffenheit. Er erinnerte mich in vielem an den Präsidenten Dr. Soldati, der nach 1920 der Vorsitzende des Deutsch-Italienischen Gemischten Schiedsgerichtshofes in Rom gewesen war, vor dem ich mehrfach in Rom und Mailand plädiert hatte. Beide waren Tessiner, und ich hatte den Eindruck, daß der Tessin über tüchtige Juristen verfügte. In der Voruntersuchung hatte Frankfurter zunächst unumwunden zugegeben, daß er die Tat vorsätzlich und mit Überlegung ausgeführt habe. Er hatte als Jude sein Volk an einem hervorragenden Vertreter des Hitlerdeutschland rächen wollen. Emil Ludwig, der bekannte jüdische Schriftsteller, schrieb eine Broschüre über David Frankfurter, in der er Frankfurter als den neuen David verherrlichte, der den Riesen Goliath erschlug. Im Laufe des Verfahrens änderte aber Frankfurter seine Haltung. Er schwächte das Element des Vorsatzes und der Überlegung immer mehr ab, so daß schließlich nur noch ein bedauerliches Versehen übrig blieb. Sein Verteidiger sagte in der Hauptverhandlung: "Es war halt eine automatische Pistole, mit der das unglückliche Opfer des Nazismus sich in der Verzweiflung in Gustloffs Zimmer vor einem Hitlerbild das Leben nehmen wollte, wobei eben die automatische Pistole in der falschen Richtung losging, so daß nicht Frankfurter, sondern Gustloff getroffen wurde." In diesem Prozeß war ich Vertreter der Zivilpartei. Die Witwe des Ermordeten, Frau Hedwig Gustloff, war dem Prozeß als Zivilpartei beigetreten. Das Schweizer Recht kennt wie das französische Recht die Einrichtung der Zivilpartei. Die Witwe des Ermordeten oder nahe Angehörige wie Eltern und Geschwister können dem Strafprozeß beitreten und Rechtsanwälte bestellen, die neben dem öffentlichen Ankläger in der Hauptverhandlung plädieren. Gegen die Zulassung eines deutschen Rechtsanwalts wurden in der Schweiz erhebliche Bedenken erhoben. Ich machte dem Präsidenten Dr. Ganzoni in Chur und dem Bundespräsidenten Motta in Bern einen Besuch. Sie entschieden, daß ich in Assistenz eines Schweizer Rechtsanwalts zugelassen würde. Ich hatte mit beiden Herren, namentlich mit Motta, eine lange Aussprache. Die Begegnung mit Motta, in dem ich einen Staatsmann von großem Format kennenlernte, machte auf mich einen tiefen Eindruck. Mein Schweizer Mitarbeiter war der Rechtsanwalt Dr. Werner Ursprung aus Zurzach, dessen Vater Bundesrichter gewesen war. Er hat seine Aufgabe aufs loyalste erfüllt. Als die Untersuchung abgeschlossen und die Hauptverhandlung in Chur anberaumt war, berief mich Hitler, der sich für den Prozeß persönlich interessierte, nach Berlin. Ich berichtete ihm über den Verlauf der Voruntersuchung und sagte ihm, daß ich in der Hauptverhandlung, genau so wie in Kairo, so sachlich wie nur möglich auftreten würde. Ich hatte dem Gerichtspräsidenten versprochen, daß ich kurz plädieren würde. Ich wußte, daß die Gegner lange plädieren würden, war aber überzeugt, daß mein Auftreten in der Schweiz am wirksamsten sein würde, wenn ich gerade deswegen kurz sprechen würde. Ich hatte ein solches kurzes Plädoyer schon vorbereitet und las es Hitler vor. Er war mit allem einverstanden und sagte: "Machen Sie es, wie Sie es für richtig halten!" Als ich nach diesem Gespräch in mein Hotel zurückkehrte, wurde ich angerufen, ich möge zur Gestapo kommen. Ich ging zur Prinz-Albrecht-Straße. Es war nicht das einzige Mal, daß ich als Rechtsanwalt das Hauptquartier der Gestapo betrat. Es ging dort genau so zu wie bei anderen Behörden. Man füllte am Eingang einen Sprechzettel aus, den man beim Verlassen des Gebäudes wieder abzugeben hatte. Die Form der An- und Abmeldung war die gleiche wie z. B. beim Reichsjustizministerium. Als Anwalt wurde man auch von den Beamten, die ja zumeist noch aus der alten Zeit stammten, durchaus korrekt empfangen. Für den Besucher, der beruflich das Gebäude betrat, war nichts Außergewöhnliches zu bemerken. Diesmal hatte ein junger Gestapobeamter mich zu sprechen gewünscht. Er verlangte von mir, daß ich mich von Rechtsanwalt Dr. Ursprung trenne. Dieser sei ein Vertreter des Weltfreimaurertums. Ich erwiderte, daß ich dieses Ansinnen ablehnen müsse, da ich allein die Verantwortung für die Prozeßführung trüge und Dr. Ursprung mein volles Vertrauen habe. Die Ansicht der Gestapo müsse auf einer falschen Information beruhen. Ich bin dann nicht weiter von der Gestapo behelligt worden. Der Prozeß verlief, wie wir erwartet hatten. Die Haltung des Gerichts und des Anklägers war korrekt. Die Presse der ganzen Welt war vertreten, darunter als ausländischer Journalist auch Emil Ludwig. Der Verteidiger plädierte mehrere Tage. Er sprach nicht zur Sache, sondern machte nur in Propaganda. Ich hielt mich als Vertreter der Zivilklage an mein Versprechen, erwiderte in zwanzig Minuten und enthielt mich jeder Propaganda. Der Täter wurde zur Höchststrafe, 16 Jahre Gefängnis, verurteilt. Unter dem Eindruck der Plädoyers schlug die Stimmung in der Schweiz um. Die Schweizer Presse, die bis dahin dem Angeklagten freundlich gewesen war, mißbilligte die Art seiner Verteidigung. Die Korrektheit der deutschen Prozeßführung wurde auch vom Schweizer Gericht und der Schweizer Regierung anerkannt. Die Schweizer Regierung richtete nach dem Prozeß an die Reichsregierung eine Note, in der sie die einwandfreie Haltung der deutschen Prozeßvertretung hervorhob, und der Präsident des Gerichtes von Chur, Dr. Ganzoni, sprach mir in einem herzlich gehaltenen Schreiben seinen Dank für mein Auftreten in diesem Prozeß aus. In einem Punkte aber hatte der Prozeß in Chur keine Klarheit gebracht, in der Hintermännerfrage. Frankfurter mußte Hintermänner gehabt haben. Das ergab sich klar aus den Umständen der Tat, wie sie durch die Hauptverhandlung erwiesen waren. Aber über diese Frage schwieg sich Frankfurter aus. Da waren auch alle Bemühungen der Schweizer Behörden vergeblich. Die Hintermännerfrage war nicht aufzuklären. Das war bei diesen großen politischen Prozessen immer so: im Reichstagsbrandprozeß, bei Frankfurter, und im Grünspanprozeß nicht anders. In diesem Prozeß wurde das Problem des politischen Mordes grundsätzlich erörtert. Die Gegenseite, die durch Emil Ludwig den Mörder als Helden verherrlicht hatte, warf uns vor, daß wir in den Femeprozessen den politischen Mord gebilligt hätten. Ich konnte durch Vorlegung der gedruckten Plädoyers aus der Femezeit das Gegenteil beweisen. In dem Femeprozeß Reim, in dem das Reichsgericht dann entschied, daß bei den sogenannten Femeprozessen der Schwarzen Reichswehr putative Staatsnotwehr grundsätzlich zugelassen werden könne (RGSt. 63 S. 215 ff.), hatte ich als Verteidiger des Angeklagten folgendes ausgeführt:32 "Und ich möchte auch über eines mich ganz deutlich aussprechen: Mir liegt völlig fern, irgend etwas zu verherrlichen oder auch nur zu beschönigen, was nicht recht wäre. Ich schätze das Rechtsgut eines Menschenlebens sehr hoch ein. Ich verurteile diejenigen, die leichten Herzens mit Menschenleben spielen. Ich bin der Meinung, daß in einem Ordnungsstaat die volle Schärfe des Gesetzes denjenigen treffen muß, der leichtfertig Menschenleben zerstört. Das Motivdelikt des Überzeugungstäters ist Delikt. Politischer Mord bleibt Mord. In diesem Falle handelt der Täter nicht, weil er so handeln muß, weil er glaubt, richtig zu handeln, sondern er ist sich der Deliktsnatur seiner Handlung bewußt, nur der Antrieb zur Tat ist politische Leidenschaft." Ich hatte also Gelegenheit gehabt, als Rechtsanwalt beide Seiten zu vertreten, Personen, die wegen politischen Mordes angeklagt waren und im Gustloffprozeß als Kläger die Witwe des Ermordeten. Ich war mir darüber klar, daß es nicht angängig sei, einmal den politischen Mord zu billigen und ein andermal zu verurteilen, je nachdem man Verteidiger oder Kläger war. Politischer Mord ist Mord. Man darf das nicht leicht nehmen. Man muß konsequent sein. Es ist allerdings ein Unterschied zu machen. Politischer Mord im eigentlichen Sinne ist immer nur die Tat eines Menschen, der aus politischen Gründen einen anderen Menschen beseitigen will, z. B. ein Tyrannenmord oder die Tötung eines politischen Gegners. Politische Morde waren der Erzberger- und der Rathenaumord und die Morde an Gustloff und vom Rath. Keine politischen Morde im eigentlichen Sinne aber waren die sogenannten Fememorde oder die Kriegsverbrechen. Hier handelten die Täter nicht aus politischem Motiv, sondern aus Vorstellungen heraus, die den subjektiven Tatbestand berühren, also echte Schuldausschließungsgründe darstellen. Beim eigentlichen politischen Mord ist das politische Motiv dagegen nie ein Schuldausschließungsgrund, sondern höchstens ein Milderungsgrund, der allein in der Gnadeninstanz oder bei einer Abschlußamnestie Berücksichtigung finden kann.
Es ist jedoch kaum zu verhindern, daß die Anhänger des politischen Mörders,
wenn dieser Überzeugungstäter ist, sich zu ihm bekennen und das Opfer ehren,
wenn er bei der Tat sein Leben eingesetzt hat. Dieses Einstehen für die Person des
Täters darf aber nicht eine Billigung oder gar Verherrlichung der Tat als solcher, d. h. des
politischen Mordes, bedeuten. Den politischen Mord kann kein Rechtsstaat zulassen. Jedenfalls
ist politischer Mord und Heldenverehrung ein heikles Thema, das uns schon durch Schillers
Wilhelm Tell bekannt ist. Es hat seit jeher die Völker beschäftigt. Es ist zu
einem ernsten Kapitel der Gegenwartsgeschichte geworden.
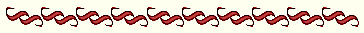 . Der Berner Zionistenprozeß 1937 Ein politischer Prozeß in der Schweiz, an dem weder eine deutsche Partei noch ein deutscher Anwalt beteiligt waren, war der Zionistenprozeß von Bern. Er verdient gleichwohl in diesem Zusammenhang erwähnt zu werden, weil er das Muster eines politischen Prozesses war, wie er nicht sein sollte, d. h. das Muster eines Prozesses, in dem die Justiz für politische Zwecke mißbraucht wird, und weil der Prozeß, trotzdem er äußerlich nur zwischen Schweizer Staatsangehörigen ausgetragen wurde, in Wirklichkeit ein Prozeß gegen deutsche Unternehmen war. In Bern hatte ein jugendlicher Schweizer an der Eingangstür eines Saales, in dem eine Versammlung einer sogenannten Erneuerungsbewegung stattfand, eine Broschüre zum Kauf angeboten, die den Titel trug: "Das Protokoll der Weisen von Zion." Diese Broschüre war im Eher-Verlag in München erschienen. Diesen Umstand benützten gewisse Kreise in der Schweiz, um gegen den Verkäufer der Broschüre beim Berner Einzelrichter Strafantrag wegen Verletzung des Gesetzes über Schmutz und Schund zu stellen, und die Frage der Echtheit oder Unechtheit der Protokolle vor ein Schweizer Gericht zu bringen. Dieser Prozeß vor dem Berner Einzelrichter wurde mit einem Riesenaufwand von Zeugen und Sachverständigen aus der ganzen Welt aufgezogen. Der Einzelrichter, der normalerweise die kleinen Übertretungsfälle, die zu seiner Kompetenz gehören, durch Strafverfügung mit Geldstrafen von einigen Franken zu ahnden pflegt, aber auch eine mündliche Verhandlung anberaumen kann, wenn er dies für notwendig hält, gab hier allen Beweisanträgen der Klageseite statt und verursachte dadurch für den Berner Staat eine Kostenlast von über 30.000 Schweizer Franken allein für Zeugen und Sachverständige. Der Berner Einzelrichter wird von den Parteien gewählt. Er hieß in diesem Falle Meyer und gehörte einer Partei an, die dem Nationalsozialismus und den schweizerischen gleichartigen Bewegungen feindlich gesonnen war und machte daraus in den Verhandlungen auch keinen Hehl. Das führte zu langen politischen Kontroversen zwischen dem Vorsitzenden und dem einzigen Reichsdeutschen, der an diesem Prozeß teilnahm, dort als Sachverständiger fungierte und mit dem gleichen Fanatismus für die Echtheit der Protokolle stritt, wie der Vorsitzende und die Kläger das Gegenteil behaupteten. Die Urteilsverkündung dieses Vorsitzenden, die im Wortlaut durch die Presse verbreitet wurde, ist ein klassischer Beweis dafür, wohin man gerät, wenn man solche Politisierung der Justiz zuläßt.
Die einzige Frage, auf die es in diesem Prozeß ankam, nämlich die, was die
politische Kampfschrift über die Protokolle der Weisen von Zion mit dem
Berner Schmutz- und Schundgesetz zu tun hätte, wurde in dem Verfahren
überhaupt
nicht erörtert. Sie war das erste, was in der Berufungsinstanz vom Berner Landgericht, das
mit Berufsrichtern besetzt war, geprüft wurde. Die Klage wurde daraufhin sofort als
unzulässig zurückgewiesen, und die Kläger hatten nun die hohen Kosten der
Beweisaufnahme zu tragen. So richtete sich auch dieser Mißbrauch der Justiz gegen seine
Urheber. Der Prozeß lenkte die Aufmerksamkeit auf die beanstandete Broschüre,
auch bei denen, die sie als Fälschung ansahen, sich aber sagten, daß es nicht
Aufgabe
der Justiz sei, derartige politische Streitfragen zu entscheiden.
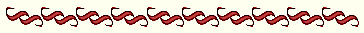 . Ein Prozeß um Danzig Ein weiterer politischer Prozeß, bei dem der Angriff von den Gegnern des Nationalsozialismus ausging, war der Prozeß um Danzig, der im Februar 1936 vor dem Ständigen Gerichtshof in Den Haag (Cour Permanente de Justice Internationale) geführt wurde. Er ist kaum bekanntgeworden. Aber er war doch für die Beteiligten ein recht bemerkenswertes Erlebnis politischer Justiz. In diesem Prozeß handelte es sich um folgendes: Der durch Versailles geschaffene Freistaat Danzig hatte, um die Gleichheit der Gesetzgebung mit dem Reich aufrechtzuerhalten, alle im Reich erlassenen Gesetze jeweils auch in Danzig verkündet. Das wurde bis dahin nie beanstandet. Das war unter Ebert und Stresemann schon so gehandhabt worden. Als nun im Dritten Reich der § 2 StGB eingeführt wurde, der für das Strafrecht mit dem Grundsatz: "Nulla poena sine lege" - "Keine Strafe ohne Gesetz" - brach und statt dessen den Grundsatz "nullum crimen sine poena" - "Kein Verbrechen ohne Strafe", die Möglichkeit von Strafgesetzen mit rückwirkender Kraft und den Analogieschluß des Richters einführte, widersprach der Völkerbund. Er verlangte die Wiederherstellung des alten Rechtszustandes, da diese nationalsozialistische Neuerung mit der Idee eines Rechtsstaates unvereinbar sei, auch der Danziger Verfassung und dem Versailler Vertrag und dem Statut des Völkerbundes widerspreche. Gleichzeitig beschloß der Völkerbundsrat, den Internationalen Ständigen Gerichtshof im Haag um ein Rechtsgutachten zu ersuchen, daß § 2 mit der Idee des Rechtsstaates unverein[bar] sei. Es war ein ähnlicher Vorgang, wie er in der Bundesrepublik 1952 beinahe eine Verfassungskrise hervorrief. Die Völkerbundssatzung sah dieses Gutachterverfahren vor. Es war ein Verfahren, bei dem der beteiligte Staat sich vor dem Gerichtshof durch einen Anwalt vertreten lassen und seinen Standpunkt vortragen konnte. Es fand also eine richtige mündliche Verhandlung statt, sie war allerdings nicht kontradiktorisch, vielmehr fehlte die Gegenpartei. Der Staat Danzig beauftragte den Grafen Gleispach und mich mit seiner Vertretung. Graf Gleispach, ein österreichischer Universitätsprofessor des Strafrechts, war der Theoretiker und anerkannte Spezialist des § 2 StGB. Er legte alle Einzelheiten seiner Doktrin dar, während meine Aufgabe hauptsächlich darin bestand, nachzuweisen, daß, wie immer man auch zu der Berechtigung oder Nichtberechtigung der beiden strittigen Doktrinen stehen möge, jedenfalls der Völkerbund nicht berechtigt sei, Danzig eine Gesetzesänderung dieser Art aufzuzwingen. Ich selbst war ein Gegner dieses neuen Prinzips. Ich war der Meinung, daß niemand mit rückwirkender Kraft auf Grund eines Gesetzes bestraft werden sollte, das zur Zeit der Begehung der Tat noch gar nicht bestand. Ich hatte auch die Lex van der Lubbe nicht für richtig gehalten. Ich ging noch weiter und befürwortete eine Abänderung des bisherigen Rechtszustandes nach der entgegengesetzten Richtung. Bislang hatte man für das Strafrecht an dem Grundsatz festgehalten: "Unkenntnis des Gesetzes schützt vor Strafe nicht." Nur Zivil- und Staatsrechtsirrtum sollte zu beachten sein. Die Unkenntnis eines bestehenden Strafgesetzes (error juris, Strafrechtsirrtum) sollte kein Strafausschließungsgrund sein. Ich war der Meinung, daß in gewissem Umfange auch die Unkenntnis der Strafbarkeit einer Tat Beachtung finden müsse. Ich war daher ein Anhänger aller Bestrebungen der neuen Strafgesetzentwürfe und besonders der Neuerungsbestrebungen auf dem Gebiete des Wirtschaftsstrafrechtes, die auch Strafrechtsirrtum als Entschuldigungsgrund anerkennen wollten. Das hinderte mich aber nicht, vor dem Internationalen Gerichtshof dieser Klage entgegenzutreten, die ich als einen Mißbrauch der Justiz zu politischen Zwecken empfand. Es war offensichtlich, daß dieser Prozeß nicht gegen Danzig gerichtet war. Es handelte sich also wieder einmal um politische Justiz. Es wurde dann eine Woche lang auf das gründlichste plädiert, nachdem erschöpfende Schriftsätze eingereicht worden waren. Darin wurde dargestellt, in welchen Kulturstaaten in den letzten Jahrhunderten das eine oder das andere Prinzip gegolten hatte. Ich hatte am Vorabend des Prozesses im Friedenspalast im Haag, wo das internationale Gericht tagte, eine denkwürdige Besprechung mit dem Generalsekretär dieses höchsten Gerichtshofes, als ich ihm meinen Antrittsbesuch machte. Er war Völkerrechtler eines nordischen Staates. Er sprach mir seine Anerkennung über die Schriftsätze aus, die wir für Danzig eingereicht hätten. Dann endete er mit der Frage: "Aber glauben Sie denn, daß Sie damit durchdringen werden? Das ist doch ein politischer Prozeß! Deutschland ist seit der Abberufung des Professors Schücking im Richterkollegium nicht mehr vertreten. Sie können also nur noch mit Italien und Japan rechnen. Die anderen Richter stimmen mit England und Frankreich. Sie können sich denken, wie das Ergebnis sein wird." In diesem Prozeß ging alles sehr vornehm zu. Die Verhandlung fand im schönsten Saal des Haager Friedenspalastes statt, den der amerikanische Milliardär Carnegie vor 1914 gestiftet hatte. Der Vorsitzende war der Engländer Lord Robert Cecil, eine imponierende Erscheinung. Er war auch der Präsident der Abrüstungskonferenz von Genf. Der französische Beisitzer war der Professor Fromageot, der Leiter der Rechtsabteilung des Quai d'Orsay. Beides waren vortreffliche Juristen, aber in dieser Frage befangen. Im übrigen saßen da in goldbestickten Talaren hinter dem großen Richtertisch 20 bis 30 Richter aus allen Ländern der Welt, würdige Vertreter ihrer Nationen. Der Saal war mit den modernsten technischen Vorrichtungen, Lautverstärkern usw. versehen, obwohl er gar nicht so groß war und die Akustik auch so ausgereicht hätte. Man brauchte also nicht laut zu sprechen. Verhandelt wurde nur vormittags und nur 2 bis 3 Stunden. Jedes gesprochene Wort wurde sofort auf Schallplatten und ins Stenogramm aufgenommen. Am Abend bekam man ein Protokoll ins Hotel zugestellt, worin alles, was am Vormittag vorgetragen war, gedruckt stand.
Die Prozeßbeteiligten wurden in dem Hotel Wittebrug auf das beste untergebracht. Nach
Abschluß der Verhandlungen wurden alle in die Villa des Vorsitzenden Lord Robert Cecil
eingeladen. Das Ergebnis war: Danzig mußte den § 2 StGB wieder abschaffen. Aber
dieselben Mächte, die den Grundsatz nulla poena sine lege für die Idee des
Rechtsstaates so wesentlich hielten, daß sie deshalb im Jahre 1936 einen
Prozeß mit solchem Aufwand vor dem Höchsten Gericht der Welt aufführten,
fanden nichts darin, diesen Grundsatz über Bord zu werfen, als es in Nürnberg
darum ging, die deutschen Staatsmänner und Heerführer einseitig zu
Kriegsverbrechern zu stempeln.
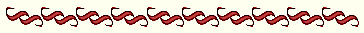 . Der Grünspanprozeß 1938/1939 Der Grünspanprozeß war ein ähnlicher Prozeß wie der Prozeß Frankfurter, so ähnlich, daß sich oft die Einzelheiten der beiden Prozesse in meiner Erinnerung vermischen. Der Frankfurterprozeß ist zu Ende verhandelt worden. Im Grünspanprozeß ist es wegen des Kriegsausbruches nicht mehr zu einer Hauptverhandlung gekommen. Am 7. November 1938 wurde die Welt durch die Nachricht erschreckt, daß in der Deutschen Botschaft in Paris ein junger aus Deutschland ausgewanderter Jude polnischer Staatsangehörigkeit, Herschel Grünspan, ein Mitglied der Botschaft, den Gesandtschaftsrat Ernst vom Rath, durch Schüsse niedergestreckt hätte, um, wie er sagte, die Juden zu rächen und durch einen in der ganzen Welt wirkenden Akt die Aufmerksamkeit der Menschheit auf die in Deutschland herrschenden Zustände zu lenken. Es gab schon damals Menschen, die die Schüsse von Paris mit den Schüssen von Serajevo verglichen und sagten, daß dies die ersten Schüsse des zweiten Weltkrieges sein würden. Ich wurde, da ich mit dem französischen Recht vertraut und seit dem Ruhrkampf auch sonst oft Berater der Deutschen Botschaft in Paris gewesen war, sogleich nach Paris gerufen und habe schon an der Überführung des Toten von Paris nach Düsseldorf teilgenommen. Die Deutschen, die den Sarg begleiten sollten, versammelten sich im Hotel Crillon in Paris, wo sie mit Vertretern der französischen Behörden und Freunden zum Nordbahnhof fuhren. Dort hatte eine französische Ehrenwache Aufstellung genommen. Die Deutsche Delegation bestieg Sonderschlafwagen, die an den fahrplanmäßigen Nachtzug nach Köln angehängt wurden. Die Sonderwagen wurden am Morgen in Aachen von dem Kölner Zug abgetrennt und über Mönchen-Gladbach direkt nach Düsseldorf geleitet, wo der Zug gegen 11 Uhr eintraf. Ich frühstückte im Abteil des Botschafters, des Grafen Welczek, mit diesem und hatte bis Düsseldorf mindestens zwei Stunden, während deren wir uns in aller Ruhe aussprechen konnten. Graf Welczek war sehr besorgt. Es war in diesem November 1938 kurz nach München die Zeit, in der sich unser Schicksal entscheidend vorbereitete. Chamberlain und Daladier waren in London und Paris begeistert empfangen worden. Sie hatten den Frieden gerettet. Aber der Gegenstoß der Kriegspartei unter Vansittard, Cooper und ihren französischen Freunden, hatte sofort eingesetzt. "Pas d'abdication!" - keine Abdankung! "Gegen die 'munichois'!" - "Gegen die 'Münchener'!" war die Losung. Hitler hatte durch die unglückliche Saarbrücker Rede den Eindruck erweckt, daß er die Nerven verloren hätte. Aber noch war die Friedenspartei in Frankreich unter Georges Bonnet stark. Anfang November sollte in Paris zwischen Ribbentrop und Bonnet das deutsch-französische Konsultativabkommen unterzeichnet werden, das dem deutsch-englischen Abkommen entsprach, das Chamberlain schon von München mitgebracht hatte. Das Attentat in der Deutschen Botschaft sollte, so war die Auffassung des Botschafters, am Vorabend des Ribbentropbesuches das Zustandekommen dieses deutsch-französischen Abkommens verhindern. Es hat auch den Ribbentropbesuch um einen Monat aufgeschoben und die Wirkung des Abkommens stark herabgesetzt. So war der Mord in der Deutschen Botschaft ein Schlag gegen die deutsch-französische Verständigung. So faßte es Graf Welczek auf, so auch Georges Bonnet. Dieses Attentat war nicht die Tat des jungen Grünspan. Er mußte Hintermänner haben, die jeden Ausgleich mit Deutschland verhindern wollten. In Chur war der Landesgruppenleiter der Partei ermordet worden. In Paris sollte der deutsche Botschafter als oberster Vertreter des Reiches oder doch wenigstens ein anderes Mitglied der Deutschen Botschaft getroffen werden. Graf Welczek war überzeugt, daß die Tat gegen ihn persönlich als Botschafter geplant war, und daß er nur durch einen Zufall dem Verhängnis entgangen sei. Er hatte die Gewohnheit, jeden Morgen vor Dienstbeginn einen Spaziergang an der Seine entlang zu machen. Als er an jenem Morgen den Hof des Gebäudes durchschritt, um seinen Ausgang zu machen, begegnete ihm Grünspan und fragte ihn, ob er den Botschafter sprechen könne. Welczek verwies ihn an die Eingangstür zum Seitenflügel, wo die Geschäftsräume lagen und wo der Amtsdiener Nagorka diesen ersten Besucher an jenem Morgen empfing und nach seinem Begehr fragte. Grünspan erwiderte, er wolle den Botschafter sprechen. Nagorka führte ihn in das Zimmer vom Raths, der als erster der Sekretäre erschienen war und außerdem die Aufgabe hatte, nicht angemeldete Besucher zu empfangen und an die richtige Stelle zu leiten. Kaum hatte sich die Tür geschlossen, da fielen die Schüsse. Nagorka eilte hinzu, nahm Grünspan fest und übergab ihn dem französischen Polizeibeamten, der in der Straße vor der Botschaft Dienst tat. Ein soeben eintreffender Mitarbeiter, dessen Arbeitszimmer neben dem vom Raths lag, nahm sich des Schwerverletzten an. Grünspan bekannte sich zu seiner Tat genau so wie Frankfurter, fast mit den gleichen Worten. War er von Hintermännern so instruiert worden? "Ich habe die Juden rächen wollen. Ich habe ein Mitglied der Deutschen Botschaft töten wollen, um die Aufmerksamkeit der Welt auf die Vorgänge in Deutschland zu lenken." Als er hörte, daß vom Rath noch nicht tot sei, sagte er: "Schade." Später schwächte er alles ab wie Frankfurter. Er habe nicht töten wollen, nur verwunden. Er handelte ganz automatisch. Es war alles wie bei Frankfurter. In diesem Prozeß habe ich als Vertreter der Eltern und Geschwister an dem französischen Verfahren teilgenommen, in engster Zusammenarbeit mit einem hochangesehenen französischen Rechtsanwalt, der als Offizialverteidiger der Zivilpartei bestellt war. Das Verfahren wurde sorgfältig durchgeführt, wie in Chur. Entsprechend dem Gebrauch in Frankreich erhielten auch die Anwälte der Zivilpartei, genau so wie die Verteidiger des Angeklagten, vollständige Abschriften der Akten. Der Untersuchungsrichter Tesnière war gewissenhaft und loyal. Auch die Polizei gab sich größte Mühe, die Wahrheit zu ermitteln. So wurde die Tat selbst mit all ihren Einzelheiten auf das beste aufgeklärt, besonders das Motiv der Tat. Daß Grünspan durch die Tat die Juden habe rächen wollen, blieb der Kernpunkt des ganzen Verfahrens. Daran ist, trotzdem Grünspan später den Tötungsvorsatz und die Überlegung bestritt, bis zum Schluß der Voruntersuchung nicht gedeutelt worden. So war es in der polizeilichen Ermittlung und der richterlichen Voruntersuchung. So wurde es auch in der ärztlichen Untersuchung bestätigt. Grünspan war jugendlich. Bei ihm mußte also nach französischem Gesetz die Strafbarkeitseinsicht ärztlich nachgeprüft werden. In diesem Falle begnügten sich die Ärzte nicht mit einer einfachen Intelligenzprüfung, wie das sonst in Frankreich üblich ist, sondern sie erörterten mit Grünspan nochmals den ganzen Fall, was einen neuen Aktenband füllte. So gab es sozusagen drei Untersuchungen des Tatvorgangs, die der Polizei, des Untersuchungsrichters und der Ärzte. Alle drei stimmten in den wesentlichen Punkten, jedenfalls in der Frage des Motivs, überein. Es kam dann noch eine vierte Untersuchung hinzu, eine deutsche. Der Untersuchungsrichter wünschte durch die deutschen Behörden über das Vorleben des Grünspan, seine Familienverhältnisse und die Vorgänge, die zur Ausweisung seiner Eltern aus Hannover geführt hatten, unterrichtet zu werden. Grünspan war in Hannover als Sohn eines Juden polnischer Herkunft geboren. Seine Eltern und Geschwister waren ausgewiesen worden. Dies hatte er durch eine Postkarte erfahren, die ihm seine Schwester aus Polen geschrieben hatte. Die Erregung über dieses seiner Familie angetane Unrecht gab er als unmittelbaren Grund für seinen Entschluß, die Juden zu rächen, an. Es war also durchaus verständlich, daß der Untersuchungsrichter über die Vorgänge, die zur Ausweisung der Eltern geführt hatten, Aufklärung zu erhalten wünschte. Dieses Rechtshilfeersuchen wurde auf diplomatischem Wege den zuständigen deutschen Stellen zugeleitet. Das Reichsjustizministerium wurde mit der Durchführung befaßt und beauftragte seinerseits das Polizeipräsidium Hannover mit den örtlichen Ermittlungen. So entstand ein weiteres Aktenstück, das dem Untersuchungsrichter Tesnière auf dem diplomatischen Wege zugestellt wurde. Es war mit der gleichen Sorgfalt zusammengestellt, wie es die französischen Ermittlungen und Untersuchungen waren. Die Eltern des Grünspan waren aus Polen nach Hannover gekommen, wo der Vater als Flickschneider seit Jahren tätig war. Der Vater hatte drei Brüder, die auch Polen verlassen hatten. Auch sie waren Flickschneider. Der eine wohnte in Essen, der zweite in Brüssel, der dritte in Paris. Das Ergebnis der Ermittlungen über das Vorleben von Grünspan und seiner Angehörigen in Deutschland war nicht gut. Grünspan hatte die Gemeindeschule in Hannover besucht. Seine Lehrer wurden sämtlich vernommen und wußten nur Ungünstiges zu berichten. Auch die Beurteilung durch seine Glaubensgenossen war schlecht. Die Schulzeugnisse wurden sämtlich beigebracht. Grünspan hatte schließlich das Elternhaus verlassen, seine Onkel in Essen und Brüssel besucht und war dann bei seinem Onkel in Paris gelandet, wo er ohne polizeiliche Aufenthaltsgenehmigung lebte. Der Familie Grünspan war es in Deutschland gut gegangen, auch noch zur Hitlerzeit. Sie hatten noch nach 1933 in der Zeit der schlimmsten Arbeitslosigkeit Arbeitslosenunterstützung bezogen, die sich auf mehrere tausend RM belief. Die Schuld für die Ausweisung der polnischen Juden aus Deutschland lag damals zweifellos nicht bei der deutschen, sondern bei der polnischen Regierung. Die polnischen Juden waren nach dem ersten Kriege in großer Zahl nach Deutschland gekommen, unterlagen aber, wie dies in allen Ländern so war, der Ausländergesetzgebung, d. h. sie erhielten nur eine widerrufliche polizeiliche Aufenthaltsgenehmigung, die immer wieder erneuert werden mußte. Man hatte die Ausländervorschriften ihnen gegenüber bisher human gehandhabt, bis im Oktober 1938 die polnische Regierung plötzlich eine Anordnung erließ, wonach allen polnischen Staatsangehörigen eine kurze Frist zur Rückkehr nach Polen gestellt wurde. Nach Ablauf der Frist wurden ihre Pässe und Sichtvermerke ungültig und die Wiedereinreise nach Polen gesperrt. Die deutsche Regierung hatte sich alle Mühe gegeben, die polnische Regierung zur Zurücknahme dieser brutalen Anordnung zu bewegen und wenigstens eine Fristverlängerung zu erlangen. Als alle diese Bemühungen gescheitert waren, sah sich die Reichsregierung gezwungen, die polnischen Juden noch vor Fristablauf ihrer Heimatregierung an den Grenzorten zur Verfügung zu stellen. Die Ausweisung, so bitter sie auch für die Betroffenen war, ist damals in humaner Weise durchgeführt worden. Die Züge waren von Sanitätspersonal begleitet und reichlich mit Lebensmitteln versehen. Unangenehm wurde die Sache erst, als die polnischen Grenzbehörden bei der Aufnahme der Rückkehrer Schwierigkeiten machten. Auch ließen die Verhältnisse in den polnischen Aufnahmelagern zu wünschen übrig. Die korrekte Durchführung der Maßnahmen, soweit sie auf deutschem Boden durchgeführt wurden, konnte durch zahlreiche Aussagen, auch von Juden, Belege und Fotografien nachgewiesen werden. Im August 1939 war die Voruntersuchung in Paris abgeschlossen. Der Untersuchungsrichter nahm eine Schlußvernehmung des Angeklagten vor und machte einen abschließenden Bericht. Dann sollten die Akten über die Staatsanwaltschaft der Beschlußstrafkammer in Paris vorgelegt werden, die über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden hatte. Man rechnete damit, daß die Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht in Paris im September oder Oktober 1939 stattfinden würde. Darüber brach der Krieg aus, so daß der Prozeß in Paris nicht mehr verhandelt wurde. Während der ganzen Voruntersuchung waren die beschämenden Ereignisse der sogenannten Kristallnacht in Deutschland nicht behandelt worden. Der Untersuchungsrichter ließ eine Erörterung dieser Vorgänge nicht zu, weil sie nach der Tat lagen, also für das Motiv des Täters ausschieden. Er wollte nur über die Ausweisung der Eltern des Grünspan aus Hannover unterrichtet werden, weil Grünspan vorbrachte, daß er durch die Nachricht von dieser Ausweisung und die Art, wie diese in der Pariser jüdischen Zeitung geschildert war, so erregt gewesen sei, daß diese Erregung ihn zu der Tat getrieben habe. Für die Hauptverhandlung aber mußte damit gerechnet werden, daß die Verteidigung des Grünspan den Versuch machen würde, die Ereignisse der Kristallnacht in den Prozeß hineinzuziehen. Es wäre dann, wenn das Gericht diese Erörterung nicht hätte verhindern können, eine ernste Lage eingetreten, die meine weitere Mitwirkung an dem Verfahren in Frage gestellt hätte. Denn ich konnte und wollte diese Vorgänge weder rechtfertigen noch entschuldigen. Andererseits hatte ich nicht zulassen können, daß in einem Prozeß, an dem ich mitwirkte, Dinge erörtert wurden, die sich gegen Deutschland ausgewirkt und mit dem eigentlichen Thema des Prozesses nichts mehr zu tun gehabt hätten. Diese Auffassung habe ich deutlich in Berlin zum Ausdruck gebracht. Nach Abschluß der Voruntersuchung habe ich den gesamten Akteninhalt in einem Schriftsatz verarbeitet, in dem ich den Standpunkt der Zivilpartei zu allen Prozeßfragen dargelegt habe. Diesen Schriftsatz habe ich, da der Krieg inzwischen ausgebrochen war, durch einen Genfer Rechtsanwalt in Paris überreichen lassen und zugleich Vertagung der Haupt-Verhandlung erbeten. Der Prozeß ruhte dann auch, bis nach dem Einmarsch der Deutschen 1940 Grünspan von der französischen Polizei den deutschen Behörden übergeben und nach Berlin gebracht wurde. Das Reichsjustizministerium war der Ansicht, daß eine Aburteilung Grünspans in Deutschland möglich sei, weil die Tat auf exterritorialem Boden in der Deutschen Botschaft gegen ein Mitglied der Botschaft begangen worden sei. Die französische Regierung erhob gegen die Aburteilung Grünspans in Deutschland keine Einwendungen. Der französische Untersuchungsrichter und alle französischen Zeugen sollten nach Berlin geladen werden. Dann wurde der Prozeß abgesagt. Den Grund hierfür habe ich nie erfahren. Ich nehme an, daß das deshalb geschah, weil die Entwicklung der militärischen und politischen Lage die Verhandlung eines so delikaten Prozesses mitten im Kriege als untunlich erscheinen ließ. Grünspan war, nachdem er nach Deutschland gebracht worden war, noch zweimal polizeilich vernommen worden. Bei der ersten Vernehmung widerrief er überraschenderweise seine ganze bisherige Darstellung. Er gab jetzt an, daß er nicht aus politischen Gründen, sondern wegen eines privaten Motivs vom Rath getötet habe. Das war ihm offensichtlich von dritter Seite vorher eingegeben worden für den Fall, daß er in die Hände der Deutschen fallen würde. Die Darstellung war offenbar unrichtig und leicht zu widerlegen. Er widerrief sie auch sofort bei seiner zweiten Vernehmung.
Der Grünspanprozeß und der Frankfurterprozeß waren politische Prozesse. Es
waren die bedeutendsten politischen Prozesse jener Zeit. Keine Schilderung der politischen
Justiz von heute kann daran vorübergehen. Aber es war keine entartete politische Justiz.
Die Prozesse waren nötig und wurden korrekt geführt. Aber der Pressekampf um
diese Prozesse
nahm - auf beiden Seiten - Formen an, die den Namen "Krankheit unserer Zeit" verdienen.
31Deutsche Juristenzeitung 1934, S. 238 ff.
...zurück...
32Grundsätzliches zu
den Femeprozessen, Lehmann-Verlag. München 1928, II. Folge. ...zurück...
|