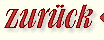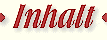|
 Im ersten Weltkrieg Dann kommt der Krieg! Ich stehe vor einem deutschen Gericht in Belgien als Verteidiger von Belgiern und Franzosen! "Was wollen Sie hier?", fährt mich ein etwas rauher Kriegsgerichtsrat in Brüssel an. "Dasselbe wie Sie", erwidere ich, "dem Rechte dienen und damit auch Deutschland!" So fing meine Erfahrung mit der Kriegsjustiz an. Ich war Anwalt der Gegenseite und verteidigte Franzosen und Belgier wegen Kriegsverbrechen. Meine Erfahrungen aber waren, bis auf wenige Ausnahmen, keine schlechten. "Inter arma silent leges!" - "Wenn die Waffen sprechen, schweigen die Gesetze!" - Diese ciceronische Weisheit, die für jeden Krieg gilt, hatte natürlich auch schon im ersten Weltkrieg ihre Bedeutung. Sie trat stärker hervor, je härter der Krieg wurde. Sie nahm aber schlimme Formen erst im zweiten Weltkrieg an, zumal in den letzten Jahren des zweiten Krieges, nach der Erklärung von Casablanca, als der Krieg zum totalen Kriege geworden war. Der Krieg ist nun mal ein "hart Ding", das nur schwer mit Recht in Einklang gebracht werden kann. Volles Recht gibt es nur im Frieden, in Staatswesen, in denen Ruhe und Ordnung herrschen. Ist die Ruhe und Ordnung bedroht, müssen die Staaten, selbst in Friedenszeiten, zu außergewöhnlichen Maßnahmen greifen. Im ersten Weltkrieg aber hat sich diese Entwicklung in normalen Grenzen gehalten, wie ja der erste Weltkrieg überhaupt noch, jedenfalls in der ersten Hälfte, zu den normalen Kriegen zu zählen ist. Kriegsjustiz ist immer in gewissem Sinne politische Justiz, wie ja der Krieg selber stets eine politische Angelegenheit ist. Die Kriegsjustiz ist daher nicht zu beanstanden, soweit sie sich im Rahmen des Kriegsrechts und des Kriegszwecks hält. Das war bei der deutschen Kriegsjustiz des ersten Weltkrieges zu bejahen. Man kann deshalb für die Zeit des ersten Weltkrieges noch nicht von einer Politisierung der Justiz als Entartungserscheinung sprechen. Die Justiz war hart, war Ausnahmejustiz, sie vollzog sich aber in legalen Formen. Als die Völker Europas 1914 nach einer langen Friedenszeit, die wir wohl hauptsächlich Bismarck verdanken, in einen Krieg hineinglitten, dessen Bedeutung und Ausmaß damals nur die wenigsten ahnten, hatten sie das Völkerrecht, das auch für die Kriegszeit Rechtsnormen schuf, zu einer erheblichen Blüte gebracht. Man war stolz darauf, daß es gelungen sei, den Krieg zu humanisieren. Es gab ein Rotes Kreuz in Genf und eine Haager Landkriegsordnung. "Etiam hosti justitia!" - "Gerechtigkeit auch gegenüber dem Feinde!" - war ein Satz, der sich immer mehr durchgesetzt hatte, seitdem die Völker sich darauf besonnen hatten, daß es auch im Kriege gewisse Rechtsregeln gäbe, die selbst dem Feinde gegenüber respektiert werden sollten. Das Reichsgericht bekannte sich 1914 in einer denkwürdigen Entscheidung zu diesen Grundsätzen. Der Krieg, so sagte es, werde zwischen Staaten ausgetragen. Das Recht der Einzelperson aber müsse geachtet werden. Das hinderte natürlich nicht, daß im Kriege auch die Rechtspflege, sowohl den eigenen Staatsangehörigen, als auch den Angehörigen der Gegnermächte gegenüber, dem obersten Gesetz unterstand, daß alle Einrichtungen des Staates dem Endzweck des Krieges, dem Sieg, dienstbar sein sollten. Aber wenn die Gerechtigkeit die Grundlage des Staates war, mußte dieser Satz auch im Kriege noch grundsätzlich Geltung behalten. Die Rechtspflege im Kriege, wie sie besonders durch die Kriegsgerichte geübt wurde, sollte die Sicherheit der Truppen gewährleisten, die innere und äußere Schlagkraft des Landes stärken und den Kampfwillen der Gegner brechen helfen. Man durfte aber nicht vergessen, daß es auch nach dem Kriege ein Fortleben der Völker gab, Ungerechtigkeit aber nur Haß und Mißtrauen schuf, was auch dem eigenen Lande letzten Endes schaden mußte. Von diesen Gesichtspunkten hat sich die deutsche Rechtspflege im ersten Weltkriege leiten lassen, und es ist meine Überzeugung, daß die deutsche Rechtsprechung im ersten Weltkriege, auch die der Kriegsgerichte in den besetzten Gebieten, vor der Geschichte in Ehren bestehen kann. Es gab gewiß Ausnahmen. Denn schließlich sind die Einrichtungen der Staaten, auch die der Rechtspflege, menschliche Angelegenheiten. Wenn ganze Völker mobilisiert werden, wie dies in den beiden Weltkriegen geschah, können nicht alle, die im Namen dieser Völker Befugnisse der Rechtspflege auszuüben haben, Engel sein. Es läßt sich nun einmal nicht vermeiden, daß dann Menschen zu Stellungen berufen werden, denen sie nicht gewachsen sind. So kamen Mißgriffe vor, die aber vereinzelt blieben. Das System als solches war in Ordnung. Das Recht sollte auch dem Feinde gegenüber gewahrt werden. Der Zufall hat gewollt, daß ich schon im ersten Weltkriege als junger Rechtsanwalt die Tätigkeit der deutschen Kriegsgerichte in den besetzten Gebieten näher kennenlernte. Das kam so: Ich war 1915 Dolmetscher im Kriegsgefangenenlager Münster III und kam dadurch zunächst mit der Kriegsgerichtsbarkeit gegenüber den belgischen und französischen Kriegsgefangenen und sodann mit den Kriegsgerichten in den besetzten Gebieten in Berührung. So machte ich schon frühzeitig Erfahrungen mit der Frage der Kriegsverbrecher als internationalem Rechtsproblem. Ein französischer Kriegsgefangener, der Sergeant Courjon, war 1915 vom Kriegsgericht in Münster wegen Mißhandlung deutscher Kriegsgefangener zu einer Gefängnisstrafe - damals waren die Kriegsgerichte noch milde - verurteilt worden. Ich hatte ihm das Urteil zu übergeben und zu erklären, sowie ihn über sein Recht auf Revision zu unterrichten. Ich riet ihm, Revision einzulegen und bin ihm dann bei der Ausarbeitung der Revisionsschrift behilflich gewesen. Es war ein temperamentvoller Südfranzose, ein Mann, der den Mund etwas voll nahm. Er hatte die Unvorsichtigkeit begangen, Tagebuch zu führen. Darin fand sich eine Stelle, in der er sich rühmte, nach einer Schlacht an der Säuberung des Schlachtfeldes teilgenommen zu haben. Die "nettoyeurs" - "Säuberer des Schlachtfeldes" - standen damals in bösem Rufe: "Es war gut, daß ich neue genagelte Stiefel trug. Ich habe dem bayerischen Husaren und dem württembergischen Jäger, die ich verwundet auf dem Schlachtfelde antraf, das Laufen beigebracht", so hieß es wörtlich in seinem Tagebuch. Die Mißhandlung von Verwundeten war erwiesen. Ein Kriegsverbrechen lag vor. Aber war die deutsche Justiz berechtigt, den Täter dieserhalb strafrechtlich zu verfolgen? Diese Frage machte ich zum Gegenstand der Revisionsbegründung. Ich vertrat die Auffassung, daß der Täter, der die Tat vor seiner Gefangennahme begangen hatte, zur Zeit der Tat noch nicht in der Gewalt der Deutschen gewesen und daher nur den französischen Gesetzen unterworfen gewesen sei. Das Reichsmilitärgericht in Berlin schloß sich dieser Meinung an. Das Urteil ist mit ausführlicher Begründung in den Entscheidungen des Reichsmilitärgerichts Jahrgang 1915 abgedruckt worden. Das Urteil erster Instanz wurde aufgehoben, und Courjon kam frei.9 Eine Ergänzung zum Fall Courjon bildete der Fall Raikem, der das Verhältnis der Zivilbevölkerung des besetzten Gebietes zur Okkupationsmacht einer kriegerischen Besetzung betrifft: Raikem, Bürgermeister von Embourg, einem Dorfe östlich von Lüttich, in dem sich ein Außenfort der Festung befand, war in den ersten Kämpfen nach der Einnahme von Lüttich durch ein deutsches Feldgericht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, die er im Zuchthaus zu Münster verbüßte. Ein deutscher Kriegsgefangener, der im Rathaus von Embourg eingesperrt war, hatte nach der Einnahme des Forts bekundet, er habe am Vortage beobachtet, daß der Bürgermeister den Soldaten des Forts Zivilkleider und falsche Pässe ausgehändigt habe, um ihnen das Entweichen zu erleichtern. Darin hatte das Feldgericht Feindbegünstigung gesehen. Das Urteil war rechtskräftig. Das Verfahren gegen die Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete beruhte auf einer kaiserlichen Kabinettsordre. Diese sah keine Rechtsmittel vor. Die Urteile wurden mit der Bestätigung durch den Gerichtsherrn rechtskräftig. Dagegen waren Gnadengesuche an den Kaiser zulässig, die sorgfältig geprüft wurden, und auch auf neue Tatsachen und Rechtsgründe gestützt werden konnten. Die Nachprüfung dieser Gesuche war für die belgischen Fälle dem Generalgouverneur von Belgien und im übrigen dem Präsidenten des Reichsmilitärgerichtes in Berlin übertragen worden. Ich reichte für Raikem, sobald ich den Tatbestand festgestellt hatte, ein Gnadengesuch ein, das ich ausschließlich auf den Rechtsgrund stützte, daß Raikem von einem deutschen Feldgericht nicht verurteilt werden konnte, weil es an der prozessualen und materiellen Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit eines deutschen Strafverfahrens gegen ihn fehlte. Raikem war Belgier, sogar belgischer Beamter. Seine Tat konnte, wenn sie begangen war, nur vor der deutschen Besetzung der Ortschaft begangen worden sein, d. h. zu einer Zeit, als eine tatsächliche Gewalt der deutschen Streitkräfte über den Ort und seine Bewohner noch nicht gegeben war. Diese tatsächliche Gewalt ist aber nach der Haager Landkriegsordnung nötig, um eine Strafgewalt des Okkupanten über die Bewohner des besetzten Gebietes zu begründen. Vor diesem Zeitpunkt sind die Bewohner der besetzten Gebiete nur den Gesetzen ihres eigenen Landes unterworfen und können wegen Taten, die sie zu dieser Zeit begehen, lediglich von den Gerichten ihres Landes zur Verantwortung gezogen werden. Professor Franz von Liszt, Berlin, der große Völkerrechtler, dessen Schüler ich gewesen war, stellte mir ein Gutachten zur Verfügung, in dem er meinen Standpunkt teilte. Das Gesuch hatte Erfolg. Raikem wurde sofort in Freiheit gesetzt. So wurden für mich die Fälle Courjon und Raikem die ersten Musterfälle von Kriegsverbrechern. Sie betrafen einen Kriegsgefangenen und einen Bewohner des besetzten Gebietes. Das sind die beiden Fälle, in denen Angehörige eines kriegführenden Staates mit der Kriegsjustiz des Gegnerstaates in Berührung kommen können. Alle Kriegsverbrecherprozesse fallen in die eine oder andere Kategorie. Das war das Völkerrecht, wie es sich bis zum ersten Weltkrieg unter den zivilisierten Staaten Europas entwickelt hatte. Es entsprach dem rechtlichen Denken aller, der communis opinio juris omnium, das die eigentliche Grundlage des Völkerrechtes ist. Als man diese Grundsätze verließ, beschritt man den Weg der Rechtsentartung, die ihre Vollendung in Nürnberg fand, worunter wir noch heute zu leiden haben. Schon bei dieser ersten Tätigkeit als Verteidiger in politischen Prozessen wurde mir klar, welche Bedeutung die Gnadengesuche gerade auf dem Gebiete der politischen Justiz und der Militärjustiz haben. Die Militärjustiz hat nun einmal, zumal im Kriege und besonders im Bewegungskriege, etwas Summarisches. Irrtümer können vorkommen. Die Wiederaufnahme von rechtskräftigen Urteilen ist aber ein recht unvollkommenes Rechtsmittel, schon deshalb, weil das Verfahren zu langsam vor sich geht. Ich habe die Arbeit der Gnadenabteilung beim Generalgouvernement in Brüssel außerordentlich schätzen gelernt. Sie behandelte die Gnadengesuche wie wahre Rechtsmittel, Rechtsmittel höherer Art, durch die der Staat in außergewöhnlichen Zeiten Urteile, die aus irgendeinem Grunde bedenklich erschienen, auf schnellstem Wege korrigierte. Schon damals habe ich erkannt und habe das später immer wieder bestätigt gefunden, daß es zwei Arten von Gnadengesuchen10 gibt, Gnadengesuche im engeren Sinne, die sich nur auf humanitäre Gründe stützen, Krankheit, gute Führung, familiäre und sonstige persönliche Umstände usw. und Gnadengesuche, die sozusagen als Ersatz für die im Strafrecht fehlende Berufung dienen und auf tatsächliche und rechtliche Gründe gestützt werden, die sonst nur bei echten Rechtsmitteln Berücksichtigung finden können, bei denen also das Urteil als unrichtig angefochten wird. Von den Prozessen, die ich für feindliche Ausländer im ersten Weltkriege führte, ist mir außer den Fällen Courjon und Raikem in besonders guter Erinnerung der Fall Carlier geblieben. Achille Carlier, Bürgermeister von Le Quesnoy, war 1915 von dem deutschen Feldgericht St. Quentin zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, die er im Zuchthaus zu Werden an der Ruhr verbüßte. Es sollte, so wurde mir mitgeteilt, sich um ein Fehlurteil handeln, das die ganze Gegend des besetzten französischen Nordens und auch Belgiens in Unruhe versetzte. Der Schwager von Carlier war der Vorsitzende der Anwaltskammer in Charleroi, Rechtsanwalt Noël. Es gelang ihm, mit Hilfe von deutschen Freunden, bis zum Adjutanten des Generals von Bissing, dem Grafen Blumenthal, vorzudringen, der den Fall dem General vortrug. Bissing entschied, daß ein deutscher Rechtsanwalt, der die französische Sprache beherrschte, den Fall aufklären solle. Die Wahl fiel auf mich. Die Akten wurden mir auf der Staatsanwaltschaft in Essen vorgelegt. Der Staatsanwalt, der mir die Akten gab, hatte für mein Handeln kein Verständnis. "Wie kommen Sie dazu, sich für diesen Mann einzusetzen? Es ist doch Krieg! Das ist unser Feind!", so sagte er. Ich ließ mich nicht beirren. Es war ein Fehlurteil, das Versagen einer einzelnen Person, eines Kriegsgerichtsrates, der seine Aufgabe nicht richtig sah. Carlier war wegen Verbergens französischer Kriegsgefangener verurteilt worden. Es handelte sich um verwundete französische und einen englischen Soldaten, die im Hospital in Le Quesnoy lagen, als der Ort von einem deutschen Landsturmbataillon besetzt wurde. Carlier hatte die Verwundeten den Deutschen übergeben. Dann wechselte das Bataillon. Der neue Kommandant stellte die ordnungsmäßige Übergabe der Gefangenen, die immer noch in Verwahr der deutschen Lazarettverwaltung waren, in Zweifel. Es gelang, durch das Zeugnis des ersten Bataillonskommandeurs, den ganzen Tatbestand zugunsten von Carlier aufzuklären. Carlier kam frei und ist mir zeitlebens in Freundschaft und Dankbarkeit verbunden und ein aufrichtiger Anhänger der deutsch-französischen Verständigung geblieben. Auch die Soldaten wurden freigelassen. Mit Carlier waren damals noch andere Franzosen und Belgier, die durch deutsche Kriegsgerichte in Belgien zu Freiheitsstrafen verurteilt waren, im Zuchthaus von Werden eingesperrt, wo sie demselben Regime wie die Schwerverbrecher unterlagen. Sie hatten die Köpfe kahl geschoren und trugen braune Anstaltstracht. Wenn sie mir vorgeführt wurden, sah ich, daß sie auf den Fluren mit dem Gesicht gegen die Wand aufgestellt waren und nicht miteinander sprechen durften. Dabei waren die meisten von ihnen nicht wegen gemeiner Verbrechen verurteilt, sondern rein politische Häftlinge. Ich verstand nicht, weshalb man politische Gegner, die nichts Ehrenrühriges getan hatten, wie gemeine Verbrecher behandelte. Die Zeit des ritterlichen Krieges war vorüber. Man verurteilte politische Gegner zu Zuchthaus und Gefängnis, wie Diebe und Mörder. Das geschah mit den außenpolitischen Gegnern, aber auch mit den innerpolitischen. Das war so bei uns und bei den Gegnerstaaten. Hierüber habe ich mich damals oft mit dem Direktor des Zuchthauses in Werden, Kretschmar, unterhalten. Er war alter Soldat und ein ritterlich denkender Mensch. Er war der Vater eines meiner Mitschüler und tat alles, um das Los der französischen und belgischen Gefangenen im Rahmen der Vorschriften zu erleichtern. Im Zuchthaus zu Werden saßen aber auch hartgesottene Sünder, wirkliche Schwerverbrecher mit langen Strafen. Als 1923 die Franzosen ins Ruhrgebiet kamen und nunmehr im Zuchthaus von Werden neben den Verbrechern wieder "Politische" einsaßen, diesmal deutsche Industrielle und Arbeiter, Kaufleute, Beamte, Opfer des passiven und aktiven Widerstandes an der Ruhr, wandten sich einige von den Schwerverbrechern an den französischen Anklagevertreter, den Kapitän Duvert, denselben, der die Anklage im Krupp-Prozeß vertrat und Schlageter verhaften ließ. Sie denunzierten die Verwaltung und die Angestellten des Zuchthauses, die dort 1923 teilweise noch Dienst taten, und boten sich als Zeugen dafür an, daß in dem Zuchthaus französische politische Gefangene mißhandelt worden seien. Ich konnte die nötige Aufklärung geben und sogar die Anschrift einiger Franzosen, die in Werden gewesen waren, angeben. Obwohl damals die politischen Leidenschaften auf das höchste gestiegen waren, lehnte der sonst so scharfe Duvert es ab, diese Denunziationen zum Ausgangspunkt eines Kriegsgreuelprozesses zu machen. Die größte Zahl der Prozesse, an denen ich während des ersten Krieges in Belgien als Verteidiger mitwirken konnte, waren sogenannte "Pli-Prozesse", bei denen es um die Rekrutierung junger Belgier für die alliierte Front ging. Der Name kam daher, daß die Leute, die rekrutiert werden sollten, durch Belgien an die holländische Grenze vermittels kleiner Handzettel - plis - geleitet wurden. Der bekannteste dieser Prozesse war der der Miss Cavell, der englischen Krankenpflegerin, die an der Spitze einer solchen Organisation für Rekrutierung von Belgiern stand, und vom Kriegsgericht Brüssel zum Tode verurteilt und erschossen wurde. Man sollte Todesurteile gegen Frauen, auch im Kriege, nicht vollstrecken. Frauen, auch schuldige, die aus Patriotismus handeln und hingerichtet werden, werden in der Öffentlichkeit ihres Landes immer als Märtyrer gefeiert. Das Urteil gegen Miss Cavell war formaljuristisch in Ordnung, aber die Vollstreckung war ein Fehler. Der Name Miss Cavell wirkte in den Feindländern wie ein Fanal. Ihr Tod war für Deutschland schädlicher als ihr Wirken für die Anwerbung von Belgiern gewesen war und hätte werden können, wenn sie bis zum Schluß des Krieges gelebt hätte. Die Alliierten haben im ersten Weltkrieg allerdings auch eine Frau, Mata Hari, wegen Spionage hingerichtet. Die Hinrichtung von Menschen, die politische Gegner sind, im Rahmen eines politischen Prozesses, selbst im Kriege oder aus Anlaß kriegsähnlicher Wirren, ist immer eine bedenkliche Angelegenheit, auch wenn es sich nicht um Frauen handelt. Das zeigte sich im Ruhrkampf 1923 im Falle Schlageter. Zu den Pli-Prozessen des ersten Krieges gehörte auch der Prozeß gegen den französischen Industriellen Paul Foquet von Vireux-Molhain im Givetzipfel. Es handelte sich in diesem Prozeß um eine Organisation, die beschuldigt wurde, die nicht beschäftigten Arbeiter des Werkes über Holland an die Front geleitet zu haben. Neben Foquet, der der Geldgeber sein sollte, war der Pfarrer des Ortes angeklagt, der beschuldigt war, das Haupt der Organisation zu sein. Der Prozeß wurde im Landtagsgebäude in Namur durch ein deutsches Kriegsgericht sachlich geführt, Foquet wurde von der Hauptanklage freigesprochen. Ein Prozeß von grundsätzlicher Bedeutung war ferner der Prozeß gegen die belgischen Steinbruchbesitzer Notté und Lenoir aus Lessines in Belgien vor dem Kriegsgericht in Mons. Sie hatten sich geweigert, Steine und Schotter an die deutschen Besatzungstruppen zu liefern, weil sie annahmen, daß diese Materialien für militärische Zwecke, d. h. zum Bau von Befestigungsanlagen, dienen sollten. Mit ihnen waren einige ihrer Arbeiter angeklagt. Sie hatten sich auf die Haager Landkriegsordnung berufen, die es nicht erlaubt, Bewohner eines besetzten Gebietes zu Arbeiten zu zwingen, die sich gegen ihr eigenes Land richten. Das Kriegsgericht zu Mons hatte die Industriellen zu mehrjährigen Gefängnisstrafen wegen Gehorsamsverweigerung verurteilt, während die Arbeiter mit geringeren Strafen davongekommen waren. Notté und Lenoir verbüßten die Strafe in der Haftanstalt Lüttringhausen bei Remscheid, wo ich sie mehrfach besucht habe. Das Urteil war rechtskräftig. Ich fuhr nach Mons und sah die Akten ein. Dort hatte der Sachbearbeiter gewechselt. Er erkannte an, daß die Industriellen und Arbeiter sich mit Recht auf die Haager Landkriegsordnung berufen hatten, als sie die Arbeit verweigerten. Diese Ansicht wurde auch von dem Generalgouverneur gebilligt. Alle Beteiligten wurden freigelassen. Dieser Prozeß hat dann im Jahre 1923 im Ruhrkampf eine Rolle gespielt. Bei den Prozessen des passiven Widerstandes ging es ja auch um die Frage, ob die Besatzungsmacht berechtigt war, Industrielle und Beamte wegen Ungehorsams zu bestrafen, wenn diese zu Handlungen gezwungen werden sollten, die sie in Gegensatz zu deutschen Gesetzen und Befehlen brachten. So kam es, daß im Prozeß gegen den Oberbürgermeister Zimmermann von Buer vor dem französischen Kriegsgericht in Recklinghausen der französische Staatsanwalt ein Plakat vorlegte, in dem die Feldkommandantur Mons im Jahre 1915 die Verurteilung der Industriellen Lenoir und Notté bekanntgab. Ich konnte dem Staatsanwalt erwidern, daß dieser Rechtsirrtum im ersten Weltkrieg alsbald berichtigt worden sei. Zimmermann wurde darauf freigesprochen. Nach der Urteilsverkündung reichte mir der französische Vorsitzende die Hand und sagte: "Herr Rechtsanwalt, Sie haben das gemacht? Ich beglückwünsche Sie." Solche Gesten menschlichen Verstehens gab es in den politischen Prozessen, die mit dem ersten Weltkrieg zusammenhingen, öfter. Die Ansichten platzten hart aufeinander. Aber es war immerhin noch ein Rechtskampf. Man konnte für seine Meinung eintreten. Durch diese Prozesse kam ich schon im ersten Weltkriege mit allen Fragen in Berührung, die damals die Gemüter in Belgien und Frankreich bewegten und irgendwie mit Prozessen oder sonstigen rechtlichen Maßnahmen der Besatzungsmacht zusammenhingen: Geiselerschießungen, Rekrutierung von Soldaten für die belgische und französische Armee, Arbeiterverschickungen und Franktireurs. Es waren ähnliche Probleme, wie sie uns nach 1945 beschäftigt haben. Besonders die Frage der Franktireure hat damals die öffentliche Meinung in Belgien genau so erregt, wie dies im zweiten Kriege mit den Partisanen der Fall war. Von den Franktireurfällen habe ich einen in besonderer Erinnerung, der die Vorfälle von Löwen zum Gegenstand hatte. Es war der Prozeß gegen de Wyels. Der Chevalier de Wyels war ein Adeliger, der in Löwen mit seiner hochbetagten Mutter lebte. Er war ein Krüppel und ging mühselig an Krücken. Gegen ihn war von einem Hauptmann, der bei ihm einquartiert war, die Anschuldigung erhoben worden, daß er einer der Anstifter des berühmten Überfalls von Löwen sei. Löwen hat damals, zusammen mit Dinant, wo Geiseln erschossen waren, eine ähnliche Rolle gespielt wie heute Oradour und Lidice. In Löwen war es in den ersten Kriegsmonaten 1914 zu Straßenkämpfen gekommen, bei denen die kostbare Universitätsbibliothek ein Raub der Flammen wurde. Die Deutschen warfen den Belgiern vor, daß sie einen heimtückischen Überfall auf die in der Stadt befindlichen Truppen gemacht hätten, der zusammen mit einem Ausfall der eingeschlossenen Garnison von Antwerpen den Deutschen schwere Verluste bringen sollte. Die Frage der Verantwortung für die Entstehung des Zwischenfalles von Löwen, bei dem wohl Mißverständnisse entscheidend mitgewirkt haben, ist nie ganz geklärt worden. Daß aber der Chevalier de Wyels daran nicht beteiligt war, stand für mich fest. De Wyels bewohnte in Löwen ein altes Haus, Château genannt, dessen Vorderseite an einer Straße erster Ordnung, der Rue de Tirlemont, und dessen Rückseite mit Hof und Stallungen an einer kleineren Straße, der Rue de joyeuse entrée, lag. Die Stadt Löwen war von einem mit Bäumen bepflanzten Wall umgeben. An den Stellen, wo die Einfallstraßen diesen Wall kreuzten, befanden sich Pforten - portes -, d. h. kleine Plätze, die den Namen der anliegenden Straßen führten. So gab es auch eine Porte de joyeuse entrée - Pforte zum fröhlichen Einzug! - Es war eine tragische Ironie, daß an dieser Pforte die Schießerei begann, als ein deutsches Bataillon gegen Abend, Musik und Kommandant an der Spitze, in die Stadt einziehen wollte. Die Rue de joyeuse entrée führte in ein Arbeiterviertel, wo nunmehr heftige Kämpfe von Haus zu Haus stattfanden, bei denen die schwersten Verluste auf beiden Seiten zu verzeichnen waren.
Der Chevalier de Wyels hatte im Laufe des Tages in seinem weitläufigen Hause
Einquartierung erhalten, einen Hauptmann und mehrere Offiziere seines Stabes. Dieser
Hauptmann bezichtigte den Chevalier de Wyels, daß er einer der Anführer des
Aufstandes von Löwen gewesen sei. Er habe Schießscharten an der Hinterwand
seines Hauses nach der Rue de joyeuse entrée angebracht, und er, der Hauptmann, habe
selbst gesehen, wie Franktireure von dem Grundstück des de Wyels aus auf die deutschen
Soldaten in der Rue de joyeuse entrée geschossen hätten. Außerdem sei im
Laufe des
Nachmittags ein Mann in deutscher Kraftfahreruniform im Hause erschienen und sei dort
freundlich begrüßt worden. Dieser Mann sei ein Abgesandter der Belgier aus
Antwerpen gewesen, der den Befehl zum Losschlagen in Löwen überbracht
hätte. Es gelang, durch eine Ortsbesichtigung nachzuweisen, daß die
Schießscharten nicht bestanden. Ich ermittelte auch den deutschen Kraftfahrer, der
inzwischen an die Ostfront gekommen war und der bekundete, daß er schon seit zwei
Wochen in dem Hause gewohnt habe und dort freundlich aufgenommen war. De Wyels wurde
darauf freigelassen. Er war das Opfer eines bedauerlichen Irrtums gewesen, der aber
richtiggestellt wurde.
9Entscheidungen des Reichsmilitärgerichts,
Berlin 1915 Bd. 19, No. 65, S. 239 ff.; Deutsche Juristenzeitung 1925, S. 58 ff. ...zurück...
10Grimm, Höhere Gerechtigkeit, Gnade
und Naturrecht, München 1929. ...zurück...
|