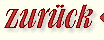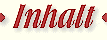|
 Vor dem ersten Weltkrieg Es ist im Frühjahr 1912. Es liegt schon so etwas wie eine nervöse Spannung über der europäischen Welt. Eine Art Vorahnung der schrecklichen Dinge, die da kommen werden. Im Ruhrgebiet ist ein politischer Streik ausgebrochen, der niedergeschlagen werden soll. Vor der Strafkammer des Landgerichts Essen steht eine verhärmte Bergmannsfrau. Sie ist angeklagt wegen Beleidigung eines Arbeitswilligen. Sie hatte diesem das Wort "Streikbrecher" nachgerufen, als er zur Arbeitsstätte ging. Sie weiß, darauf steht schwere Strafe. Nachbarinnen hatten wegen der gleichen Beschuldigung sechs Wochen Gefängnis bekommen und diese Strafe abgebüßt. Ihr Fall war zurückgestellt worden, weil sie erkrankt war. Das war mein erstes Erlebnis, das ich als politische Justiz empfunden habe. Daran habe ich immer wieder denken müssen, wenn ich später die fortschreitende Politisierung der Justiz beobachtet habe. Ich war damals als Referendar der Staatsanwaltschaft Essen zur Ausbildung überwiesen. Man wollte den Streik bekämpfen. Man scheute sich jedoch, den Belagerungszustand zu verhängen. So verfiel man auf folgenden Ausweg: Die Arbeitswilligen wurden von den Streikenden bedroht und beschimpft. Man wollte die Arbeitswilligen schützen, die Streikenden einschüchtern und so den Streik niederzwingen. Die Beschimpfung der Arbeitswilligen erfolgte meist in der Weise, daß Streikende oder deren Frauen den Arbeitswilligen auf dem Weg zur Zeche Worte wie "Hungerleider", "Streikbrecher" usw. nachriefen. Man veranlaßte die Arbeitswilligen, Strafantrag wegen Beleidigung zu stellen. Solche einfachen Beleidigungen wurden in normalen Zeiten mit Geldstrafen geahndet und vor den Schöffengerichten durch Überweisungsklage erledigt. Jetzt erteilte das Justizministerium an die Staatsanwaltschaften die Weisung, in allen derartigen Fällen Anklage bei den Strafkammern zu erheben. In Essen wurde bei der Staatsanwaltschaft ein Sonderdezernat für Streiksachen eingerichtet, dem vier Referendare als Hilfsarbeiter zugeteilt wurden. Dazu gehörte auch ich. Jeder von uns hatte täglich etwa vierzig Anklagen fertigzustellen. Diese mußten mit der Hand in den Akten niedergeschrieben werden. Dadurch sollte der Anschein erweckt werden, als ob es sich um Anklagen handelte, die wie alle anderen erledigt würden, und als ob jeder Fall individuell nachgeprüft worden sei. In Wirklichkeit handelte es sich immer um das gleiche. Man hätte dazu Formulare verwenden können, in denen nur die Namen der Beteiligten, die Schimpfworte und Ort und Zeit der Tat einzutragen waren. Das war Sonderjustiz im Schnellverfahren ohne Wahrung der Bestimmungen über den Ausnahmezustand. Wir Referendare, die wir noch die ideale Auffassung über Rechtspflege hatten, die wir von der Universität mitgebracht hatten, fanden dieses Verfahren bedenklich. Die Staatsanwälte hatten die Instruktion, in all diesen Beleidigungsfällen, wenn sie noch so leicht waren, Gefängnis von l bis 8 Wochen zu beantragen. Das war formell nicht zu beanstanden. Denn die Staatsanwaltschaft war ja nach dem Gesetz an Weisungen gebunden. Aber es war Politik, staatliche Macht, es war kein Recht! Man konnte gewiß sagen, daß unter außergewöhnlichen Umständen ein Delikt, das sonst als ein leichtes Vergehen betrachtet wurde, schwerer zu beurteilen sei. Aber war die Erregung, in der sich die Menschen während des Streiks befanden, nicht auch ein strafmildernder Umstand? Und war es richtig, daß die Gerichte hier in vielen Fällen gleichmäßig urteilten, so daß der Eindruck erweckt wurde, als ob hier eine von oben gelenkte Maßnahme vorläge? Es erwies sich nicht als gut, daß Staatsanwaltschaft und Gericht so eng zusammen arbeiteten. Ich fand es nicht glücklich, daß in der Verhandlung der Anklagevertreter neben dem Gericht am gleichen Tisch auf gleicher Höhe saß, nicht unten, gegenüber dem Verteidiger. Ich fand es auch nicht gut, daß die Staatsanwaltschaften immer mehr in demselben Gebäude untergebracht wurden wie die Richter, wodurch die gegenseitige, zu jeder Zeit mögliche Fühlungnahme so sehr erleichtert wurde. Die Streikjustiz von 1912 rief eine allgemeine Kritik, nicht nur in Arbeiterkreisen, hervor, dies um so mehr als im Ruhrgebiet schon vorher ein politischer Prozeß, der Schröderprozeß, Aufsehen erregt hatte. Ein sozialdemokratischer Parteiführer namens Schröder war wegen Meineids zu Freiheitsstrafe verurteilt, dann aber im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen worden. Ich hatte als Referendar am Amtsgericht Essen einen der Prozeßbeteiligten, den Arbeiterführer Hué, als Zeugen vernommen und dadurch Einblick in den Prozeßstoff erhalten. Als dann der Streik zusammengebrochen war, kam es zu einem Beleidigungsprozeß gegen einen der Essener Rechtsanwälte, Dr. Levy, der in den Streikprozessen Verteidiger gewesen war und diese Justiz in einer politischen Versammlung der SPD "Klassenjustiz" genannt hatte. Der Rechtsanwalt wurde wegen Beleidigung der Richter zu einer nicht sehr hohen Geldstrafe verurteilt. Der Ausdruck "Klassenjustiz" war m. E. nicht angebracht. Aber es war doch politische Justiz, wie sie nicht sein sollte. Niemand warf den Richtern eine Pflichtverletzung vor; denn sie hatten im Rahmen des ihnen zustehenden Ermessens gehandelt. Aber es waren einige bedenkliche Erscheinungen zutage getreten: die Beschleunigung des Verfahrens durch Abkürzung der Ladungs- und Erklärungsfristen, außerdem Besprechungen des Oberlandesgerichtspräsidenten und eines Abgesandten des Justizministeriums mit den örtlichen Justizstellen und ähnliches. In dem Prozeß gegen den Rechtsanwalt Levy kamen alle diese unerquicklichen Dinge zur Sprache. Dabei fiel das Wort, daß die "Justiz auf der Anklagebank" sitze. Es wurde auch die Stellung des Rechtsanwalts in politischen Prozessen grundsätzlich erörtert. War nicht auch der Verteidiger ein gleichberechtigtes Organ der staatlichen Rechtspflege, das berufen war, wie der Staatsanwalt und der Richter ein Hüter des Rechtes zu sein? Bei der Staatsanwaltschaft hatten die Referendare, die in der Ausbildung waren, an einem Tag Sitzungsdienst vor der Strafkammer. Sie mußten dann in Gegenwart des Staatsanwaltes, der sie ausbildete, alle Sachen wahrnehmen, die an dem Tage anstanden. Es war eine feierliche Angelegenheit. Der Referendar erschien im Frack. Der Zufall wollte, daß ich kurz nach Erledigung meines Sonderdienstes im Streikreferat in der Sitzung, die für mich eine allgemeine Prüfung für meine Eignung zum Staatsanwalt sein sollte, auch die Anklage gegen die Bergmannsfrau zu vertreten hatte, deren Fall wegen ihrer Erkrankung zurückgestellt war, und die nun zitternd ihr Urteil erwartete. Ich plädierte nicht auf eine Gefängnisstrafe, sondern stellte die mildernden Umstände heraus: "Der Streik war zu Ende. Eine Geldstrafe genügte." Das Gericht entsprach meinem Antrag. Das gab eine schlimme Auseinandersetzung mit dem mich ausbildenden Staatsanwalt. Ich hätte wie ein Verteidiger plädiert! Ich sah nicht ein, weshalb man mir daraus einen Vorwurf machen wollte. Sollten wir nicht alle dem Rechte dienen - nur dem Recht! -, der Staatsanwalt und der Rechtsanwalt? Sollte nicht auch der Staatsanwalt das Recht suchen helfen und der Rechtsanwalt sich dessen bewußt sein, was er dem Staate schuldig war? So wurde meine Zeit bei der Staatsanwaltschaft in Essen die einzige Station meiner Berufsausbildung, in der ich ein schlechtes Zeugnis erhielt: "Zum Staatsanwalt ungeeignet!" Vielleicht hatte mein Staatsanwalt nicht einmal so unrecht. Darüber war ich mir jedenfalls klar, daß ich mich zu einem "Staatsanwalt im Sonderdezernat" nicht eignete. Damals habe ich zum ersten Mal die Einrichtung der Sonderdezernate kennengelernt. Man wandte die normalen Gesetze an. Aber man gab ihnen eine Anwendung, die nicht mehr normal war. Man schaltete die Staatsräson in die Justiz ein. Immer, wenn ich später dem Wort "Sonderdezernat" begegnete, - Sonderdezernat der Polizei, Sonderdezernat der Staatsanwaltschaft, Sondergericht, - habe ich das Empfinden gehabt, daß irgend etwas mit der Handhabung der Rechtspflege nicht in Ordnung sei. Sonderdezernate! Politische Justiz! Das war eine böse Entwicklung, die sich nach dem Schneeballsystem vollzog. 1912 war das noch ein kleiner Schneeball, von wenigen beachtet. Nach 1918 nahm der Schneeball schon eine bedenkliche Größe an. Die Berufenen warnten. 1933 wurde die Entwicklung bedrohlich, bis dann der neue Krieg kam, die große Krise des Hitlerreiches und schließlich der Zusammenbruch, der, einer Lawine gleich, alles verschlang. Und dennoch! Die Streikjustiz von 1912 war ein Einzelfall gewesen. Vor 1914 konnte man im allgemeinen noch nicht von einer Politisierung als Krankheitserscheinung sprechen. Man kann Dombois nur recht geben, wenn er ausführt, daß "für das 19. Jahrhundert das Problem der politischen Justiz grundsätzlich nicht existierte. Sie schien so überwunden wie etwa die Tortur als Mittel der Wahrheitsfindung. Diese Haltung schien ihre Bestätigung darin zu finden, daß das Phänomen in der Tat in einem erstaunlichen Maße zurückgedrängt war. Das klassische Verbot der Sondergerichte - d. h. das Monopol der ordentlichen Gerichtsbarkeit - und der Grundsatz nullum crimen sine lege schienen formell und materiell das Problem negativ zu erledigen. Ein gewisser Anteil politischer Prozesse vor den ordentlichen Gerichten erschien tragbar - ein Erdenrest, zu tragen peinlich. Der Bereich des Hoch- und Landesverrats wurde in eine echte tatbestandsmäßige Form gebracht und beide darüber hinaus noch möglichst einschränkend ausgelegt. Man glaubte ehrlich, des gefährlichen Bazillus' scheinbaren und tatsächlichen Machtmißbrauchs in der Form der politischen Justiz Herr geworden zu sein."8 Die Zeit vor 1914 erscheint uns deshalb nach all den Wirrnissen, die wir seitdem durchgemacht haben, als das goldene Zeitalter, die Zeit der Ruhe und Ordnung, einer sauberen Verwaltung und unabhängigen Rechtspflege. Eingriffe in die Rechtssphäre gab es auch; aber sie waren selten. Ein Beispiel hierfür ist die Arnimaffäre der Bismarckperiode, die zur Einfügung einer Sonderbestimmung in das Strafgesetzbuch, des sogenannten Arnimparagraphen - § 353 a StGB - durch die Novelle vom 26. Februar 1872 führte. Das geschah, weil Bismarck gegen den früheren deutschen Botschafter in Paris, den Grafen Arnim, wegen Verletzung des diplomatischen Amtsgeheimnisses vorgehen wollte, die damals geltenden Gesetze aber für eine genügende Bestrafung der Tat nicht ausreichend erschienen. Man griff zwar nicht in die Rechtspflege ein. Man erließ nur ein Sondergesetz. Man wagte auch nicht, das Gesetz mit rückwirkender Kraft auszustatten und es auf den Fall Arnim nachträglich anzuwenden. Aber immerhin, es handelte sich um ein Sondergesetz, das aus politischen Gründen mit Rücksicht auf einen Einzelfall erlassen worden war und schon deshalb als eine unerfreuliche Belastung der Rechtsstaatsidee durch die Politik empfunden wurde. Die Lex Arnim wurde erst nach 1945 durch das Kontrollratsgesetz Nr. 11 aufgehoben, aber durch das Strafrechtsänderungsgesetz vom 30. August 1951 wieder eingeführt. Dazu kam das Sozialistengesetz, das auch schon damals von vielen als Verletzung der Rechtsstaatsidee betrachtet wurde. Auch sonst gab es Konflikte, bei denen Staatsräson und politische Notwendigkeiten die Justiz beeinträchtigten. Aber es waren immer nur Ausnahmen, die man noch nicht als Krisenerscheinung ansehen konnte. Die Justiz war intakt, und die Richter waren unabhängig. Es zeigten sich allerdings auch im Bismarckreich schon Schäden, die ihren Ursprung im parlamentarischen System hatten, wie sie in allen demokratisch regierten Ländern vorkommen. Die Parteien nahmen Einfluß auf die Besetzung der Richterstellen, besonders in einigen Oberlandesgerichtsbezirken in Preußen, wo die Richter nach der Konfession ausgewählt wurden. Aber die Unabhängigkeit der Richter wurde dadurch noch nicht berührt. Die Richter genossen das Vertrauen der Mehrheit des Volkes. Die politischen Prozesse der Vorkriegszeit aber waren zumeist politische Prozesse im engeren Sinne, die kaum zu beanstanden waren. Sie beschränkten sich auf die Materien, in denen jeder Staat zur Verteidigung seiner Existenz die politische Justiz nicht entbehren kann, wie Hoch- und Landesverrat. Solche Prozesse können und müssen geführt werden. Der Staat kann auch in außergewöhnlichen Zeiten zu außergewöhnlichen Maßnahmen greifen, wenn seine Sicherheit bedroht ist. Er muß dies nur in legalen Formen tun. Das geht in der Regel nicht ohne Verhängung des Ausnahme- oder Belagerungszustandes. In diesem Falle können auch Ausnahmegerichte eingesetzt werden. Der schon vor 1914 hie und da gegen die Richter erhobene Vorwurf der Klassenjustiz war weder im Kaiserreich, noch in der Zeit der Weimarer Republik berechtigt. Gewiß, der Berufsrichter gehörte den oberen Gesellschaftsschichten an. Das war nötig und nützlich. Denn die Rechtspflege ist nun einmal eine Kunst, die ein umfassendes Wissen erfordert, und nur die sozial gehobene Stellung gibt dem Richter die Unabhängigkeit und Autorität, die sein Amt erfordert. Das Mißtrauen gegen den gelehrten Richter, wie es in autoritären Staaten üblich ist, ist nicht gerechtfertigt. Die Zuziehung von Laienrichtern kann sich in politisch bewegten Zeiten sogar ungünstig auswirken, wenn es den Parteien gelingt, auf die Zusammensetzung der Geschworenen- und Schöffenbänke einen Einfluß zu gewinnen. Es ist allerdings wahr, daß auch schon vor 1914 die Angehörigen der einfachen Stände häufiger die Strafgerichte beschäftigten und die Gefängnisse füllten, als die gehobenen Schichten der Bevölkerung. Das war aber keine Klassenjustiz, beruhte auch nicht darauf, daß die kleinen Leute schlechter wären als die großen. Der Grund dafür war einfach der, daß die wohlhabenden Kreise weniger der Versuchung ausgesetzt sind als die einfachen Menschen, sich aber auch weniger leicht gegenseitig bei Polizei und Staatsanwaltschaft anzuzeigen pflegen, sondern sich scheuen, zu dieser Form der Austragung ihrer privaten Streitigkeiten zu greifen. Der Satz, daß man die Kleinen hänge, aber die Großen laufen lasse, hat oft zu demagogischen Übertreibungen geführt, besonders in politischen Prozessen. Die Gerichte sollen gerecht sein gegen groß und klein. Wer im Staat etwas geleistet hat, soll, wenn er Unrecht begeht, darum nicht besser behandelt werden, als ein anderer; aber es ist erst recht falsch, ihn deshalb schlechter zu stellen als den gewöhnlichen Rechtsbrecher, und damit das Verdienst zu einem privilegium odiosum zu gestalten.
Das Vertrauen, das man vor 1914 ganz allgemein in die Gerichte setzte, konnte übrigens
auch den Staatsanwälten entgegengebracht werden. Auch sie waren ausgesuchte
Persönlichkeiten, die verantwortungsbewußt ihr Amt versahen, besonders im
Vorverfahren, in dem sie oft richterliche Funktionen ausübten. Sie nannten sich gern
"objektivste Behörde" und bemühten sich auch, es zu sein. Das galt jedenfalls
für die normale Strafrechtspflege bis zur Anklageerhebung.
8Dombois (Anm. 2), S. 3. ...zurück...
|