
[171]
Bd. 2: Teil 2: Die politischen
Folgen des Versailler Vertrages
II. Politische Aufgaben des Völkerbundes
(Teil 6)
C) Die Mandatsherrschaft des Völkerbundes
Professor Dr. Freiherrn v.
Freytagh-Loringhoven
Mitglied des Reichstags
1. Die Entstehung des
Mandatssystems
"Nichts als eine Aufteilung der Beute."
Woodrow Wilson, Memoiren und Dokumente I, 212.
"Eine freie, vorurteilslose und völlig unparteiische Zuerkennung aller
Kolonialansprüche, gegründet auf eine strikte Befolgung des
Grundsatzes, nach dem bei der Festsetzung aller derartigen Hoheitsrechte die
Interessen der Bevölkerung gleiches Recht mit den gerechten
Ansprüchen der Regierung, deren Titel in Erwägung zu ziehen ist,
genießen sollen."
So lautet der fünfte der vierzehn Punkte des
Präsidenten Wilson,
deren Anerkennung durch die kriegführenden Parteien die Voraussetzung
der deutschen Waffenstreckung bildete. Aber noch bevor diese vierzehn Punkte
formuliert waren, war zwischen den Mächten der Entente ein Netz von
Verträgen geschlossen, die über die Aufteilung der Beute bestimmten.
Insbesondere bestanden ein englisch-französisches Abkommen über
Togo und Kamerun und ein
englisch-japanischer Vertrag über die deutschen
Südseeinseln, desgleichen
englisch-russische Vereinbarungen über türkisches Gebiet.
Darüber hinaus hatten englische Staatsmänner sich mehrfach
unzweideutig gegen die Herausgabe der mit Waffengewalt in Besitz genommenen
deutschen Kolonien ausgesprochen.
Dieser Gegensatz zwischen Wilsons Programm und den Absichten seiner
Verbündeten trat unverweilt zutage, als die Friedenskonferenz am 23. Januar
1919 zur Erörterung der Kolonialfragen überging. Zunächst
ergab sich zwar volle Einigkeit darüber, daß Deutschland seine
Kolonien nicht zurückerhalten solle. Unter Berufung auf
Äußerungen Erzbergers, Dernburgs und Bebels wurde ihm das
sittliche Recht auf Kolonialbesitz abgesprochen und damit die koloniale
Schuldlüge geschaffen. Aber die Einigkeit erhielt einen Riß, als es galt
über das Schicksal der Kolonien zu befinden.
Lloyd George erwog und verwarf gleichermaßen die zwei
Möglichkeiten einer Verwaltung der Kolonien durch den Völkerbund,
wie durch einen von diesem beauftragten Staat. Er empfahl die Annexion [172] schlechtweg. Ihm schlossen sich die am
24. Januar zur Beratung hinzugezogenen Vertreter der Dominions an und
denselben Standpunkt nahmen Japan, Frankreich und Belgien ein.
Präsident Wilson widersetzte sich. Er erkannte jedoch, daß dem
Willen zur Annexion ein positiver Gedanke entgegengestellt werden müsse.
In seinem ersten Entwurf einer Völkerbundssatzung, den er bereits in
Amerika ausgearbeitet hatte, fand sich ein solcher nicht. Nach seiner Ankunft in
Paris aber lernte er den Entwurf des Generals Smuts kennen, der ein
Mandatssystem für die Rußland,
Österreich-Ungarn und der Türkei abgenommenen Gebiete vorsah.
Dieser Gedanke verband sich in ihm mit Vorstellungen, die in Amerika schon
früher heimisch gewesen waren. Hatten doch MacKinley und Roosevelt
bereits um die Jahrhundertwende von Vormundschaftspflichten der Vereinigten
Staaten den Philippinen gegenüber gesprochen. So entstand der später
auch auf die türkischen Gebiete erstreckte Plan, die deutschen Kolonien
einem Mandatsystem zu unterwerfen, ein Plan, der dem General Smuts durchaus
ferngelegen hatte.
Erst nach heftigen Kämpfen gelang es dem Präsidenten, seinem
Vorschlage zur Annahme zu verhelfen. Aber die notgedrungene
grundsätzliche Zustimmung hinderte die Ententemächte nicht, hier,
wie in so vielen anderen, auf der Friedenskonferenz erörterten Fragen,
nunmehr die praktischen Auswirkungen des ihnen aufgezwungenen Prinzips nach
Möglichkeit abzuschwächen und sich auf solche Weise ihren
ursprünglichen Zielen wieder zu nähern. Unter diesem Gesichtspunkt
forderten sie insbesondere eine Differenzierung der künftigen
Mandatsländer. Vor allem drängten die Dominions auf die Schaffung
einer dritten Klasse von Mandaten, der sog.
C-Mandate, die "nach den Gesetzen des Mandatars als integrierender Bestandteil
seines Gebiets" verwaltet werden sollten und in deren Bereich der Grundsatz der
offenen Tür für die anderen Bundesmitglieder nicht gelten sollte, die
somit praktisch trotz allem einem annektierten Lande gleichgestellt wurden. Dem
gleichen Ziel dienten die französischen Vorbehalte über das in den
Mandatsländern zu beobachtende Wehrsystem. Ihm dienten nicht minder die
überaus unklaren Bestimmungen über die Verteilung der Mandate und
über die Festsetzung der dem Mandatar zu gewährenden
Befugnisse.
Präsident Wilson, befriedigt durch die Annahme seines Grundgedankens,
fand sich mit all diesen Abschwächungen ab, wie er sich auf der
Friedenskonferenz im großen wie im kleinen stets damit abgefunden hat,
daß seine Gedanken im Prinzip angenommen, praktisch aber bis zur
Unkenntlichkeit verstümmelt wurden. Vielleicht darf die Gestaltung des
Mandatsrechts gar als Schulfall angesehen werden, der in besonders
augenfälliger Form zeigt, wie die Grundsätze Wilsons
tatsächlich in ihr Gegenteil verkehrt wurden.
[173] Die Verbündeten durften mit dem, was sie
erreicht hatten, zufrieden sein. Sie durften es um so mehr, als Wilsons
Staatssekretär Lansing sicherlich recht hat, wenn er darauf hinweist,
daß sie durch die Anerkennung des Mandatssystems davor bewahrt blieben,
den Wert der Kolonien auf die Deutschland auferlegten Kriegstribute anrechnen zu
müssen.
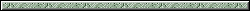
2. Die Rechtsquellen
Quelle des Mandatsrechts ist Art. 22 der
Satzung des Völkerbundes. Er baut
sich auf auf den Bestimmungen der Friedensverträge, die den Verzicht
Deutschlands und der Türkei auf ihre dem Mandatssystem unterworfenen
Gebiete enthalten. Es sind das Art. 118 und
119 des
Versailler und Art. 1 und 17
des Lausanner Vertrages.
Grundsätzlich enthält Art.
22 das gesamte Mandatsrecht. Es gibt keine
andere, ihm gleichgeordnete Rechtsquelle. Eine solche könnte nur durch
Ergänzung oder Abänderung der Satzung auf dem in Art. 26
vorgesehenen Wege geschaffen werden. Solange dieser Weg nicht beschritten ist,
bleibt Art. 22 in
seinem ursprünglichen Wortlaut allein maßgebend.
Alle von Organen des Völkerbundes ausgehenden Normen, die das
Mandatssystem betreffen, können nur den Charakter von
Ausführungsbestimmungen zu Art.
22 haben und dürfen ihm daher
keinesfalls zuwiderlaufen. Und es versteht sich von selbst, daß eine dem Art.
22 widersprechende Praxis der Bundesorgane als rechtswidrig angesehen werden
muß.
Die Feststellung dieses Grundsatzes ist um so notwendiger, als die Fassung des
Art. 22 der
Auslegung einen sehr weiten Spielraum läßt. Nicht nur
enthält er eine Anzahl von Sätzen, die keine Rechtsregeln, sondern
ethisch-politische Gedanken verkünden. Auch diejenigen Sätze, deren
Inhalt als juristisch im eigentlichen Sinne angesprochen werden darf, entbehren der
Klarheit und Bestimmtheit, die für eine rechtliche Norm unentbehrlich sind.
Das ist freilich ein Kennzeichen der Satzung überhaupt.
Ausgesprochenermaßen war beabsichtigt, sie so zu formulieren, daß
den Staatsmännern, die sie anwenden würden, die Hände nicht
gebunden wären und daß sie die Möglichkeit behielten, den
politischen Notwendigkeiten Rechnung zu tragen. Dazu kam der Zwang, die
widerstrebenden Interessen und Wünsche der beteiligten Mächte zu
berücksichtigen. Vielfach mußte eine Form gewählt werden, die
jedem der Unterzeichner die Möglichkeit ließ, an seiner Auslegung
der beschlossenen Regel festzuhalten, mochte sie der der Verhandlungsgegner
noch so schroff widersprechen. Gerade dieser Umstand spielte, wie die
Entstehungsgeschichte ergibt, bei der Formulierung des Art.
22 eine besonders
große Rolle. Galt es doch, eine Fassung zu finden, die den Zwiespalt
zwischen den Annexionsgelüsten der europäischen
Verbündeten [174] und den ganz anders gerichteten Zielen Wilsons
überbrückte. So ergab sich eine Fülle von Unklarheiten, die
einerseits eine objektive, auf wissenschaftliche Grundsätze gestützte
Auslegung in hohem Maße erschweren, andererseits eine willkürliche
und tendenziöse Anwendung des Art.
22 in ebenso hohem Maße
erleichtern. Von den sich dadurch eröffnenden Möglichkeiten aber
konnte um so eher Gebrauch gemacht werden, als die Vereinigten Staaten dem
Völkerbunde fern blieben und daher im Rate nur die Träger der
Annexionspolitik vertreten waren, die praktische Anwendung des Art.
22 demnach allein in ihren Händen lag.
Unter diesen Umständen ist es nicht überraschend, daß die vom
Rat in Ausführung des Art. 22
gefaßten Beschlüsse in allen
wesentlichen Fragen und insbesondere dann, wenn sie grundlegenden und
grundsätzlichen Charakter haben, auf eine Erweiterung der Rechte der
Mandatsmächte abzielen und in Abweichung von den Wilsonschen
Gedanken den Unterschied zwischen Mandatsland und annektiertem Gebiet zu
verwischen bestrebt sind. Das gilt schon für den vom Rat in seiner Tagung
vom August 1920 angenommenen Bericht des Belgiers Hymans, in dem die
für das Mandatssystem maßgebenden Grundsätze aufgestellt
wurden und der sowohl vom Rat selbst, als auch vom Mandatsausschuß als
richtunggebend angesehen wird. Das gilt in vielleicht noch höherem
Maße für die von den Hauptmächten ausgearbeiteten und vom
Rat bestätigten Mandatsverträge, in denen die Machtbefugnisse der
Mandatare festgelegt sind. Wird im
Hymans-Bericht das Verfügungsrecht der verbündeten
Hauptmächte zuungunsten des Völkerbundes in den Vordergrund
geschoben, so verleihen die Verträge den Mandataren
Zuständigkeiten, die weit über das hinausgehen, was Wilson ihnen
zubilligen wollte und was Art. 22
ihnen seinen Grundgedanken nach zusprechen
konnte.
Hymans-Bericht und Mandatsverträge müssen, soweit sie mit Art. 22
nicht übereinstimmen, als rechtswidrig und deshalb als ungültig
bezeichnet werden. Aber so unstreitig diese Feststellung unter
grundsätzlichen Gesichtspunkten ist, so bedeutungslos ist sie unter
praktischen. Denn sowohl der
Hymans-Bericht als die Mandatsverträge sind seit bald einem Jahrzehnt
tatsächlich in Kraft und werden unbeanstandet angewendet. Zwar hat
Deutschland durch eine Note vom 12. November 1920 gegen den
Hymans-Bericht Einspruch erhoben, da die in ihm verkündeten
Grundsätze zu einer Ausschaltung des Völkerbundes und
insbesondere der Völkerbundsversammlung führten und
tatsächlich an die Stelle der Verwaltung zu Mandatsrecht die Annexion
setzten. Aber dieser Note ist keinerlei Folge gegeben und bei seinem Eintritt in den
Völkerbund hat Deutschland es unterlassen, irgendwelche Vorbehalte gegen
das vom Rat angewandte Mandatssystem zu machen. Vollends hat es gegen die
Mandatsver- [175] träge nicht protestiert. Nachdem es
nunmehr seit dem September 1926 selbst Mitglied des Rates ist und seit dem 8.
September 1927 sein Vertreter im Mandatsausschuß sitzt, wird es sich
schwer dem Argument entziehen können, daß es
Hymans-Bericht und Mandatsverträge nicht nur stillschweigend anerkannt,
sondern bei ihrer Anwendung als Rechtsquellen auch mitgewirkt hat. Es liegt hier
zweifellos ein tief bedauerliches Versäumnis vor, das in vollem Umfange
wohl nur bei einer Änderung der gesamten politischen Konjunktur wieder
gutgemacht werden könnte. Im einzelnen freilich dürfte vieles schon
jetzt gebessert werden können, wenn die deutsche Vertretung im Rat und im
Mandatsausschuß sich entschlösse, die zu Gebote stehenden Mittel
folgerecht anzuwenden, vor allem, um eine weitere, den deutschen Interessen
abträgliche Entwicklung zu verhindern. In erster Reihe käme hier die
Anwendung der in sämtlichen Mandatsverträgen enthaltenen
Bestimmung in Frage, kraft welcher Meinungsverschiedenheiten über die
Auslegung und Anwendung der Mandatsverträge vom Ständigen
Internationalen Gerichtshof zu entscheiden sind. Darüber hinaus wäre
es Sache der deutschen Vertretung, den auf eine Erweiterung ihrer Rechte
abzielenden Bestrebungen der Mandatsmächte entgegenzuwirken. Das
hervorstechendste Beispiel hierfür stellen die englischen Pläne
über die Einbeziehung Ostafrikas in ein neu zu bildendes Dominion dar.
Solange die deutsche Vertretung diesen Weg nicht beschreitet, vielmehr
stillschweigend die Anwendung rechtswidriger Normen duldet und sich an der
Befolgung einer rechtswidrigen Praxis beteiligt, bleibt die wissenschaftliche
Feststellung der Rechtswidrigkeit dieser Normen und dieser Praxis bedeutungslos.
Die Normen werden weiterhin angewandt und als geltendes Recht betrachtet, die
Praxis aber entwickelt sich fort und schafft neue Verhältnisse, die zwar in
ihrer Wurzel rechtswidrig sind, jedoch unangefochten bestehen und von der
öffentlichen Meinung, die nur durch staatliche Akte, nicht aber durch
wissenschaftliche Äußerungen beeinflußt werden kann, als
rechtsgültig angesehen werden. Im Ergebnis kann sich so auch hier der
Prozeß vollziehen, für den Otto von Gierke die Formel gefunden hat:
die rechtlose Macht wird im Laufe der Zeit mit dem Schimmer des Rechts
umkleidet.
Aber schon bevor dieser Prozeß vollendet ist, kann eine Darstellung, die
nicht in weltfremdem Doktrinarismus befangen ist, an der Tatsache nicht
vorübergehen, daß neben die richtigen Normen andere getreten sind,
die gleiche und sogar überwiegende Bedeutung tatsächlich errungen
haben und daß deshalb das heute angewandte Mandatsrecht nicht mehr auf
dem Art. 22
fußt, sondern auf den teilweise im Widerspruch zu ihm vom
Völkerbundsrate geschaffenen Normen.
[176]
3. Die Rechtslage der
Mandatsgebiete
Nach dem Wortlaut des Art. 22
beruht das Mandatssystem ausschließlich auf
altruistischen Beweggründen. Es soll allein dem Wohl der
Mandatsländer dienen und der Völkerbund soll darüber
wachen, daß die den Mandatsmächten übertragene
Vormundschaft nur in diesem Sinne ausgeübt werde. Insbesondere ist als
Zweck des Systems eine Erziehung der ihm unterworfenen Völker
anzusehen, die sie für eine volle Selbständigkeit reif machen soll.
Dieses ist zwar nicht ausdrücklich ausgesprochen, ergibt sich aber nicht nur
aus der Anwendung des Ausdrucks "Vormundschaft", sondern auch daraus,
daß das Mandatssystem nach Abs.
1 auf die Völker erstreckt werden
soll, die "noch nicht imstande sind, sich unter den besonders schwierigen
Bedingungen der heutigen Welt selbst zu leiten" und daß "die Entwicklung
dieser Völker" neben der Förderung ihres Wohlergehens die Aufgabe
des Systems darstellt.
Unter diesen Gesichtspunkten soll die Vormundschaft über solche
Völker fortgeschrittenen Nationen übertragen werden, die imstande
und bereit sind, sie zu übernehmen. Sie sollen sie als Mandatare des Bundes
und in seinem Namen führen.
Das Mandat ist eine dem Völkerrecht bisher fremde Einrichtung. Angesichts
der unzureichenden und mangelhaft gefaßten Bestimmungen des Art. 22 ist
es daher begreiflich, daß seine rechtliche Beurteilung erhebliche
Schwierigkeiten und weitgehende Meinungsverschiedenheiten hervorruft. Will man
zu einem positiven Ergebnis kommen, so wird man vor allem den Zweck des
Mandats ins Auge fassen und daneben die bürgerlich-rechtlichen Begriffe des
Mandats und der Vormundschaft hilfsweise heranziehen müssen, ohne
freilich zu verkennen, daß von dieser Analogie nur mit großer Vorsicht
Gebrauch gemacht werden darf.
Verfährt man so, so wird man zu dem Schluß gelangen, daß die
Mandatsgebiete als Subjekte des Völkerrechts oder, anders
ausgedrückt, als völkerrechtliche Persönlichkeiten eigener Art
anerkannt werden. Eine Sonderstellung wird hierbei den vormals türkischen
Gebieten zugewiesen, die unter gewissen Beschränkungen als
unabhängige Nationen und damit als Staaten ausdrücklich anerkannt
werden. Aber die Rechtspersönlichkeit kann auch den deutschen Kolonien
nicht bestritten werden. Sie werden den Mandatsmächten nicht einverleibt,
behalten vielmehr, auch soweit sie als Teil derselben verwaltet werden,
grundsätzlich ein selbständiges Dasein. Ihren Einwohnern spricht der
Rat eine besondere Landesangehörigkeit zu und auf ihr Domanialeigentum
hat die Mandatsmacht keine fiskalischen Rechte. Ihr Besitzstand muß
gewahrt werden. Gebietsaustausch selbst bei Grenzregulierungen bedarf der
Genehmigung des Rats. [177] Eine Übertragung des Mandats an eine
andere Macht ist gleichfalls nur mit einer solchen Genehmigung statthaft. Alle
diese Grundsätze sind vom Rat ausdrücklich anerkannt worden.
Eine eigene Staatsgewalt allerdings fehlt den Mandatsländern mit Ausnahme
der türkischen Gebiete, von denen der Irak sie bereits besitzt,
Palästina und Syrien sie erhalten sollen. An ihrer Stelle steht die
vormundschaftliche Gewalt der Mandatsmacht, die nicht mit der Staatsgewalt der
Mandatsmacht wesensgleich ist. In ihr verkörpert sich die staatsrechtliche
und völkerrechtliche Handlungsfähigkeit des Mandatsgebiets. Doch
ist sie ihrerseits durch die Rechte des Völkerbundes beschränkt, der in
Art.
22 Abs. 2 als Mandant anerkannt ist und zugleich Befugnisse ausübt,
die denen eines Obervormunds verglichen werden können.
Aus der grundsätzlichen Bestimmung des Abs.
2 müßte der
Schluß gezogen werden, daß der Bund die Mandatare ernennt, ihre
Rechte und Pflichten festsetzt und die Führung der Vormundschaft
überwacht. Die Frage der Überwachung wird denn auch in Abs. 7 und
9 geregelt. Dagegen findet sich in Art.
22 kein Wort über die Ernennung der
Mandatare. Von der Festsetzung der Rechte und Pflichten aber spricht Abs. 8 und
bestimmt, daß der Rat hierüber entscheidet, wenn nicht "der Grad von
Machtbefugnis, Überwachung und Verwaltung, den der Mandatar
ausüben soll, bereits Gegenstand eines vorgängigen
Übereinkommens zwischen den Bundesmitgliedern" gewesen ist.
Die infolge dieser ungenügenden Regelung entstehenden Lücken sucht der
Hymans-Bericht auszufüllen. Er geht vom Versailler Vertrage aus, der eine
Einheit mit der Satzung des Völkerbundes bilde und deshalb zu ihrer
Auslegung herangezogen werden dürfe. Hier verzichte Deutschland
zugunsten der Hauptmächte auf seine überseeischen Besitzungen und
erkenne in Art. 118
Abs. 2 alle Maßnahmen an, die die Hauptmächte
zur Regelung der sich daraus ergebenden Folgen treffen würden. Dadurch
sei den Hauptmächten auch die Ernennung der Mandatare zugestanden.
Diese Beweisführung ist nicht schlüssig. Deutschland
gegenüber hatten die Hauptmächte allerdings freie Hand. Aber hier
geht es um ihr Verhältnis zum Völkerbunde und da ergibt sich aus
Art. 22
zwingend, daß diesem die Ernennung der Mandatare zustehen
muß. Das ist eine unausweichliche Folgerung daraus, daß sie nach
Abs. 2 eben seine Mandatare und nicht etwa die der Hauptmächte sein
sollen. Eine andere Regelung wäre nur denkbar, wenn Art. 22 sie
ausdrücklich ausspräche. Und selbst dann müßte
hervorgehoben werden, daß sie im Widerspruch zum Grundgedanken des
Instituts des Mandates stünde, das unzweifelhaft auch auf
völkerrechtlichem Gebiet auf dem Vertrauen des Mandanten zum Mandatar
beruht.
[178] Hymans sucht über die augenscheinlich
auch ihm sich aufdrängenden Bedenken hinwegzukommen, indem er den
Mandataren einen doppelten Titel geben will. Die Hauptmächte sollen dem
Völkerbundrat diejenigen Mächte bezeichnen, denen die Mandate zu
verleihen sie beschlossen haben, der Rat aber soll von der Ernennung Kenntnis
nehmen und sie den beliehenen Mächten notifizieren. Hymans erklärt
das für eine reine Formfrage und in der Tat ist die von ihm vorgeschlagene
Lösung rein formell. Denn von einem
Bestätigungs- und Einspruchsrecht des Rates ist nicht die Rede. Wenn ihm
die Notifizierung übertragen wird, so mag das äußerlich eine
Rücksicht auf sein Prestige bedeuten. In Wirklichkeit fällt ihm eine
Botenrolle zu.
Daß der Belgier Hymans, dessen Heimatstaat zwar ein Mandat erhielt, aber
selbst nicht zu den Hauptmächten gehört, eine solche Stellung
einnahm, dürfte auf einer vorhergehenden diplomatischen Vereinbarung
beruhen. Denn aus juristischen Erwägungen läßt sie sich
keinesfalls ableiten. Es ist aber auffallend, daß eine solche Vereinbarung
für notwendig gehalten wurde. Die Hauptmächte beherrschten den
Rat damals in noch höherem Maße als jetzt und hätten die
Ernennung der ihnen genehmen Mandatare ebenso leicht durchsetzen
können, wie die Annahme des
Hymans-Berichts. Wenn sie trotzdem diesen Umweg wählten, kann der
Zweck nur der gewesen sein, sich auch für die Zukunft die Verfügung
über die Mandate zu sichern oder, was praktisch bedeutsamer ist, sie dem
Völkerbunde vorzuenthalten. Es mußte ihnen darauf ankommen, die
Möglichkeit auszuschalten, daß der Völkerbund einem von
ihnen, etwa wegen Mißbrauchs seiner Befugnisse, das Mandat entziehen
könnte oder daß er einen Turnus der Mandatsmächte
herbeiführte. Deshalb war es unumgänglich, den Hauptmächten
das Recht zur Ernennung der Mandatare zuzusprechen. Von einem Recht auf
Entziehung des Mandats ist im
Hymans-Bericht zwar nicht die Rede. Aber es liegt auf der Hand, daß
gegebenenfalls der Schluß gezogen werden würde, daß dieses
Recht nur derselben Instanz zustehen könne, die zur Verleihung befugt
ist.
Eine solche Regelung steht, das sei nochmals betont, im Widerspruch zum
Grundgedanken des Art.
22. Aber der Rat hat sie anerkannt und sie ist
tatsächlich angewendet worden. Infolgedessen muß, praktisch
betrachtet, zugestanden werden, daß die Verfügung über die
Mandate bei den Hauptmächten liegt. Dem Rate bleibt
demgemäß nur eine formelle Mitwirkung bei der Verteilung und ihm
bleibt weiter die Nachprüfung der Mandatsverträge und die
Ausübung der Aufsicht über die Ausübung des Mandats.
Unter diesen Umständen kann die Frage nach dem Inhaber der
Souveränität über die Mandatsländer nicht so einfach
beantwortet [179] werden, wie das im deutschen Schrifttum
überwiegend geschieht. Zwar ergibt sich sicherlich aus Art.
22, daß die
Souveränität dem Völkerbunde gehören soll. Nachdem
jedoch der Rat namens des Bundes auf die wichtigsten, aus der
Souveränität erfließenden Befugnisse zugunsten der
Hauptmächte verzichtet hat, wird sich nicht bestreiten lassen, daß die
Ausübung der Souveränität zwischen diesen und ihm geteilt ist.
Das aber führt unweigerlich zu dem Schlusse, daß Bund und
Hauptmächte sie gemeinsam innehaben, mag das auch dem Willen der
Satzung widersprechen.
Dagegen können die Hauptmächte für sich allein Anspruch auf
die Souveränität nicht erheben. Soweit es um die deutschen Kolonien
geht, können sie sich zwar darauf berufen, daß nach Art.
118 und 119
des Versailler Vertrages die Kolonien an sie abgetreten sind. Dem steht jedoch
entgegen, daß die Verwaltung mit ihrer Zustimmung im Namen und unter
Aufsicht des Bundes geführt wird. Das ihnen allein verbliebene Recht der
Ernennung und gegebenenfalls der Abberufung der Mandatare ist keinesfalls
gleichbedeutend mit Souveränität. Gilt das schon für die
deutschen Kolonien, so kann für die türkischen Gebiete eine
Souveränität der Hauptmächte vollends nicht in Frage
kommen, da Art. 17 des Lausanner Vertrages den Verzicht der Türkei auf
diese Gebiete zum Ausdruck bringt, ohne der Hauptmächte
Erwähnung zu tun.
Unhaltbar ist die im französischen Schrifttum anzutreffende Auffassung, als
seien die Mandatsmächte Träger der Souveränität. Eine
Verwaltung im fremden Namen und unter fremder Aufsicht ist mit
Souveränität unvereinbar. Diese Auffassung ist denn auch auf den
entschiedenen Widerspruch des Mandatsausschusses gestoßen, als sie von
der Regierung der Südafrikanischen Union im Hinblick auf
Deutsch-Südwest vertreten wurde.
Ausgangspunkt der Erörterung war die Tatsache, daß die Union sich
im Vorspruch zu einem mit Portugal am 22. Juni 1926 abgeschlossenen
Grenzvertrage die Souveränität, allerdings unter Vorbehalt der
Bestimmungen des Mandats, zugeschrieben hatte. Der Mandatsausschuß
erblickte hierin den Ausdruck von Ansprüchen, die mit dem Grundprinzip
des Mandatssystems nicht zu vereinen seien. Er berichtete hierüber dem Rat
und der Berichterstatter Beelarts van Blokland gab die Meinung des Ausschusses
dahin wieder, daß die Ausdrucksweise der Südafrikanischen
Regierung mißverständlich sei. Das Mandatssystem sei eine neue
völkerrechtliche Institution und deshalb passe die übliche
Terminologie nicht. Im übrigen sei die Situation unter praktischen
Gesichtspunkten vollkommen klar. Schwierigkeiten ergäben sich allenfalls
unter formellen Gesichtspunkten. Eine Stellungnahme des Rats erscheine nicht
notwendig, doch mögen diese [180] Bemerkungen des Ausschusses der
Mandatsmacht zur Kenntnis gebracht werden.
Das geschah und die Unionsregierung verzichtete auf eine Erwiderung, da Rat und
Ausschuß ihre Auffassung der Rechtslage nicht präzisiert
hätten. Im Südafrikanischen Parlament jedoch berichtete der
Premierminister am 11. März 1927 über diese Vorgänge und
berief sich hierbei auf einen Spruch des Obersten Gerichtshofs, der die Union als
alleinigen Träger der Souveränität bezeichnet hatte.
Beiläufig bemerkt, hatte dieser Spruch auch hervorgehoben, daß die
Souveränität nicht dem König gehöre, eine Behauptung,
die für die Beurteilung der innern Verhältnisse des Britischen
Imperiums um so kennzeichnender ist, als nach dem Wortlaut des
Mandatsvertrages das Mandat für
Südwest-Afrika übertragen wird "Sr. Britischen Majestät um in
seinem Namen ausgeübt zu werden durch die Regierung der
Südafrikanischen Union".
Nunmehr sah sich der Mandatsausschuß veranlaßt, den Rat abermals
auf die Auffassung der Mandatsmacht aufmerksam zu machen und die
Hoffnung auszusprechen, daß die Unionsregierung ihre Stellungnahme
präzisieren werde. Der Rat stellte sich in einer Entschließung vom 8.
September 1927 auf den Standpunkt des Ausschusses und machte der Union
Mitteilung davon. Diese begnügte sich jedoch damit, in einem Schreiben
vom 10. Februar 1928 den Empfang zu bestätigen und zu erklären,
daß sie angesichts der Meinungsäußerung des Rates keine
Bemerkungen vorzulegen habe.
Die strittige Frage ist somit in der Schwebe geblieben. Nichtsdestoweniger glaubte
die Bundesversammlung am 27. September 1927 den Rat dazu
beglückwünschen zu können, daß er die wichtige und
schwierige Frage in so befriedigender Weise geklärt habe.
Im Gegensatz zu dieser Auseinandersetzung ist eine andere Erörterung
über die gleiche Frage zu einem formell befriedigenden Abschluß
gekommen. Der Mandatsausschuß hatte beanstandet, daß in der
Eingangsformel von Gesetzen für das Territorium Tanganyika die
Mandatsqualität nicht zum Ausdruck gekommen war. Darauf teilte die
britische Regierung unter dem 12. Januar 1928 dem Generalsekretär des
Völkerbundes mit, daß die fragliche Formel vor 1920 redigiert und
versehentlich weiter benutzt worden sei. In Zukunft würde die
Mandatseigenschaft des Gebiets erwähnt werden.
Endlich käme noch die vierte Möglichkeit in Frage, daß das
Mandatsland selbst Träger der Souveränität sei. Sie erledigt
sich für die
B- und C-Mandate von selbst durch den Hinweis, daß die hierher
gehörigen Gebiete nicht Staaten sind, während die
A-Mandate, insbesondere der Irak, zwar als Staaten anzuerkennen sind, aber die
Souveränität nicht besitzen, da sie eben unter fremder Vormundschaft
stehen.
[181]
4. Die Befugnisse der
Mandatare
Die Befugnisse der Mandatsmacht werden durch Art.
22 bestimmt und im
einzelnen in den Mandatsverträgen festgesetzt. Grundlegend ist hierbei die
Einteilung der Mandatsgebiete in drei Gruppen, für die die Bezeichnung mit
A, B und C üblich geworden ist.
Wesentlich für die A-Mandate, zu denen das Irak, Palästina und
Syrien gehören, ist, daß die Mandatsmacht im Einvernehmen mit der
Bevölkerung zu wählen ist und daß sie "als unabhängige
Nationen vorläufig anerkannt werden", während die Mandatsmacht
ihnen nur Beratung und Unterstützung zu leihen hat. In Wirklichkeit freilich
hat eine Befragung der Bevölkerung vor der Ernennung der Mandatare nicht
stattgefunden und die in Art. 22
zugestandene Selbständigkeit genießt
nur das Irak, dessen Verhältnis zu England im übrigen auch nicht
durch einen Mandatsvertrag, sondern durch einen zwischen England und dem Irak
abgeschlossenen und zur Kenntnis des Völkerbundrates gebrachten
Bündnisvertrag vom 10. Oktober 1922 nebst mehreren Zusatzabkommen
bestimmt wird. Hier hat sich England eine Stellung gesichert, die als
völkerrechtliches Protektorat bezeichnet werden darf und es erscheint
durchaus fraglich, ob ein Mandatsverhältnis überhaupt vorliegt. Sehr
viel weiter gehende Rechte sind Frankreich in Syrien zugestanden. Das
Schwergewicht liegt in Art. 1 des Mandatvertrages, in dem Frankreich aufgegeben
wird, im Einvernehmen mit den eingeborenen Autoritäten ein Organisches
Statut zu schaffen, und bis dahin das Gebiet im Geiste des Mandates zu regieren.
Soweit es die Umstände gestatten, soll es die örtliche Autonomie
fördern. Grundsätzlich noch unbeschränkter sind die
Befugnisse Englands in Palästina. Ihm wird "die volle Gewalt der
Gesetzgebung und Verwaltung" zugestanden, die im wesentlichen nur
eingeschränkt wird durch die Verpflichtung, die örtliche Autonomie
zu fördern und dafür Sorge zu tragen, daß Palästina
gemäß der
Balfour-Erklärung vom 2. November 1917 zum nationalen Heim des
jüdischen Volkes werde. In allen drei Gebieten wird den
Staatsangehörigen der Mitglieder des Völkerbundes die
wirtschaftliche Gleichberechtigung gewährleistet.
Die im Palästina-Mandat angewandte Formel, durch die dem Mandatar die
volle Gewalt der Gesetzgebung und Verwaltung eingeräumt wird, bildet das
Charakteristikum der
B-Mandate, für die im übrigen die Verpflichtungen festgelegt werden,
die Art.
22 Abs. 5 nennt. Sklaven-, Waffen- und Alkoholhandel
sollen unterdrückt werden.
Religions- und Gewissensfreiheit sind zu gewährleisten. Die Errichtung von
Befestigungen oder von
Heeres- oder Flottenstützpunkten ist ebenso verboten, wie die
militärische Ausbildung der Eingeborenen, soweit diese nicht lediglich
Zwecken der Polizei oder der
Landes- [182] verteidigung dient. Endlich muß den
anderen Bundesmitgliedern die wirtschaftliche Gleichberechtigung gesichert
werden.
Diese Bestimmungen werden im einzelnen näher ausgeführt.
Insbesondere wird den Mandataren die Unterdrückung nicht nur des
Sklavenhandels, sondern auch der Sklaverei in jeder Form zur Pflicht gemacht.
Dazu gehört auch das Verbot der Zwangsarbeit, die nur für wichtige
öffentliche Bedürfnisse gegen Bezahlung zugelassen werden darf.
Desgleichen soll eine Aufsicht über den Abschluß von
Arbeitsverträgen ausgeübt werden. Ferner soll die Übertragung
von Grundbesitz außer zwischen Eingeborenen behördlicher
Genehmigung bedürfen und es sollen endlich Maßnahmen gegen den
Wucher ergriffen werden.
Dagegen ist von einem Recht der Mandatsgebiete auf Selbstverwaltung nicht die
Rede. Der Mandatsmacht wird vorgeschrieben, Friede, Ordnung und gutes
Regiment zu sichern und die materielle und moralische Wohlfahrt und den
sozialen Fortschritt der Einwohner zu fördern. Aber die sich aus Abs. 1 und 2
des Art.
22 ergebende Verpflichtung der Mandatsmächte, für die
Entwicklung der betreuten Volksstämme zur Selbständigkeit Sorge zu
tragen, ist in die Mandatsverträge nicht übernommen. Mehr als das,
die B-Mandate enthalten mit alleiniger Ausnahme des britischen Mandats für
Ostafrika sämtlich die Formel, daß diese Gebiete nach der
Gesetzgebung des Mandatars als integrierender Teil seines Gebiets verwaltet
werden sollen. Das gilt sowohl für das belgische
Ruanda-Urundi, wie auch für Togo und Kamerun, die zwischen England und
Frankreich geteilt sind. Daran schließt sich die weitere Bestimmung,
daß diese Gebiete zu
Zoll-, Fiskus- oder Verwaltungsunionen mit den dem Mandatar gehörigen
benachbarten Gebieten zusammengeschlossen werden dürfen und diese
Bestimmung ist auch im britischen Mandat für Ostafrika enthalten. Freilich
ist sie in allen Fällen mit dem Vorbehalt verknüpft, daß die zu
solchem Zweck ergriffenen Maßnahmen den Vorschriften des
Mandatsvertrages nicht zuwiderlaufen dürfen, wie denn ein gleicher
Vorbehalt auch der erstgenannten Bestimmung über die Verwaltung des
Mandatsgebiets als integrierender Teil hinzugefügt ist. Aber diese
Vorbehalte besagen im wesentlichen nicht mehr, als daß die sich aus Art. 22
Abs. 5 ergebenden Regeln eingehalten werden müssen. Im übrigen
bedeuten die in Rede stehenden zwei Bestimmungen, die bisher die notwendige
Beachtung nicht gefunden haben, unstreitig eine schwere Verletzung des Art.
22.
Art.
22 zieht einen scharfen Strich zwischen
B- und C-Mandaten und gestattet nur für diese letzteren eine Verwaltung
nach den Gesetzen des Mandatars als integrierender Bestandteil seines Gebiets.
Sicherlich entspricht nicht einmal das dem Sinn des Mandatssystems, ist vielmehr
nichts als ein Zugeständnis an die Annexionsabsichten [183] der beteiligten Mächte. Immerhin lassen
sich hier die Umstände geltend machen, die in Art.
22 Abs. 6
angeführt sind: schwache Bevölkerungsdichte und geringe
Ausdehnung, Entfernung von den Mittelpunkten der Zivilisation und
geographische Nachbarschaft zum Gebiet des Mandatars. Für die
B-Mandate hingegen kommen sie nicht in Frage und Art.
22 läßt
keinen Zweifel daran, daß diese als besondere Einheiten verwaltet werden
sollen. Die dem zuwiderlaufenden Bestimmungen der Mandatsverträge sind
deshalb rechtswidrig. Das gilt sowohl für die Zulassung der Verwaltung als
integrierender Bestandteil, wie auch für die Genehmigung von
Verwaltungs- und sonstigen Unionen.
Es geht dabei nicht nur um eine formelle Rechtsverletzung. Vielmehr liegt es auf
der Hand, daß diese Bestimmungen geeignet sind, den Mandatscharakter der
fraglichen Gebiete zu verwischen und damit die Rechte des Völkerbundes
zugunsten der Mandatsmächte zu schwächen. Welche Bedeutung das
gerade vom deutschen Standpunkt aus hat, bedarf keiner Darlegung. Ebensowenig
bedarf es einer Begründung, wenn aus diesem Anlaß dem Bedauern
darüber Ausdruck gegeben wird, daß Deutschland sich zur Mitarbeit
im Völkerbunde und im Mandatsausschuß bereit gefunden hat, ohne
eine Behebung dieser Rechtsverletzung zu verlangen.
Tatsächlich haben die Bestimmungen der
B-Mandate schon zu besorgniserregenden Folgen geführt.
Am 21. August 1925 erging ein belgisches Gesetz, das die Angliederung
Ruanda-Urundis an das Kongogebiet verfügte. Deutschland hatte schon bei
Einbringung der Vorlage unter dem 28. März 1925 Einspruch erhoben, doch
hatte Belgien es abgelehnt, von ihm Kenntnis zu nehmen. Darauf richtete
Deutschland unter dem 25. September 1925 eine Note an den
Generalsekretär des Völkerbundes, durch die es seinen Protest dem
Bunde unterbreitete. Der Generalsekretär übermittelte das deutsche
Schreiben der belgischen Regierung. Diese erklärte sich unter dem 16.
Oktober 1925 bereit, die Rechtslage durch den Mandatsausschuß
prüfen zu lassen, betonte aber zugleich, daß Deutschland kein
Einspruchsrecht besitze, da es seine Kolonien vorbehaltlos abgetreten habe und
nicht Mitglied des Völkerbundes sei. Vor dem Ausschuß gab dann der
belgische Vertreter eine Auslegung des Gesetzes, die dessen Vereinbarkeit mit dem
Mandat nachzuweisen bestimmt war und versicherte, daß eine Annexion
keineswegs beabsichtigt sei. Der Ausschuß berichtete darüber dem Rat
und dieser glaubte, am 9. Dezember 1925 feststellen zu können, daß
die abgegebenen Erklärungen geeignet seien, die Befürchtungen, als
liege eine versteckte Annexion vor, zu zerstreuen.
Die Reichsregierung hat ihrerseits die Angelegenheit nach dem Eintritt
Deutschlands in den Völkerbund nicht weiterverfolgt.
[184] Ebenso unheilvoll dürfte sich die
Bestimmung des Art. 10 des britischen Mandats für Ostafrika, heute
Tanganyika genannt, auswirken. Ist es doch bekannt genug, daß
Bestrebungen bestehen, dieses Gebiet mit anderen englischen Besitzungen in
Mittelafrika zusammenzuschließen und so ein neues Dominion zu bilden.
Der Bericht der bekannten
Hilton-Young-Kommission spricht in dieser Hinsicht eine bei aller vorsichtigen
Zurückhaltung nicht mißzuverstehende Sprache. Wenn er auch
zunächst nur die Ernennung eines für Tanganyika, Kenya und Uganda
gemeinsamen Hohen Kommissars empfiehlt und als zweiten Schritt die Einsetzung
eines Generalgouverneurs vorsieht, also nur die in Art. 10 gestattete
Verwaltungsunion schaffen will, spricht er doch beiläufig auch von einer
Vereinheitlichung des Verteidigungswesens der drei Gebiete, von der selbst Art. 10
nichts weiß. Darüber hinaus betont er den vorläufigen Charakter
der von ihm empfohlenen Maßnahmen. Über das Endziel der
einzuleitenden Entwicklung schweigt der Bericht. Aber es kann kein Zweifel daran
bestehen, daß sie im Ergebnis zu einer völligen Eingliederung des
Mandatsgebiets in das britische Ostafrika führen soll.
Neben den 3 A-Mandaten und den 6 B-Mandaten stehen 5
C-Mandate, nämlich
Deutsch-Südwest-Afrika für die Südafrikanische Union, Samoa
für Neuseeland, Nauru für England,
Neu-Guinea und die Südseeinseln südlich des Äquator
für Australien und die Südseeinseln nördlich des
Äquator für Japan. Die Mandatsverträge sind bereits am 17.
Dezember 1920 vom Rat genehmigt. Inhaltlich sind sie überaus
dürftig. Sie sprechen vor allem dem Mandatar die volle Gewalt der
Verwaltung und Gesetzgebung über die betreffenden Gebiete zu und
betonen hierbei, daß die Mandatsländer als integrierender Teil nach
den Gesetzen der Mandatsmacht verwaltet werden sollen. Die Mandatsmacht wird
ebenso wie bei den
B-Mandaten verpflichtet, für die materielle und moralische Wohlfahrt und
den sozialen Fortschritt der Einwohner Sorge zu tragen. Es folgen die in Art. 22
Abs. 5 festgesetzten Bestimmungen über
Sklaven-, Waffen- und Alkoholhandel, über Gewissensfreiheit und
militärische Fragen. Die wirtschaftliche Gleichberechtigung der anderen
Bundesmitglieder wird nicht ausbedungen. Dagegen sollen deren
Staatsangehörige als Missionare unbehindert zugelassen werden. Es folgt die
Verpflichtung alljährlicher Rechenschaftslegung über die Verwaltung
des Mandats. Den Abschluß bildet die Feststellung, daß eine
Abänderung der Bestimmungen des Mandats nur mit Zustimmung des
Völkerbundrates zulässig und daß Streitigkeiten über
Auslegung und Anwendung des Mandats vom Ständigen Internationalen
Gerichtshof entschieden werden sollen.
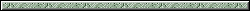
[185]
5. Die Rechtsstellung der
Bevölkerung
Die völkerrechtlich neue und daher ungeklärte Lage der
Mandatsgebiete führt unvermeidlich zur Aufwerfung einer Reihe von
Fragen, deren Lösung erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Das ist in um so
höherem Grade der Fall, als bei deren Erörterung politische
Erwägungen stets eine entscheidende Rolle spielen und die Instanz, bei der
die Entscheidung liegt, nämlich der Rat, von den Trägern bestimmter
politischer Bestrebungen beherrscht ist, während das Gegengewicht
derjenigen Macht, die der Vertreter des reinen Mandatsgedankens war, der
Vereinigten Staaten, fortgefallen ist und Deutschland, das deren Rolle hätte
übernehmen sollen, sich bisher zu aktivem Handeln nicht entschlossen hat.
Infolgedessen unterbleibt die logische und planmäßige Ausgestaltung
des Mandatssystems, die an sich selbst auf Grund des Art.
22 durchaus
möglich wäre, und an ihre Stelle tritt ein Gewirr von Kompromissen,
das zahlreiche innere Widersprüche enthält.
Das gilt auch für die Frage des Status der Bewohner der Mandatsgebiete. An
sich läge es auf der Hand, daß aus der diesen Gebieten
zuzugestehenden Stellung als besondere völkerrechtliche
Persönlichkeiten mit stufenweise geminderter Handlungsfähigkeit
sich eine besondere Landesangehörigkeit der Einwohner ergibt. Da aber die
mehr oder weniger versteckten Annexionsbestrebungen der Mandatare
naturgemäß einer Klärung der Rechtslage widerstreben,
erwachsen Schwierigkeiten auch in der Statusfrage.
Bei den A-Mandaten allerdings liegt die Statusfrage klar. Die Mandatsgebiete sind
Staaten und ihren Einwohnern kann, soweit sie nicht Ausländer sind, die
besondere Staatsangehörigkeit nicht bestritten werden. Es ist auch kein Fall
bekannt geworden, in dem der Versuch gemacht worden wäre, den
Bewohnern des Irak, Syriens oder Palästinas die englische oder
französische Staatsangehörigkeit aufzuzwingen oder sie zu
Schutzbefohlenen der Mandatsmächte zu stempeln. Und wenn im deutschen
Schrifttum der Versuch gemacht wird, den in Palästina angesiedelten Juden
eine besondere Heimstättenangehörigkeit zuzusprechen, die nicht
palästinensische Landesangehörigkeit, aber auch nicht englische
Staatsangehörigkeit ist, so beruht das nur auf konstruktiver
Überspitzung und ist praktisch bedeutungslos.
Ungeklärt ist dagegen die Lage der Einwohner der
B- und C-Mandate. Hier liegt zwar eine Entschließung des Rats vom 23.
April 1923 vor, die das Bestehen einer besonderen Landesangehörigkeit
anerkennt und fordert, daß für sie eine Bezeichnung gefunden werde,
die den Status der Einwohner unter der Mandatsherrschaft klarstelle. Es heißt
auch weiter, daß es unstatthaft wäre, die Staatsangehörigkeit der
Mandatsmacht durch einen Gesamtakt auf die Bevölkerung zu
über- [186] tragen. Diese Staatsangehörigkeit
dürfe nur aus freiem Willen von den einzelnen Einwohnern nach den
geltenden Vorschriften über Einbürgerung erworben werden. Aber
tatsächlich ist in dieser Richtung nichts Ernsthaftes geschehen. Noch unter
dem 24. Juli 1928, also 5 Jahre nach jener Entschließung, hat die britische
Regierung dem Generalsekretär des Völkerbundes mitgeteilt,
daß die Frage des Personalstatus der Mandatsbewohner sich noch in
Bearbeitung befinde. Sie habe im übrigen praktische Bedeutung nur
für die Ausstellung von Pässen. Da sei die Anwendung folgender
Formel üblich geworden: Britischer Schutzbefohlener, herstammend aus
dem Mandatsgebiete so und so.
Daß es sich in Wahrheit um sehr viel mehr handelt, als um eine in
Pässen zu verwendende Formel, dürfte der britischen Regierung
ebenso klar sein, wie dem Völkerbundsrate. Das darf man um so eher
annehmen, als der Rat bereits an demselben 23. April 1923, an dem er jene
Entschließung annahm, eine Erklärung des Vertreters der
Südafrikanischen Union, Sir Edgar Walton, anhörte und billigte, laut
welcher den deutschen Ansiedlern in Südwestafrika die britische
Staatsangehörigkeit durch einen Gesamtakt verliehen werden sollte. Diese
Maßnahme ist inzwischen im März 1925 verwirklicht worden, wobei
dem einzelnen Ansiedler ein Ablehnungsrecht zugestanden wurde. Es bedarf kaum
eines Hinweises darauf, daß das eine Verletzung des Mandatssystems und
einen weiteren Schritt in der Richtung auf die Annexion Südwestafrikas
bedeutet, weil es durchaus geeignet ist, die Sonderstellung des Mandatsgebiets zu
verwischen und es als bloßen Teil des Gebiets des Mandatars erscheinen zu
lassen.
Unter dem gleichen Gesichtspunkt muß es als bedenklich bezeichnet werden,
daß die Entschließung des Rats vom 23. April 1923 noch nicht
durchgeführt ist. Auch hier eröffnet sich der deutschen Vertretung
eine Aufgabe, deren Lösung der Aufrechterhaltung des Mandatssystems
dienen würde und damit zugleich im deutschen Interesse läge.
Im Zusammenhang hiermit steht auch die Frage, wieweit die Bevölkerung
der Mandatsgebiete zum Kriegsdienst herangezogen werden darf, obgleich sie
nicht bloß unter diesem Gesichtspunkt Bedeutung hat.
Art.
22 trifft entsprechende Bestimmungen nur im Hinblick auf die
B- und C-Mandate. Hier heißt es ausdrücklich, daß eine
militärische Ausbildung der Eingeborenen allein zu polizeilichen Zwecken
und zu Zwecken der Landesverteidigung stattfinden dürfe. Eine Ausnahme
ist, in Verletzung des Art. 22,
Frankreich für Togo und Kamerun zugebilligt
worden. Art. 3 Abs. 2 der beiden ihm für diese Gebiete erteilten Mandate
bestimmt gleichlautend, daß die für Zwecke der Polizei oder der
Landesverteidigung ausgehobenen Truppen im [187] Falle eines allgemeinen Krieges auch
außerhalb des Landes verwendet werden dürfen, um einen Angriff
zurückzuweisen oder das Gebiet zu verteidigen. Es liegt auf der Hand,
daß damit Frankreich vollkommen freie Hand in der Verwendung der
Mandatstruppen erhält. Im übrigen ist nirgends eine Festsetzung der
Zahl der Truppen getroffen, die zu den bezeichneten Zwecken ausgehoben werden
dürfen. Die Mandatsmächte haben also praktisch die volle
Möglichkeit, nach ihrem Ermessen eine bewaffnete Macht aufzustellen, die
über die Bedürfnisse der Landesverteidigung hinausgeht. Ob diese
Macht im Kriegsfalle tatsächlich nur nach Maßgabe des Art. 22
verwendet werden wird, muß heute dahingestellt bleiben. Jedenfalls
bedeutete es unter diesen Umständen sachlich kein Zugeständnis,
wenn die Frage, ob in den Mandatsgebieten eine Werbung für die Truppen
benachbarter Kolonien stattfinden dürfe, verneinend beantwortet wurde. Sie
wurde 1925 vom Mandatsausschuß aufgeworfen und nach Befragung der
beteiligten Regierungen prüfte der Rat sie in der
Juni-Tagung 1926. Hierbei waren sich alle Instanzen einig über die
Unzulässigkeit einer solchen Anwerbung. Nur Südafrika behielt sich
vor, in außergewöhnlichen Fällen Freiwillige einzustellen,
während Frankreich die sich aus den Mandatsverträgen ergebenden
Vorbehalte
machte.
Anders liegen die Verhältnisse in den A-Mandaten. Art.
22 enthält
darüber keine Bestimmungen. Man wird hier zwischen dem Irak einerseits,
Palästina und Syrien andererseits unterscheiden müssen. Jenes
befindet sich bereits auf der in Abs.
4 vorgesehenen Stufe der
Unabhängigkeit. Art. 7 des Bündnisvertrages zwischen England und
dem Irak rechnet daher mit dem Bestehen eines eigenen Heeres, über das die
Landesgewalt unter Berücksichtigung englischer Ratschläge
selbständig verfügt. Im übrigen ist noch ein besonderer Vertrag
vorgesehen, der diese Frage des näheren regeln soll. Er ist bisher nicht
abgeschlossen oder doch nicht bekanntgegeben. Über die Anwerbung von
Landesangehörigen für die englischen Kolonialtruppen fehlt es an
einer Bestimmung. Sie dürfte aber praktisch kaum in Frage kommen.
Zum Unterschiede hiervon ist in Art. 17 des palästinensischen und in Art. 2
des syrischen Mandatsvertrages zunächst vorgesehen, daß die
Mandatsmacht im Lande eigene Truppen unterhält. Daneben soll zur
Aufrechterhaltung der Ordnung und zur Verteidigung des Gebiets eine
Freiwilligentruppe organisiert werden, die unter der Oberaufsicht der
Mandatsmacht verbleibt und für andere Zwecke nur mit ihrer Zustimmung
verwendet werden darf. Darin liegt, praktisch betrachtet, das Zugeständnis
an die Mandatsmacht, die Landestruppen außerhalb des Gebiets zu
kriegerischen Zwecken verwenden zu dürfen. An einem Verbot der
Anwerbung von Mandatsangehörigen [188] für die eigenen Truppen der
Mandatsmächte fehlt es. Es wird von der tatsächlichen Lage und der
Stimmung im Lande abhängen, ob die Mächte sich diese Lücke
werden zunutze machen können, ebenso wie es von diesen Momenten
abhängen wird, ob sie in der Lage sein werden, die Truppen der
A-Mandate in ihren Kriegen zu verwenden.
Im Ergebnis muß jedenfalls festgestellt werden, daß die Bestimmungen
der Mandatsverträge den Absichten des Art
22 nicht gerecht werden. Diese
laufen zweifelsohne darauf hinaus, die Mandatsgebiete zu neutralisieren. Durch die
Mandatsverträge wird die Erreichung dieses Zieles keineswegs
gewährleistet. Selbst wenn man von den Bestimmungen für
Palästina, Syrien und
Französisch-Afrika absieht, sind auch die übrigen Gebiete nicht
dagegen geschützt, in einen von der Mandatsmacht geführten Krieg
hineingezogen zu werden. Man wird vielmehr damit rechnen müssen,
daß es regelmäßig zu einer Beteiligung kommen wird. Als
rechtlich zulässig ließe sich allenfalls eine Teilnahme an
Exekutionskriegen des Völkerbundes konstruieren, obgleich auch hiergegen
begründete Bedenken erhoben werden können.
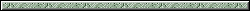
6. Die Aufsicht
Der abhängige Charakter der Mandatsverwaltung kommt in der durch den
Völkerbund geübten Aufsicht zum Ausdruck. Träger der
Aufsichtsbefugnisse ist der Rat, während der Versammlung Rechte auf
diesem Gebiet nicht zustehen. Sie kann sich hier auch nicht auf Art.
3 Abs. 3 der
Satzung stützen, laut welchem sie über jede Frage zu befinden hat, die
in den Tätigkeitsbereich des Bundes fällt. Denn durch Art.
22 ist dem
Rat eine Sonderkompetenz zuerkannt. Immerhin ist eine von der I.
Völkerbundversammlung am 7. Dezember 1920 gefaßte
Entschließung zu berücksichtigen, die im Falle der alleinigen
Zuständigkeit der Versammlung oder des Rats das andere Organ
verpflichtet, diese Ausschließlichkeit zu respektieren, es jedoch zugleich
für befugt erklärt, eine getroffene Entscheidung zu erörtern und
zu prüfen. Das Mittel hierzu bietet der vom Rat alljährlich über
seine Tätigkeit erstattete Generalbericht, dessen Besprechung praktisch im
Mittelpunkt der Verhandlungen der Versammlung steht und der stets auch die
Mandatsverwaltung behandelt. Jedoch ergibt sich aus der Natur der Sache,
daß Kritik, Ratschläge und Wünsche sich an den Rat als den
Urheber des Berichtes wenden und die Mandatsmächte nur mittelbar zu
treffen vermögen. In diesem Rahmen hat die Versammlung gelegentlich in
allgemeinen Wendungen die Mandatspolitik gebilligt. In anderen Fällen hat
sie grundsätzliche Wünsche zum Ausdruck gebracht, einmal auch, als
es sich um den Aufstand der Bondelzwarts handelte, ihrem Mißfallen
Ausdruck gegeben und endlich in einem weiteren Falle, als ein Konflikt zwischen
[189] Rat und Mandatsausschuß bestand, beide
zu einmütiger Zusammenarbeit gemahnt. Es mag dadurch unter
Umständen ein gewisser moralischer Druck ausgeübt werden. Aber
im allgemeinen wird man der Stellungnahme der Versammlung praktische
Bedeutung nicht beizumessen haben.
Der Rat ist Träger der Aufsichtsbefugnisse des Bundes und ihm haben die
Mandatsmächte alljährlich einen Bericht zu erstatten. Als Hilfsorgan
ist ihm ein Ständiger Ausschuß zur Seite gestellt, der die Berichte
entgegen zu nehmen und über sie dem Rat ein Gutachten zu geben hat.
Weiter geht die Zuständigkeit des Ausschusses nicht. Insbesondere ist
er nicht berechtigt, den Mandatsmächten irgendwelche Vorschriften zu
machen oder im Falle einer Pflichtverletzung irgendwelche Maßnahmen
gegen sie zu ergreifen. Das ergibt sich unzweideutig aus Art.
22 Abs. 9 und ist in
der bisherigen Praxis streng befolgt worden. Daran vermag auch die Tatsache
nichts zu ändern, daß seinen Sitzungen Vertreter der
Mandatsmächte beizuwohnen pflegen und daß er sie um
Auskünfte und Ergänzungen zu den Berichten ersuchen darf. Er bleibt
Organ des Rats und seine Stellungnahme kann stets nur in Berichten an ihn
Ausdruck finden.
Andererseits ist ihm freilich die Möglichkeit gegeben, in diesen seinen
Berichten Anerkennung und Tadel, Ratschläge und Wünsche zu
äußern und, da diese Berichte zur Kenntnis sowohl des Bundes, als
auch der Öffentlichkeit gelangen, dadurch eine Einwirkung
auszuüben. Aber in Wirklichkeit sind ihm, rechtlich wie tatsächlich,
enge Schranken gewiesen. Einerseits ist er im wesentlichen auf das Material
beschränkt, das ihm die Mandatsmächte vorlegen und ist nicht befugt,
an Ort und Stelle eine Nachprüfung vorzunehmen. Er darf nicht einmal die
Urheber der ihm zugegangenen Petitionen persönlich vernehmen.
Andererseits tragen die Mandatsmächte eine weitgehende Empfindlichkeit
gegen Kritik zur Schau und haben mehr als einmal tadelnde Bemerkungen nicht
ohne Schroffheit zurückgewiesen, obgleich sich der Ausschuß stets an
die sehr gepflegten Ausdrucksformen hält, die im Völkerbunde
üblich sind. Ein 1926 unternommener Versuch, durch eine Ausgestaltung
des Verfahrens seine Zuständigkeit zu erweitern, wurde vom Rat sofort
unterdrückt und man kann sich dem Eindruck nicht entziehen, daß
wenigstens in einem aufsehenerregenden Falle, nämlich im syrischen, auch
ein diplomatischer Druck mit Erfolg angewandt worden ist, um den
Ausschuß zu größerer Zurückhaltung in der Beurteilung
von Mißgriffen einer Mandatsmacht zu bewegen.
Im übrigen ist auch durch die Zusammensetzung des Ausschusses
dafür gesorgt, daß er die ihm gewiesenen Grenzen einhält und
den Mandatsmächten nicht zu nahe tritt. Sind doch nicht weniger als vier
seiner Mitglieder Angehörige von Mandatarstaaten. Dadurch [190] sind diese sämtlich vertreten, Belgien,
England, Frankreich und Japan direkt, die Dominions durch England. Und
obgleich sie formell als Personen und nicht als Vertreter ihrer Staaten im
Ausschuß sitzen, dürfte es auf der Hand liegen, daß sie die
Interessen ihres Landes wahrnehmen.
Wenn so der Ausschuß auf eine moralische Einwirkung beschränkt ist,
darf nicht übersehen werden, daß im Grunde die Stellung des Rates
sich von der seinen nur formell unterscheidet. Art.
22 enthält kein Wort
darüber, ob und mit welchen Mitteln er im Falle einer Verletzung der
Mandatspflichten einzuschreiten hat. Das ist selbstverständlich Absicht und
entspricht dem allgemeinen Charakter der Satzung, erscheint auch als kaum
vermeidliche Folge der Tatsache, daß Art.
22 die Frucht eines Kompromisses
ist. Immerhin ergibt sich daraus eine rechtlich wie tatsächlich gleich
unbefriedigende Lage. Denn was bedeutet ein Aufsichtsrecht, das zugleich
Aufsichtspflicht ist, wenn dessen Träger nicht die Möglichkeit hat, die
Abstellung zutage tretender Mängel zu veranlassen?
Praktisch hat sich der Brauch herausgebildet, daß der Rat die Bemerkungen
und Beanstandungen des Ausschusses, soweit er ihnen beitritt, zur Kenntnis
der betroffenen Macht bringt. Doch hat der Rat noch nie den Versuch
unternommen, auf der Abstellung von Mißständen oder der
Durchführung von Verbesserungen zu bestehen. Vielmehr hat er einen
Widerspruch der Mandatsmächte gegen Beanstandungen des Ausschusses
immer auf sich beruhen lassen und sich mit einer formellen
Überbrückung von Gegensätzen begnügt. Er hat auch nie
einen Schritt getan, um eine Mandatsmacht zur Erfüllung von
Verpflichtungen zu bewegen, die unzweideutig übernommen sind und
über deren Vernachlässigung kein Streit bestehen kann.
Beispielsweise duldet er es stillschweigend, daß Frankreich der in Art. 1 des
Mandatsvertrages für Syrien übernommenen Pflicht, binnen drei
Jahren, d. h. bis 1925, ein Organisches Statut zu schaffen, nicht
nachgekommen ist und voraussichtlich in absehbarer Zeit nicht nachkommen
wird.
Der Rat ist zu wirksamem Einschreiten - und darin liegt die wesentlichste
Schwäche des
Mandatssystems - auch weder tatsächlich noch rechtlich in der Lage.
Nach Art. 5 der
Satzung bedarf es der Einstimmigkeit für jeden
Beschluß, der nicht bloß das Verfahren betrifft. Eine solche
Einstimmigkeit wäre zu einem Vorgehen gegen eine Mandatsmacht nicht zu
erzielen, da England, Frankreich und Japan dem Rat als ständige Mitglieder
angehören und die Dominions stets auf Englands, Belgien auf Frankreichs
Schutz rechnen können. Sollte aber etwa in Anlehnung an die
Bestimmungen über die Behandlung von internationalen Streitigkeiten der
Versuch gemacht werden, die Stimme der beteiligten Mandatsmacht nicht zu
zählen, so [191] wäre das gleichbedeutend mit dem Zerfall
des Völkerbundes, der wiederum das Ende des Mandatssystems bedeuten
würde. Darüber hinaus jedoch sieht die Satzung auch keinerlei
Maßnahmen vor, die gegen eine widerspenstige Mandatsmacht angewendet
werden könnten. Die Anwendung unmittelbaren Zwanges kommt nur unter
den Voraussetzungen des Art.
16 in Frage, d. h. dann, wenn ein
Bundesmitglied unter Verletzung der Vorschriften über Streitschlichtung
zum Kriege schreitet. Im übrigen steht dem Bunde nur der Ausschluß
eines Mitgliedes, das sich gegen die Satzung vergeht, offen. Diese
Maßnahme aber ist gegen die in Frage kommenden Mächte
tatsächlich nicht anwendbar. Sie hätte einen Sinn auch nur dann,
wenn gleichzeitig eine Entziehung des Mandats erfolgen würde. Sie
wiederum ist unter den gegebenen Verhältnissen praktisch nicht
durchführbar und selbst unter rechtlichen Gesichtspunkten könnte es
streitig scheinen, ob der Bund, der die Mandate nicht verliehen hat, sie
zurückziehen darf, ob die Befugnis hierzu nicht vielmehr bei den
Hauptmächten ruht.
Das Ergebnis ist jedenfalls, daß dem Rat Machtmittel nicht zur
Verfügung stehen und daß er nicht in der Lage ist, einen der
Mandatarstaaten zur Erfüllung seiner Pflichten zu zwingen. Er vermag
einzig und allein einen moralischen Druck auszuüben und kann sich dabei
nur auf die öffentliche Meinung stützen. Das ist gewiß,
geschickt und zielbewußt gehandhabt, eine gewaltige Waffe. Aber wenn man
ihre Bedeutung in dieser Frage richtig einschätzen will, wird man nicht
vergessen dürfen, wie entscheidend im Rate der Einfluß gerade der
Mächte ist, die an der Mandatsfrage interessiert sind und wie groß das
Gewicht gerade ihrer Presse in der Welt ist. Noch dazu sind alle
Mandatsmächte bis zu gewissem Grade in ihren Belangen solidarisch, von
den besonderen Bindungen innerhalb des britischen Imperiums und zwischen
Frankreich und Belgien ganz zu schweigen.
Unter diesen Umständen wird man nicht verkennen dürfen, daß
der vom Rat ausgehende moralische Druck nicht sehr stark sein kann und
daß letzten Endes die Erfüllung der übernommenen Pflichten
vom guten Willen der Mandatsmächte abhängt. Dieser gute Wille aber
wird durch die mangelhafte Fassung und den unbestimmten Inhalt des Art.
22 sicherlich nicht gestützt.
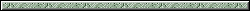
7. Die Praxis des
Mandatsausschusses
Am 29. November 1920 beschloß der Rat eine "Konstitution des
Ständigen Mandatsausschusses", am 10. Januar 1922 bestätigte er die
von dem Ausschuß selbst ausgearbeitete Geschäftsordnung.
Der Ständige Mandatsausschuß bestand ursprünglich aus neun
vom Rate auf Grund ihrer besonderen Eignung ernannten Mitgliedern, [192] von denen mindestens fünf nicht
Angehörige von Mandatsmächten sein dürfen. Ein Platz im
Ausschuß soll einer Frau übertragen
werden - ihn nimmt von Beginn an die Schwedin Frau
Bugge-Wicksell ein. Den Vorsitz hatte zuerst der Italiener Marquis Theodoli inne.
Nach seinem Tode ist ihm der Holländer van Rees gefolgt. Seit dem
September 1927 gehört dem Ausschusse ein Deutscher, Geheimrat Kastl, als
zehntes Mitglied an. Zum außerordentlichen Mitgliede wurde im Dezember
1924 Prof. Rappard ernannt, nachdem er von der Leitung der Mandatsabteilung des
Sekretariats zurückgetreten
war.- Der Rat betonte hierbei ausdrücklich, daß damit ein
Präzedenzfall nicht geschaffen werden solle. Mit beratender Stimme darf ein
Vertreter des Internationalen Arbeitsamts an den Sitzungen teilnehmen, in denen
Fragen des Arbeitsrechts behandelt werden.
Der Ausschuß hat seinen Sitz in Genf. Dort versammelte er sich
anfänglich einmal im Jahr, seit 1924 zweimal jährlich. Zur
Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit von fünf Mitgliedern
erforderlich. Die Mehrheit entscheidet, bei Stimmengleichheit findet
Stichentscheid des Präsidenten statt. Die Minderheit kann verlangen,
daß ihre mit Gründen versehene Meinung dem Rat vorgelegt werde.
Als Büro dient dem Ausschuß die Mandatsabteilung des Sekretariats
des Völkerbundes, die anfänglich unter der Leitung des Schweizers
Prof. Rappard stand, an dessen Stelle jetzt der Italiener Catastini getreten ist.
Die von den Mandatsmächten zu erstattenden Berichte sind alljährlich
bis zum 1. September einzureichen. Um einen Rahmen für sie zu schaffen
und ihre Abfassung zu erleichtern, arbeitete der Ausschuß bereits auf seiner
ersten Tagung im Oktober 1920 je einen Fragebogen für die
B- und C-Mandate aus. Nachdem sie vom Rate gebilligt waren, entstand im
folgenden Jahre je ein Fragebogen für Syrien und für Palästina.
Hierbei wurde nachdrücklich betont, daß die Mächte an das
aufgestellte Schema nicht gebunden wären. Mit der Zeit erwiesen sich
jedoch die Fragebogen als nicht genügend. Der Ausschuß
überprüfte sie und legte dem Rat im September 1926 erweiterte
Bogen für die
B- und C-Mandate vor, die bis zu 118 Fragen enthielten. Sie fanden im Rat eine
überaus unfreundliche Aufnahme. Es trat die Meinung zutage, daß der
Ausschuß seine Zuständigkeit auszudehnen und sich in die
Einzelheiten der Mandatsverwaltung einzumengen, ja, an die Stelle derselben zu
treten geneigt sei. Man beschloß, die Mandatsmächte um eine
Stellungnahme zu ersuchen. Diese fiel durchweg ablehnend aus und der Rat
verwies in seiner Tagung vom Dezember 1926 die Frage an den Ausschuß
zurück, der sich in einer ausführlichen Entschließung gegen die
erhobenen Vorwürfe verwahrte und betonte, daß die Benutzung der
Fragebogen vollkommen im Belieben der Mächte stehe. Übrigens
hatte auch die [193] Bundesversammlung von 1926 sich mit dieser
Frage zu befassen. In ihrem VI. Ausschuß kam es zu sehr scharfen
Auseinandersetzungen, in deren Verlauf namentlich Fridtjof Nansen für den
Mandatsausschuß eintrat. In der Vollversammlung wurde der entstandene
Konflikt zwar berührt, aber sehr diplomatisch behandelt und durch eine
Entschließung ausgeglichen, die dem Mandatsausschuß für
seine hingebende und eifrige Arbeit dankte, zugleich jedoch dem Vertrauen
Ausdruck gab, daß Rat und Ausschuß in herzlicher Zusammenarbeit
die Anwendung der Grundsätze des Art.
22 zu sichern wissen würden.
Es bleibt somit bei der Anwendung der ursprünglichen Fragebogen, eine
Tatsache, die vielleicht nicht an sich, jedenfalls aber als Symptom Beachtung
verdient: Mandatsmächte und Rat wollen selbst den Anschein vermieden
wissen, als sei eine Verstärkung der Kontrolle des Ausschusses
zulässig. Und unter demselben Gesichtspunkt verdient ein zweiter,
gleichzeitig verhandelter Konflikt zwischen Rat und Ausschuß
Aufmerksamkeit.
Es ging dabei um das Petitionsrecht der Eingeborenen. Ein solches wurde durch
Beschluß des Rates vom 1. Februar 1923 anerkannt und geregelt. Danach
müssen Petitionen von Gemeinwesen oder Einwohnern der
Mandatsländer durch Vermittlung der Mandatsmacht an den
Generalsekretär gehen. Die Mandatsmacht kann ihre Bemerkungen
hinzufügen. Petitionen, die auf anderem Wege an den Generalsekretär
gelangen, werden zurückgesandt. Petitionen aus sonstiger Quelle, etwa von
humanitären Vereinigungen, werden dem Präsidenten des
Ausschusses überwiesen. Zu denjenigen, die beachtlich scheinen, wird eine
Äußerung der Mandatsmacht eingeholt. Über die übrigen
berichtet der Präsident dem Ausschuß. Die Petitionen werden vom
Ausschuß zusammen mit den Bemerkungen der Mandatsmacht
geprüft. Soweit es angebracht scheint, werden sie dem Rat und den
Bundesmitgliedern zur Kenntnis gebracht. Unabhängig davon wird in dem
Bericht an den Rat eine Übersicht über die in der jeweiligen Tagung
des Ausschusses verhandelten Petitionen gegeben.
Schon im Juli 1923 tauchte auf Anregung der englischen
Antisklaverei-Gesellschaft im Ausschuß die Frage auf, ob nicht unter
Umständen eine Anhörung der Urheber von Petitionen angebracht sei.
In der Folge wurde diese Frage gleichzeitig mit der der neuen Fragebogen
verhandelt. Der Ausschuß stellte sich hierbei grundsätzlich auf den
Standpunkt, daß er nur ein Hilfsorgan des Rates sei und diesem Gutachten
zu erstatten habe, daß er aber keineswegs befugt sei, als Tribunal in
Tätigkeit zu treten. Nichtsdestoweniger sei anzuerkennen, daß sein
Verfahren ein wenig einseitig sei. Die Erfahrung habe gezeigt, daß es in
Einzelfällen unmöglich sei, sich ein endgültiges Urteil
über die Berechtigung von Petitionen zu bilden. In [194] solchen Fällen könnte es
unumgänglich scheinen, die Petitionäre anzuhören. Der
Ausschuß wolle jedoch dem Rat keine Empfehlung in dieser Frage vorlegen,
sondern nur die Auffassung des Rats kennen lernen.
Diese Anregung löste beim Rat noch schärferen Widerspruch aus, als
der Vorschlag der neuen Fragebogen. Im Ergebnis faßte der Rat unter dem 7.
März 1927 eine Entschließung, laut welcher von einer
Änderung des bisher vom Ausschuß befolgten Verfahrens ein Vorteil
nicht zu erwarten wäre.
Damit war der Versuch, den Urhebern von Petitionen eine günstigere
Stellung zu schaffen, erledigt und es blieb beim Verfahren, das der Ausschuß
selbst als "ein wenig einseitig" bezeichnet hatte. Danach wird zunächst der
Bericht der Mandatsmacht geprüft, und zwar unter Teilnahme eines von ihr
entsandten Vertreters. Dazu wird vom Ausschuß verschiedentlich dankbar
erwähnt, daß in steigendem Maße nicht mehr Beamte der
Kolonialministerien erscheinen, sondern hochgestellte Vertreter der
örtlichen Mandatsverwaltung, vielfach die Gouverneure der Mandatsgebiete.
Sie geben ergänzende Erläuterungen zu den Berichten und zu den
Bemerkungen, die den Petitionen beigefügt sind. Überraschend wirkt
in diesem Zusammenhange eine Mitteilung, die das portugiesische Mitglied des
Mandatsausschusses 1926 in der schon erwähnten Sitzung des
VI. Ausschusses der VII. Bundesversammlung machte. Der Vertreter einer
Mandatsmacht habe geäußert, daß sein Land angesichts der
minutiösen Untersuchungen des Mandatsausschusses beginne, eine gewisse
Ungeduld zu spüren. Dabei seien die sich auf mehrere Mandatsgebiete
erstreckenden Berichte dieser Macht geprüft worden 1921 in drei Stunden,
1922 in zweieinhalb, 1923 in zwei, 1924/25 in viereinhalb.
Auf Grund dieser Prüfung und Verhandlung wird ein Bericht an den Rat
verfaßt, der zunächst einen allgemeinen Überblick gibt und
dann auf einzelne Fragen eingeht. Hierbei wird öfter der Wunsch
ausgesprochen, nähere Informationen über bestimmte Punkte zu
erhalten. Auch der Hinweis auf die Notwendigkeit einer stärkeren
Berücksichtigung bestimmter Verwaltungszweige, so des Medizinalwesens,
ist wiederholt anzutreffen. Besondere Sorge bereitet dem Ausschuß die
ständig wachsende Einfuhr alkoholischer Getränke in die
B-Mandate. Daneben stand, namentlich in den ersten Jahren, die Erörterung
von Rechtsfragen. Das Problem der Souveränität wurde, wie schon
erwähnt, mehrfach angeschnitten, allerdings ohne daß eine
Lösung erfolgt wäre. Der Anregung des Mandatsausschusses ist es zu
danken, daß die Frage des Domanialbesitzes in dem Sinne geklärt
wurde, daß die Mandatsmächte auf ihn keinen Anspruch haben. Im
Interesse der Kreditbeschaffung allerdings wurde zugestanden, daß [195] eine Verpfändung dieses Besitzes
zulässig ist und den etwaigen Nachfolger in Mandat bindet. Im
übrigen aber wird auch jener Grundsatz praktisch unter Umständen
nicht eingehalten. So erwies es sich nach den Erklärungen des Vertreters der
Südafrikanischen Union im VI. Ausschuß der VII.
Bundesversammlung, daß die Union sich das Eigentum an den Bahnen in
Südwestafrika zuschreibt, da es nicht angängig gewesen sei, es dem
Administrator als einem Beamten der Union zuzugestehen. Sehr häufig und
eingehend werden auch Fragen des Eingeborenenrechts behandelt, so die der
Zwangsarbeit.
Der Ausschuß bedient sich in seinen Berichten der im Völkerbunde
üblichen diplomatischen Ausdrucksweise. Lob und Anerkennung werden bei
jeder sich bietenden Gelegenheit in oft überschwenglichen Wendungen
gespendet. Zuweilen allerdings kann man sich des Eindrucks nicht erwehren,
daß eine gewisse leise Ironie mitunterläuft, so wenn der
Ausschuß Japan dafür dankt, daß es ihm die im Mandatsgebiet
geltenden Gesetze in japanischer Sprache und ein Album mit Ansichten aus dem
Gebiet überreicht habe. Dagegen ist der Ausschuß sehr
zurückhaltend und vorsichtig mit tadelnden Äußerungen. Wenn
das notwendig erscheint, läßt er die Tatsachen selbst sprechen, ohne
ein ausdrückliches Urteil abzugeben und verbindet derartige Feststellungen
gern mit anerkennenden Auslassungen über andere Maßnahmen der
Mandatsmacht. Immerhin hat sich in einem Falle trotz Anwendung dieser
Methoden ein vernichtendes Urteil über die Mandatsverwaltung ergeben.
Das geschah im Februar 1926 aus Anlaß des Drusenaufstandes in Syrien.
Der Bericht war so eindrucksvoll, daß der Rat in seiner Märztagung
dem Ausschuß für seine unparteiische und sorgfältige Arbeit
dankte, und zwar kein eigenes Urteil fällte, aber immerhin erklärte, er
betrachte die Lage mit lebhafter Besorgnis und hoffe, daß die
Bemühungen aller Beteiligten diesem Zustande der Dinge bald ein Ende zu
machen erlauben würde. Er beschloß, den Bericht der
französischen Regierung mit der Bitte zu übermitteln, sie wolle ihm
die gebührende Folge geben.
Es ist jedoch bezeichnend, daß bald darauf ein Umschwung in der
Beurteilung der syrischen Vorgänge eintrat. Es mag sein, daß sich das
zum Teil aus der Beruhigung der öffentlichen Meinung erklärt, die
sich anfänglich sehr lebhaft mit jenen Dingen beschäftigt hatte. Man
kann sich aber nur schwer dem Eindruck entziehen, daß auch ein
diplomatischer Druck auf den Ausschuß ausgeübt worden ist und
daß die Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und dem Rat über
die Angelegenheit der Fragebogen und der Anhörung von Petitionären
den Ausschuß gleichfalls zur Zurückhaltung veranlaßt haben.
Jedenfalls nimmt er schon im November 1926 einen veränderten Standpunkt
zu den neu überreichten französischen Berichten ein, will auf die
schmerzlichen Ereignisse nicht zurückkommen und hofft auf [196] eine Beruhigung durch die Politik der
Mandatsmacht, die durch einen neuen Kommissar vertreten sei. Im folgenden Jahre
stellt er erfreut fest, daß der Aufstand beendet sei und daß die
Mandatsmacht Vorbereitungen für den Erlaß eines Organischen
Statuts treffe. Und auf seiner Septembertagung 1928 kann der Rat auf Grund des
Ausschußberichts mit Befriedigung zur Kenntnis nehmen, daß Ruhe
im Lande herrsche.
In gleicher Richtung bewegt sich die Behandlung der zahlreichen syrischen
Petitionen, die anfänglich sehr sorgfältig berücksichtigt, dann
aber fortschreitend beiseite geschoben wurden.
Die Behandlung, die die Petitionen im Ausschuß erfahren, vermag auch
sonst einen befriedigenden Eindruck nicht hervorzurufen. Freilich befindet sich
hier der Ausschuß in einer überaus schwierigen Lage. Da er weder
Untersuchungen an Ort und Stelle vorzunehmen, noch die Petitionäre zu
hören berechtigt ist, hat er es einfach mit den einander widersprechenden
Angaben der Beschwerdeführer und der Mandatsmacht zu tun. Und da diese
mit amtlichen Materialien belegt werden können, kann ihm nicht einmal ein
Vorwurf daraus gemacht werden, wenn er zugunsten der Mandatsmacht
entscheidet. Die Schuld liegt nicht am Ausschuß, sondern am System, das zu
ändern er vergeblich versucht hat.
Besonders bezeichnend für diese Lage ist die Behandlung von Petitionen des
Bundes der Deutsch-Togoländer. Sie wurden zuerst unter dem 27. Juni und 26.
September 1925 eingereicht und enthielten an erster Stelle die Bitte um
Rückgabe Togos an Deutschland. Am 30. Oktober 1925 machte der
Präsident dem Ausschuß von ihnen Mitteilung mit dem Bemerken,
daß diese Bitte unvereinbar mit den Bestimmungen des Mandats sei und
daß die vorgebrachten Klagen so allgemein gehalten seien, daß sie
weder die Aufmerksamkeit des Ausschusses, noch eine Weiterleitung an die
Mandatsmacht verdienen. Im folgenden Jahre liefen abermals zwei Petitionen ein,
in denen die Beschwerden nunmehr substanziiert waren. Sie betrafen
übermäßige Erhöhung der Kopfsteuer, wirtschaftliche
Schädigung durch die mangelnde Stabilität des Franken, Greueltaten
französischer Beamten, Rekrutierung von Eingeborenen für die
französischen
Sudan- und Senegaltruppen u. a. In den beigefügten Bemerkungen der
Mandatsmacht war allen diesen Beschwerden widersprochen. Der Ausschuß
fand die Auskünfte der französischen Regierung befriedigend,
erklärte die Beschwerden in allen wesentlichen Punkten für
unbegründet und erbat nur in einem Falle, in dem es sich um die
Tötung eines Eingeborenen durch französische Beamte handelte,
ergänzende Mitteilungen.
Eine sehr scharfe Zurückweisung und Verurteilung fanden 1928 mehrere
Petitionen aus Samoa, die auf die bekannten
Eingeborenen- [197] unruhen zurückgingen. Diese seien nur
eine Frucht der Treibereien namentlich genannter Personen. Die Mandatsmacht
habe gegen die Grundsätze des Mandatssystems keineswegs
verstoßen. Allenfalls sei dem Administrator der Vorwurf zu machen,
daß er zuviel Geduld bewiesen und dadurch seine Autorität
geschwächt habe. Ein neuer Administrator besitze nunmehr
genügende Machtmittel. Der Ausschuß hoffe auf eine
Wiederherstellung des Friedens und der Wohlfahrt und auf die Rückkehr der
Bevölkerung zum früheren Vertrauen der Mandatsmacht
gegenüber. Diese Entscheidung soll der Bevölkerung bekannt gegeben
werden.
Ernste Beschwerden brachte eine Petition der Rehoboths in Südwestafrika
vom 26. November und 21. Dezember 1926 vor. Europäern werde erlaubt,
ihre Ländereien zu erwerben und ihre Jagdgründe würden
verwüstet, da jeder Europäer mit Jagdschein als jagdberechtigt
anerkannt werde. Ihnen selbst aber seien, soweit sie sich an den Unruhen von 1925
beteiligt hätten, die Waffen fortgenommen. Auch sei das in deutscher Zeit
erlassene Verbot, Forderungen von Europäern an Eingeborene einzuklagen,
aufgehoben. Die Rehoboths bäten dringend, persönlich vernommen
zu werden. Trotz wiederholten Drängens des Ausschusses blieben
eingehende Äußerungen der Mandatsmacht aus. Im Juni 1928
erklärte sich der Kommissar der Unionsregierung zu mündlichen
Erläuterungen vor der Herbstsession des Ausschusses bereit. Ob und in
welchem Sinne eine Entscheidung gefallen ist, steht dahin, da die
einschlägigen Drucksachen des Völkerbundes noch nicht
vorliegen.
Im übrigen sei bemerkt, daß der Ausschuß sich Ausfälle
gegen die deutsche Verwaltung der derzeitigen Mandatsgebiete nicht zuschulden
kommen läßt. Die wiederholten Feststellungen, daß auf diesem
oder jenem Gebiet der Mandatsverwaltung Fortschritte zu begrüßen
seien, rufen nicht den Eindruck hervor, als sei eine Herabsetzung der deutschen
Kolonialverwaltung beabsichtigt. Das dürfte nicht einmal dann der Fall sein,
wenn der Ausschuß 1927 seiner Beunruhigung darüber Ausdruck gibt,
daß "unter der früheren Herrschaft" in
Neu-Guinea fast alles fruchtbare Land ausländischen Pflanzern
überlassen sei und daß das Not und Niedergeschlagenheit unter den
Bewohnern gewisser Inseln hervorrufe. Es wird keinerlei Werturteil daran
geknüpft, sondern nur die Frage gestellt, welche Maßnahmen die
Mandatsverwaltung zu ergreifen gedenke.
So ergibt sich denn im allgemeinen der Eindruck, daß der
Mandatsausschuß zwar von gutem Willen beseelt ist, daß er aber
gezwungen ist, Rücksichten zu nehmen und daß das ihm
vorgeschriebene Verfahren ebenso wie das Fehlen jeglicher Machtmittel seiner
Tätigkeit einen überwiegend formalen Charakter aufprägt.
[198]
8. Ausblick
Immer noch besteht in weiten Kreisen die Hoffnung, daß es Deutschland in
absehbarer Zeit gelingen werde, wenigstens einen Teil seiner Kolonien zu
Mandatsrecht zurück zu erhalten. Es kann dahingestellt bleiben, ob eine
solche Lösung der Würde und den Interessen Deutschlands
entspräche. Wohl aber muß die Frage aufgeworfen werden, ob sie bei
Fortbestehen des Mandatssystems im Bereich der Möglichkeit und
Wahrscheinlichkeit liegt.
Rein theoretisch betrachtet, wird sie zu bejahen sein. Theoretisch ist es denkbar,
daß eine der gegenwärtigen Mandatsmächte auf ihr Mandat
verzichtet und daß dieses dann Deutschland zugeteilt würde. Die
weitere Frage, in welchen Formen sich eine solche Zuteilung abspielen
würde und ob hierbei wieder, wie bei der ersten Vergebung, die
Hauptmächte die materielle Entscheidung treffen würden und der Rat
sich mit einer formellen Rolle begnügen müßte, oder ob nun der
Rat in den Vordergrund treten würde, muß freilich ungelöst
bleiben. Die Mängel, an denen Art.
22 krankt, machen ihre wissenschaftliche
Beantwortung unmöglich. Die Entscheidung würde unter rein
politischen Gesichtspunkten fallen, und es hat keinen Zweck, jetzt Hypothesen
darüber aufzustellen, mit welchen Machtverhältnissen zu einem
unbekannten Zeitpunkt zu rechnen sein dürfte. Es hat um so weniger Zweck,
als der freiwillige Verzicht einer Mandatsmacht eben nur theoretisch
möglich, praktisch jedoch sehr unwahrscheinlich ist. Allerdings liegen
Erklärungen von Führern der englischen Liberalen sowohl als der
Arbeitspartei vor, die sich in unzweideutiger Weise zugunsten einer
Rückgabe der deutschen Kolonien aussprechen. In besonders bindender
Weise hat das Philip Snowden noch im Juli 1926 in The Nation getan. Es wird
deshalb abzuwarten sein, ob nun, da die Arbeitspartei die Macht erlangt hat und
Mr. Snowden selbst im Kabinett sitzt, den Worten auch Taten folgen werden.
Angesichts der Wandlungen, die auch englische Politiker beim Übergang
aus der Opposition in die Regierung durchzumachen pflegen, ist Skeptizismus
sicherlich am Platze und die Bereitschaft Englands, die heute von ihm verwalteten
deutschen Kolonien zurückzugeben, geschweige denn, die anderen
Mandatsmächte zu einem gleichen Schritt zu veranlassen, darf bis auf
weiteres in eine nüchterne politische Rechnung nicht eingestellt werden.
Theoretisch ist es weiter denkbar, daß eine Mandatsmacht zum Verzicht
gezwungen würde, und daß Deutschland an ihre Stelle träte.
Aber es heißt, sich darüber klar sein, daß diese
Möglichkeit im Rahmen des Völkerbundsrechtes nicht eintreten kann.
Die Satzung sieht die Entziehung eines Mandats nicht vor. Rechtlich konstruieren
ließe sie sich nur im Zusammenhang mit dem Ausschluß der
Mandatsmacht [199] aus dem Völkerbunde. Es liegt jedoch auf
der Hand, daß das das Ende des Völkerbundes und zugleich das Ende
des Mandatssystems bedeuten würde. Daraus würde sich eine
vollkommen neue Lage ergeben, die nicht aus dem Gesichtswinkel des
Mandatsrechts bebetrachtet werden kann.
Ferner kommt - wiederum theoretisch - die Möglichkeit der
Bildung eines neuen Mandatsgebietes in Frage. Praktisch ist auch sie
auszuschließen, da sie nur die Folge eines Krieges sein könnte, der mit
der Niederwerfung einer der heutigen Kolonialmächte enden
müßte. Auch das würde zu einer Neugestaltung der Erde
führen, es sei denn, daß man an eine Beraubung Hollands oder
Portugals dächte, die in eine deutsche Rechnung keinesfalls eingestellt
werden soll. Noch dazu würde es sich in diesem Falle nicht um einstigen
deutschen Besitz handeln.
So bleibt denn nur noch eine letzte Möglichkeit, die sich der zuerst
genannten nähert: die Einführung eines Turnus im Mandatsbesitz.
Aber abgesehen davon, daß dadurch auch Deutschland nur befristeten Besitz
erhielte, der seinen Ansprüchen keinesfalls genügen könnte,
abgesehen auch davon, daß der dadurch hervorgerufene ständige
Wechsel im Besitz sowohl für die Mandatsmacht, wie für das
Mandatsgebiet mit schwersten Unzuträglichkeiten verbunden wäre,
wäre die Voraussetzung dafür ein dahingehender einstimmiger
Beschluß des Rates, für den unter Umständen auch noch die
Zustimmung der Hauptmächte verlangt werden könnte. Da jedoch ein
solcher Beschluß praktisch gleichbedeutend wäre mit einem
wenigstens teilweisen freiwilligen Verzicht der heutigen Mandatsmächte,
kann auch er in eine ernsthafte Rechnung nicht eingestellt werden.
Tatsächlich haben denn auch die Mandatsmächte nie einen Zweifel
daran gelassen, daß sie glauben, ein unbefristetes Recht auf die Innehabung
der Mandatsgebiete erworben zu haben. Das ergibt sich nicht nur aus ihrer
allgemeinen Haltung. Das klingt auch aus wiederholten Äußerungen
ihrer Vertreter hervor. Bezeichnend in dieser Richtung waren Aussprüche,
die im Sommer 1926 der englische Kolonialsekretär Amery und bald darauf
der Premierminister Baldwin taten. Sie führten zu einer Auseinandersetzung
in der Presse zwischen dem früheren Gouverneur von
Deutsch-Ostafrika Dr. Schnee und Herrn Amery. Aber dieser sah sich zu einer
Änderung seiner Stellungnahme nicht veranlaßt. Und noch in
jüngster Zeit hat Sir Austen Chamberlain im Unterhause Erklärungen
über den Standpunkt der britischen Regierung abgegeben, die an
Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Nach dem Bericht der
Times vom 23. April 1929 sagte er auf eine Anfrage des Abg. Kenworthy: "Die
Mandate über die früheren deutschen Kolonien, die auf dem
Versailler Vertrage und nicht auf dem Völkerbunde beruhen, sind ihren
gegen- [200] wärtigen Inhabern endgültig
zugeteilt. Soweit ich sehe, ist niemals eine Andeutung gemacht worden, als
wünsche einer der gegenwärtigen Mandatare von seiner
Verantwortlichkeit befreit zu werden. Unsere Stellungnahme ist Deutschland zur
Zeit der Locarno-Konferenz auseinandergesetzt und seitdem mehr als einmal
bestätigt worden. Wenn ein neues Mandat geschaffen werden sollte oder in
dem unwahrscheinlichen Fall der Erledigung eines bestehenden Mandats,
wären wir bereit, den Anspruch Deutschlands zu prüfen, ebenso wie
den jeder andern Großmacht, die Mitglied des Völkerbundes ist.
Wir können aber nicht im Hinblick auf eine so hypothetische
Möglichkeit im voraus eine Verpflichtung übernehmen."
Diese Erklärung ist so präzis, als irgend denkbar, und man wird nicht
daran zweifeln dürfen, daß die anderen Mandatsmächte die in
ihr vertretene Auffassung teilen. Gewiß läßt sich ihr
gegenüber der Nachweis führen, daß Art. 22
der Völkerbundssatzung von einer endgültigen Zuteilung der Mandate
nichts weiß. Trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, daß die
maßgebenden Mächte, deren Wille für den Völkerbund
bestimmend ist, die Zuteilung als endgültig ansehen und nicht gesonnen
sind, von dieser Auffassung abzuweichen. Jetzt allerdings, nachdem Sir Austen
Chamberlain von der politischen Bühne abgetreten ist und die Arbeitspartei
die Macht ergriffen hat, wird abzuwarten sein, ob sie den Willen und die
Möglichkeit hat, die Versprechungen zu erfüllen, die ihre
Führer abgegeben haben, als sie in der Opposition standen. Solange jedoch
unzweideutige Beweise dafür nicht vorliegen, ist es ein Gebot der
politischen Vernunft, sich von den durch die
Locarno-Verträge und den Eintritt in den Völkerbund geweckten
unbegründeten und aussichtslosen Hoffnungen zu lösen und die
Sachlage klar zu erkennen. Diese Sachlage aber muß in der Feststellung
zusammengefaßt werden, daß vom Völkerbunde, so wie er heute
ist, eine Befriedigung der deutschen Kolonialansprüche nicht erwartet
werden darf. Sie kann nur Wirklichkeit werden, nachdem der Versailler Vertrag
zerrissen und nachdem der Völkerbund aufgehört hat, eine
Gemeinschaft zur Sicherung der Früchte des Weltkrieges zu sein.
Inzwischen muß es die Aufgabe Deutschlands sein, die rechtlichen
Möglichkeiten zu nutzen, um die Mandatsgebiete vor einer
förmlichen Einverleibung in die Besitzungen der Mandatare zu bewahren
und ihre Bevölkerung vor Gewalt und Unrecht zu schützen. Diesem
Ziel muß die Mitarbeit Deutschlands im Rate und im
Mandatsausschuß dienen. Und soweit es infolge der Mängel der
Satzung und der Mandatsverträge, infolge des Widerstrebens der
interessierten Mächte und der Schwäche des Mandatsausschusses
nicht erreicht werden kann, wird auch der bloße Einspruch Deutschlands der
Vorbereitung jener Neugestaltung dienen, die wir anstreben müssen.
|