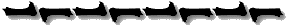|
[314] Nach dem Waffenstillstand Am Tage des Waffenstillstandes erklärte der französische Staatssekretär Ignace, daß sich Frankreich nun nicht mehr an die Berner Abmachungen, die getroffen waren, die gegenseitigen Repressalien an den Kriegsgefangenen auf ein erträgliches Maß zu bringen, halten werde. Damit waren die Deutschen in Frankreich der Brutalität ihrer Machthaber frei ausgeliefert, denn Deutschland hatte ja seine Kriegsgefangenen sofort beim Waffenstillstand freilassen müssen. Ein Druck konnte von hier aus also nicht mehr erfolgen. Die letzte Phase der qualvollen Leidenszeit in Frankreich begann. Mit ihr verbunden war besonders das Lager Candor bei Noyon. Ich habe in meinem Erlebnisbuch Prisonnier Halm (verlegt bei v. Hase & Koehler, Leipzig 1929) die Zustände in diesem grauenhaftesten aller Mannschaftsläger in Frankreich ausführlich geschildert. Ich fasse hier noch einmal kurz zusammen. Das Lager Candor galt offiziell nur als Auffangs- und Durchgangslager für die Massen von deutschen Gefangenen aus den letzten Wochen des Weltkrieges, um sie von hier aus zu Arbeiten auf den Schlachtfeldern einzusetzen. Die dazu notwendige Organisation schnell durchzuführen, war die französische Militärverwaltung aber nicht in der Lage, dagegen zeigte sie sich schnell wieder als Meister in der Einrichtung eines Systems sadistischer Quälereien an dem verhaßten deutschen Gegner, wie es [315] im Lager Candor noch lange Monate nach dem Waffenstillstand bestand und nach der Auffassung Clemenceaus (es sind 20 Millionen Deutsche zu viel auf der Welt!) mit gutem Erfolge durchgeführt worden ist. Hier wurde ja alles darangesetzt, diese Zahl zu vermindern. Das Lager bestand anfangs aus einem mit Stacheldraht umzogenen Pferch nach dem Muster von Souilly und anderswo. In Sturm, Regen und der früh einsetzenden Kälte mußten die Kriegsgefangenen hier wochenlang unter freiem Himmel kampieren. Die "Verpflegung" war die des "Hungerlagers". Warmes Essen gab es nicht. Als das Hauptlager mit Baracken versehen war, blieb das Hungerlager daneben weiter bestehen. Die neu eingelieferten Gefangenen wurden zuerst hier untergebracht. Da sie keine Zelte geliefert bekamen, gruben sie sich wie die Maulwürfe in die Erde ein. Nachts liefen sie im Kamp herum, um sich warm zu halten. Noch liegt mir dieser allnächtliche grauenhafte Klang des gruppenweisen Laufschritts in den Ohren, den die neuangekommenen Kameraden im Hungerlager in ihrer Verzweiflung stundenlang durchführten. Dazwischen stöhnten und jammerten die Kranken, bettelten durch den Zaun, der uns von ihnen trennte, um Brot, um Tabak, um einen Löffel warme Suppe. Sie starben dahin, und wir konnten ihnen nicht helfen. Das Hauptlager war erst nach Monaten eingerichtet – soweit man bei einem französischen Kriegsgefangenenlager von einer "Einrichtung" [316] überhaupt reden konnte. Es bestand aus sechs Abteilungen, die jede zwei Kompanien von je tausend Mann umfaßten. Baracken waren zwar vorhanden, boten aber nur Platz für je 200 Mann; mit 800 wurden sie "belegt"! Daneben gab es einige Spitzzelte, in die regulär 27 Mann hineingingen; bis zu 50 aber lagen darin. Die Zahl erhöhte sich noch, als der andauernde Regen einige Zeltbahnen zum Platzen brachte. Neue wurden dann nicht geliefert. Die Lagerstätten in den Baracken, von französischen Pionieren nachlässig aus Holz und Maschendraht zusammengezimmert, brachen schnell zusammen. Mit Stangen, Brettern und Tragbahren, die sich die Gefangenen aus den Wäldern zusammensuchten, wurden sie notdürftig ausgebessert und die Anzahl der Liegestätten zugleich vermehrt, so daß diese schließlich fünfstöckig bis zur Decke hinauf reichten. Wer dort keinen Platz mehr fand, blieb auf dem Boden, in den Gängen liegen. Da für Öfen nicht gesorgt war, wurden überall Holzfeuer in Glut gehalten. Der Qualm sammelte sich unter der Decke. Die dort oben lagen, hatten fortdauernd gegen Erstickungsanfälle zu kämpfen. Die deutschen Soldaten waren hinsichtlich des Essens in den letzten Kriegsmonaten wirklich nicht verwöhnt; der Fraß, den sie in Candor bekamen – anders konnte man die Verpflegung hier nicht bezeichnen –, gab manchem den Rest. Das Brot war grau, schimmlig und madig, das Fleisch von abgetriebenen, kranken, mit Geschwüren und Aussatz behafteten Pferden, die vor dem Lager ab- [317] geschlachtet wurden. Monatelang gab es nur Reis jeden Mittag, eine dünne Brühe, in der die Körner zu zählen waren. Die Gespräche nach dem Essen drehten sich nur immer darum, wer die meisten Reiskörnchen oder Stücke Kartoffelschalen in seinem Napf gehabt hatte, denn die Kartoffeln wurden ungewaschen und ungeschält in das Essen gekocht. Es waren Gespräche wie unter Irrsinnigen. Bald wütete die Ruhr unter den Gefangenen und raffte einen nach dem anderen dahin. Lazarettreif wurden aber nur Sterbende erklärt, wenn sie überhaupt noch so weit kamen. Beim Appell brachen die Kranken regelmäßig im Glied zusammen, wurden von den Kameraden an die Spitzzelte gelehnt und vom Adjutanten kaltlächelnd als malade mitgezählt. Um ihr Schicksal bekümmerte er sich nicht. Jeden Morgen wurden dann wie zum Hohne die Leichen der Gestorbenen in Kisten an der Front entlang getragen, jeden Morgen ein Dutzend und mehr. Wo sie verscharrt wurden, das wußte und erfuhr niemand von uns. Wir haben ihre Gräber nie gesehen. Trinkwasser gab es hier nicht. Für die 12 000 Kriegsgefangenen des Lagers waren nur zwei Pumpen vorhanden, die kaum das Wasser für das Essen herbeischaffen konnten. Wer sich waschen wollte, fing den Regen auf oder nahm den Kaffee dazu, der ohnehin nicht zu genießen war. Da keiner mehr als ein Hemd im Besitz hatte, trug man es monatelang auf dem Leibe, ohne es jemals waschen zu können. So kamen die Gefangenen im Dreck um, wurden von unzähligen Läusen zerfressen, [318] starben, wenn nicht an der Ruhr, an Erschöpfung und an seelischer Apathie, die viele schließlich erfaßte und dahinraffte. Denn eine Hoffnung auf Befreiung gab es nicht, seit Clemenceau erklärt hatte, die deutschen Kriegsgefangenen würden nicht eher freigelassen, ehe sie nicht den letzten Stein im zerstörten Gebiet wieder aufgebaut hätten. Das bedeutete Knechtschaft fürs Leben. Post wurde hier nicht ausgehändigt. Niemand erfuhr, wie es in der Heimat aussah; kein Liebesgabenpaket, kein Brief, keine Karte von den Lieben daheim gaben Trost und Zuversicht. Die Post nach Deutschland ging zwar durch, wehe aber dem, der auch nur die Andeutung einer Klage machte; er flog unweigerlich ins Prison. Und dieses Prison war wieder ein Musterstück von Humanität nach französischer Auffassung. Es war ein Pferch unter freiem Himmel, der mit Stacheldraht überzogen war. Der andauernde Regen hatte den Boden in einen Schlammpfuhl verwandelt. Das war das Lager für die "Verbrecher", die sich vielleicht mehrfach krank gemeldet hatten, ohne nach Ansicht des Adjutanten krank zu sein, oder die vielleicht eine Kartoffel aus der Küche entwendet oder in ihrer Verzweiflung einen Fluchtversuch gemacht hatten. Denn auch hier genügte der kleinste Anlaß, Strafe zu bekommen. Wer mit Prison bestraft wurde, mußte Mantel, Schuhe und Zeltbahn zurücklassen. Der Lagerbüttel, ein hünenhafter Elsässer, nahm ihn in [319] Empfang und prügelte ihn erst einmal mit einem dicken Stock, den er stets bei sich trug, um das ganze Lager herum. Morgens, mittags und abends schlug er dann im Prison noch auf die Gefangenen ein, daß ihre Schreie über das Lager hinschallten. Die Verpflegung war noch auf die Hälfte herabgesetzt; warmes Essen gab es nicht. Wer das Prison überlebte, war reif für das Lazarett, wenn nicht gleich für die Totenkiste. Wiedergesehen wurde keiner von ihnen. Der Friede ist schließlich auch ihnen gekommen; die deutschen Kriegsgefangenen sind heimgekehrt. Es war kaum zu fassen, dieses Glück, nach dem Grauen der Knechtschaft in Frankreich noch einmal die Heimat wiedersehen und wiedererleben zu dürfen. Doch wer das miterlebt hat, gehörte einer verschworenen Gemeinschaft an, die nur noch auf den Tag wartete, an dem alles Leid, das ihnen und den in der Gefangenschaft verbliebenen Kameraden angetan, einmal gerächt werden würde. Und dieser Tag liegt nun hinter uns. Die junge deutsche Wehrmacht ist über das Land jenseits des Rheins dahingebraust wie ein Orkan und hat es endlich niedergerungen. Mag sich die französische Nation aber nun an Napoleons Wort erinnern: "C'est plus q'un crime, c'est un faute" – Dieses alles war mehr als ein Verbrechen, es war ein Fehler.
Die ehemaligen Candoraner werden sich noch der Weihnachtstage 1918 erinnern, und sie werden [320] ihnen nie vergessen sein. Das Fest der Liebe wurde hier zu einem Fest der Hölle und des Hasses. Was alles an Schikanen und Brutalitäten nur ersonnen werden konnte, ließ der entmenschte Lagerkommandant an den Deutschen aus. Das Stöhnen und Wimmern der Kranken, das erschütternde
"Mutter-, Mutter!"-Rufen der sterbenden jungen Kameraden, dazwischen die Flüche und Verwünschungen verbitterter Männer, die die Welt nicht mehr verstehen konnten, wo solches Leid geduldet wurde, das waren die Weihnachtsklänge in den Baracken. Mancher ist in dieser Heiligen Nacht hinübergeschlummert zu einem Frieden, um den ihn jeder Zurückgebliebene beneidete. |